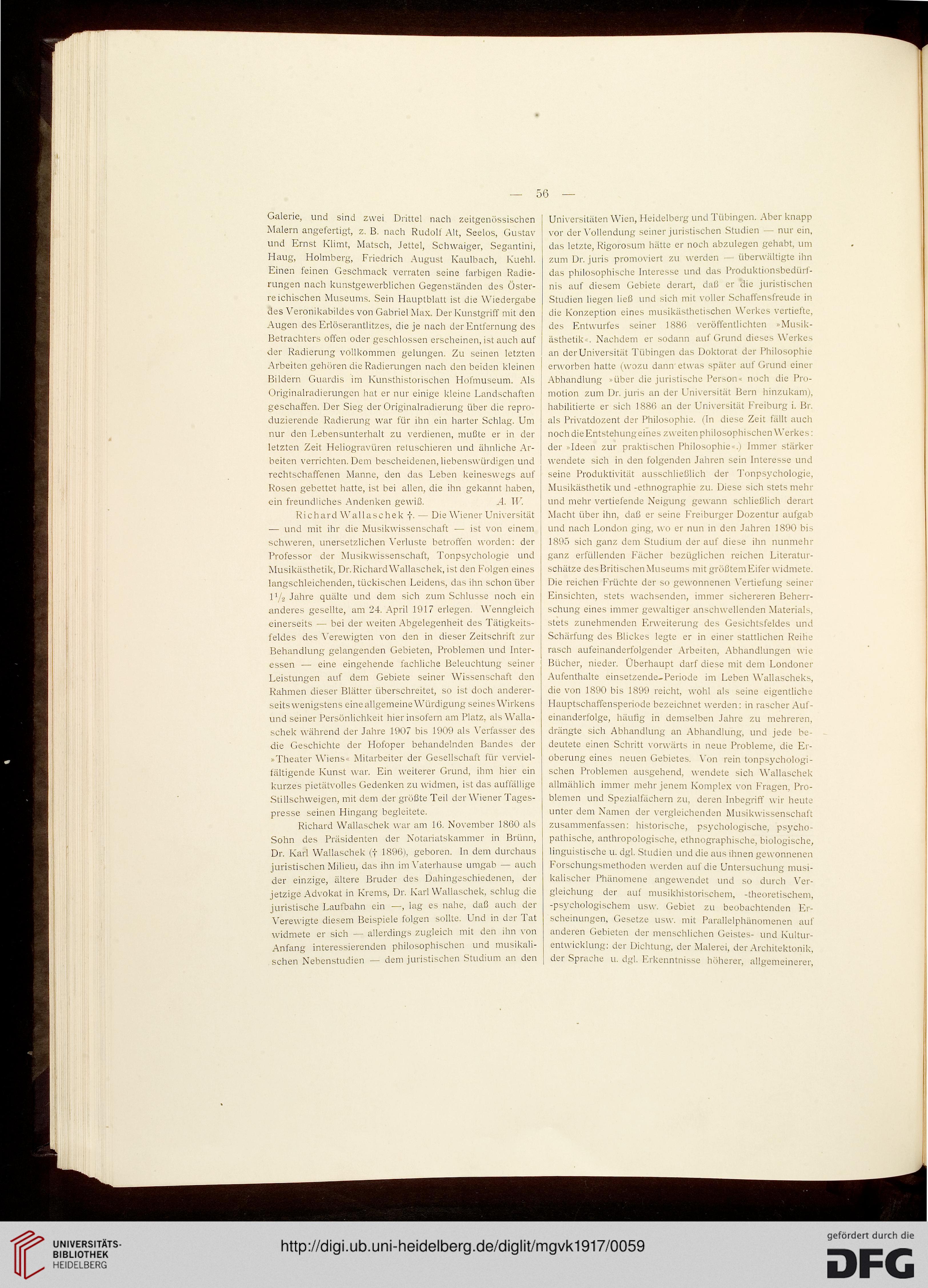56
Galeric, und sind zwei Drittel nach zeitgenössischen
Malern angefertigt, z. B. nach Rudolf Alt, Seelos, Gustav
und Ernst Klimt, Matsch, Jettel, Schwaiger, Segantini,
Haug, Holmberg, Friedrich August Kaulbach, Kuehl.
Einen feinen Geschmack verraten seine farbigen Radie-
rungen nach kunstgewerblichen Gegenständen des Öster-
reichischen Museums. Sein Hauptblatt ist die Wiedergabe
des Veronikabildes von Gabriel Max. Der Kunstgriff mit den
Augen des Erlöserantlitzes, die je nach der Entfernung des
Betrachters offen oder geschlossen erscheinen, ist auch auf
der Radierung vollkommen gelungen. Zu seinen letzten
Arbeiten gehören die Radierungen nach den beiden kleinen
Bildern Guardis im Kunsthistorischen Hofmuseum. Als
Originalradierungen hat er nur einige kleine Landschaften
geschaffen. Der Sieg der Originalradierung über die repro-
duzierende Radierung war für ihn ein harter Schlag. Um
nur den Lebensunterhalt zu verdienen, mußte er in der
letzten Zeit Heliogravüren retuschieren und ähnliche Ar-
beiten verrichten. Dem bescheidenen, liebenswürdigen und
rechtschaffenen Manne, den das Leben keineswegs auf
Rosen gebettet hatte, ist bei allen, die ihn gekannt haben,
ein freundliches Andenken gewiß. .4. II'.
Richard Wallas che k f. — Die Wiener Universität
— und mit ihr die Musikwissenschaft — ist von einem
schweren, unersetzlichen Verluste betroffen worden: der
Professor der Musikwissenschaft, Tonpsychologie und
Musikästhetik, Dr. Richard Wallaschek, ist den Folgen eines
langschleichenden, tückischen Leidens, das ihn schon über
H/s Jahre quälte und dem sich zum Schlüsse noch ein
anderes gesellte, am 24. April 1917 erlegen. Wenngleich
einerseits — bei der weiten Abgelegenheit des Tätigkeits-
feldes des Verewigten von den in dieser Zeitschrift zur
Behandlung gelangenden Gebieten, Problemen und Inter-
essen — eine eingehende fachliche Beleuchtung seiner
Leistungen auf dem Gebiete seiner Wissenschaft den
Rahmen dieser Blätter überschreitet, so ist doch anderer-
seits wenigstens eine allgemeine Würdigung seines Wirkens
und seiner Persönlichkeit hier insofern am Platz, als Walla-
schek während der Jahre 1907 bis 1909 als Verfasser des
die Geschichte der Hofoper behandelnden Bandes der
»Theater Wiens« Mitarbeiter der Gesellschaft für verviel-
fältigende Kunst war. Ein weiterer Grund, ihm hier ein
kurzes pietätvolles Gedenken zu widmen, ist das auffällige
Stillschweigen, mit dem der größte Teil der Wiener Tages-
presse seinen Hingang begleitete.
Richard Wallaschek war am 16. November 1860 als
Sohn des Präsidenten der Notariatskammer in Brunn,
Dr. Karl Wallaschek (f 1896), geboren. In dem durchaus
juristischen Milieu, das ihn im Vaterhause umgab — auch
der einzige, ältere Bruder des Dahingeschiedenen, der
jetzige Advokat in Krems, Dr. Karl Wallaschek, schlug die
juristische Laufbahn ein —, lag es nahe, daß auch der
Verewigte diesem Beispiele folgen sollte. Und in der Tat
widmete er sich — allerdings zugleich mit den ihn von
Anfang interessierenden philosophischen und musikali-
schen Nebenstudien — dem juristischen Studium an den
Universitäten Wien, Heidelberg und Tübingen. Aber knapp
vor der Vollendung seiner juristischen Studien — nur ein,
das letzte, Rigorosum hätte er noch abzulegen gehabt, um
zum Dr. juris promoviert zu werden — überwältigte ihn
das philosophische Interesse und das Produktionsbedürf-
nis auf diesem Gebiete derart, daß er die juristischen
Studien liegen ließ und sich mit voller Schaffensfreude m
die Konzeption eines rnusikästhetischen Werkes vertiefte,
des Entwurfes seiner 1880 veröffentlichten »Musik-
ästhetik«. Nachdem er sodann auf Grund dieses Werkes
an der Universität Tübingen das Doktorat der Philosophie
erworben hatte (wozu dann etwas später auf Grund einer
Abhandlung »über die juristische Person« noch die Pro-
motion zum Dr. juris an der Universität Bern hinzukam),
habilitierte er sich 1886 an der Universität Freiburg i. Br.
als Privatdozent der Philosophie. (In diese Zeit fällt auch
noch die Entstellung eines zweiten philosophischen Werkes:
der »Ideen zur praktischen Philosophie«.) Immer stärker
wendete sich in den folgenden Jahren sein Interesse und
seine Produktivität ausschließlich der Tonpsychologie,
Musikästhetik und -ethnographie zu. Diese sich stets mehr
und mehr vertiefende Neigung gewann schließlich derart
Macht über ihn, daß er seine Freiburger Dozentur aufgab
und nach London ging, wo er nun in den Jahren 1890 bis
1895 sich ganz dem Studium der auf diese ihn nunmehr
ganz erfüllenden Fächer bezüglichen reichen Literatur-
schätze desBritischen Museums mit größtemEifer widmete.
Die reichen Früchte der so gewonnenen Vertiefung seiner
Einsichten, stets wachsenden, immer sichereren Beherr-
schung eines immer gewaltiger anschwellenden Materials,
stets zunehmenden Erweiterung des Gesichtsfeldes und
Schärfung des Blickes legte er in einer stattlichen Reihe
rasch aufeinanderfolgender Arbeiten, Abhandlungen wie
Bücher, nieder. Überhaupt darf diese mit dem Londoner
Aufenthalte einsetzende-Periode im Leben Wallascheks,
die von 1890 bis 1899 reicht, wohl als seine eigentliche
Hauptschaffensperiode bezeichnet werden: in rascher Auf-
einanderfolge, häufig in demselben Jahre zu mehreren,
drängte sich Abhandlung an Abhandlung, und jede be-
deutete einen Schritt vorwärts in neue Probleme, die Er-
oberung eines neuen Gebietes. Von rein tonpsychologi-
schen Problemen ausgehend, wendete sich Wallaschek
allmählich immer mehr jenem Komplex von Fragen, Pro-
blemen und Spezialfächern zu, deren Inbegriff wir heute
unter dem Namen der vergleichenden Musikwissenschal,
zusammenfassen: historische, psychologische, psycho-
pathische, anthropologische, ethnographische, biologische,
linguistische u. dgl. Studien und die aus ihnen gewonnenen
Forschungsmethoden werden auf die Untersuchung musi-
kalischer Phänomene angewendet und so durch Ver-
gleichung der auf musikhistorischem, -theoretischem,
-psychologischem usw. Gebiet zu beobachtenden Er-
scheinungen, Gesetze usw. mit Parallelphänomenen auf
anderen Gebieten der menschlichen Geistes- und Kultur-
entwicklung: der Dichtung, der Malerei, der Architektonik,
der Sprache u. dgl. Erkenntnisse höherer, allgemeinerer,
Galeric, und sind zwei Drittel nach zeitgenössischen
Malern angefertigt, z. B. nach Rudolf Alt, Seelos, Gustav
und Ernst Klimt, Matsch, Jettel, Schwaiger, Segantini,
Haug, Holmberg, Friedrich August Kaulbach, Kuehl.
Einen feinen Geschmack verraten seine farbigen Radie-
rungen nach kunstgewerblichen Gegenständen des Öster-
reichischen Museums. Sein Hauptblatt ist die Wiedergabe
des Veronikabildes von Gabriel Max. Der Kunstgriff mit den
Augen des Erlöserantlitzes, die je nach der Entfernung des
Betrachters offen oder geschlossen erscheinen, ist auch auf
der Radierung vollkommen gelungen. Zu seinen letzten
Arbeiten gehören die Radierungen nach den beiden kleinen
Bildern Guardis im Kunsthistorischen Hofmuseum. Als
Originalradierungen hat er nur einige kleine Landschaften
geschaffen. Der Sieg der Originalradierung über die repro-
duzierende Radierung war für ihn ein harter Schlag. Um
nur den Lebensunterhalt zu verdienen, mußte er in der
letzten Zeit Heliogravüren retuschieren und ähnliche Ar-
beiten verrichten. Dem bescheidenen, liebenswürdigen und
rechtschaffenen Manne, den das Leben keineswegs auf
Rosen gebettet hatte, ist bei allen, die ihn gekannt haben,
ein freundliches Andenken gewiß. .4. II'.
Richard Wallas che k f. — Die Wiener Universität
— und mit ihr die Musikwissenschaft — ist von einem
schweren, unersetzlichen Verluste betroffen worden: der
Professor der Musikwissenschaft, Tonpsychologie und
Musikästhetik, Dr. Richard Wallaschek, ist den Folgen eines
langschleichenden, tückischen Leidens, das ihn schon über
H/s Jahre quälte und dem sich zum Schlüsse noch ein
anderes gesellte, am 24. April 1917 erlegen. Wenngleich
einerseits — bei der weiten Abgelegenheit des Tätigkeits-
feldes des Verewigten von den in dieser Zeitschrift zur
Behandlung gelangenden Gebieten, Problemen und Inter-
essen — eine eingehende fachliche Beleuchtung seiner
Leistungen auf dem Gebiete seiner Wissenschaft den
Rahmen dieser Blätter überschreitet, so ist doch anderer-
seits wenigstens eine allgemeine Würdigung seines Wirkens
und seiner Persönlichkeit hier insofern am Platz, als Walla-
schek während der Jahre 1907 bis 1909 als Verfasser des
die Geschichte der Hofoper behandelnden Bandes der
»Theater Wiens« Mitarbeiter der Gesellschaft für verviel-
fältigende Kunst war. Ein weiterer Grund, ihm hier ein
kurzes pietätvolles Gedenken zu widmen, ist das auffällige
Stillschweigen, mit dem der größte Teil der Wiener Tages-
presse seinen Hingang begleitete.
Richard Wallaschek war am 16. November 1860 als
Sohn des Präsidenten der Notariatskammer in Brunn,
Dr. Karl Wallaschek (f 1896), geboren. In dem durchaus
juristischen Milieu, das ihn im Vaterhause umgab — auch
der einzige, ältere Bruder des Dahingeschiedenen, der
jetzige Advokat in Krems, Dr. Karl Wallaschek, schlug die
juristische Laufbahn ein —, lag es nahe, daß auch der
Verewigte diesem Beispiele folgen sollte. Und in der Tat
widmete er sich — allerdings zugleich mit den ihn von
Anfang interessierenden philosophischen und musikali-
schen Nebenstudien — dem juristischen Studium an den
Universitäten Wien, Heidelberg und Tübingen. Aber knapp
vor der Vollendung seiner juristischen Studien — nur ein,
das letzte, Rigorosum hätte er noch abzulegen gehabt, um
zum Dr. juris promoviert zu werden — überwältigte ihn
das philosophische Interesse und das Produktionsbedürf-
nis auf diesem Gebiete derart, daß er die juristischen
Studien liegen ließ und sich mit voller Schaffensfreude m
die Konzeption eines rnusikästhetischen Werkes vertiefte,
des Entwurfes seiner 1880 veröffentlichten »Musik-
ästhetik«. Nachdem er sodann auf Grund dieses Werkes
an der Universität Tübingen das Doktorat der Philosophie
erworben hatte (wozu dann etwas später auf Grund einer
Abhandlung »über die juristische Person« noch die Pro-
motion zum Dr. juris an der Universität Bern hinzukam),
habilitierte er sich 1886 an der Universität Freiburg i. Br.
als Privatdozent der Philosophie. (In diese Zeit fällt auch
noch die Entstellung eines zweiten philosophischen Werkes:
der »Ideen zur praktischen Philosophie«.) Immer stärker
wendete sich in den folgenden Jahren sein Interesse und
seine Produktivität ausschließlich der Tonpsychologie,
Musikästhetik und -ethnographie zu. Diese sich stets mehr
und mehr vertiefende Neigung gewann schließlich derart
Macht über ihn, daß er seine Freiburger Dozentur aufgab
und nach London ging, wo er nun in den Jahren 1890 bis
1895 sich ganz dem Studium der auf diese ihn nunmehr
ganz erfüllenden Fächer bezüglichen reichen Literatur-
schätze desBritischen Museums mit größtemEifer widmete.
Die reichen Früchte der so gewonnenen Vertiefung seiner
Einsichten, stets wachsenden, immer sichereren Beherr-
schung eines immer gewaltiger anschwellenden Materials,
stets zunehmenden Erweiterung des Gesichtsfeldes und
Schärfung des Blickes legte er in einer stattlichen Reihe
rasch aufeinanderfolgender Arbeiten, Abhandlungen wie
Bücher, nieder. Überhaupt darf diese mit dem Londoner
Aufenthalte einsetzende-Periode im Leben Wallascheks,
die von 1890 bis 1899 reicht, wohl als seine eigentliche
Hauptschaffensperiode bezeichnet werden: in rascher Auf-
einanderfolge, häufig in demselben Jahre zu mehreren,
drängte sich Abhandlung an Abhandlung, und jede be-
deutete einen Schritt vorwärts in neue Probleme, die Er-
oberung eines neuen Gebietes. Von rein tonpsychologi-
schen Problemen ausgehend, wendete sich Wallaschek
allmählich immer mehr jenem Komplex von Fragen, Pro-
blemen und Spezialfächern zu, deren Inbegriff wir heute
unter dem Namen der vergleichenden Musikwissenschal,
zusammenfassen: historische, psychologische, psycho-
pathische, anthropologische, ethnographische, biologische,
linguistische u. dgl. Studien und die aus ihnen gewonnenen
Forschungsmethoden werden auf die Untersuchung musi-
kalischer Phänomene angewendet und so durch Ver-
gleichung der auf musikhistorischem, -theoretischem,
-psychologischem usw. Gebiet zu beobachtenden Er-
scheinungen, Gesetze usw. mit Parallelphänomenen auf
anderen Gebieten der menschlichen Geistes- und Kultur-
entwicklung: der Dichtung, der Malerei, der Architektonik,
der Sprache u. dgl. Erkenntnisse höherer, allgemeinerer,