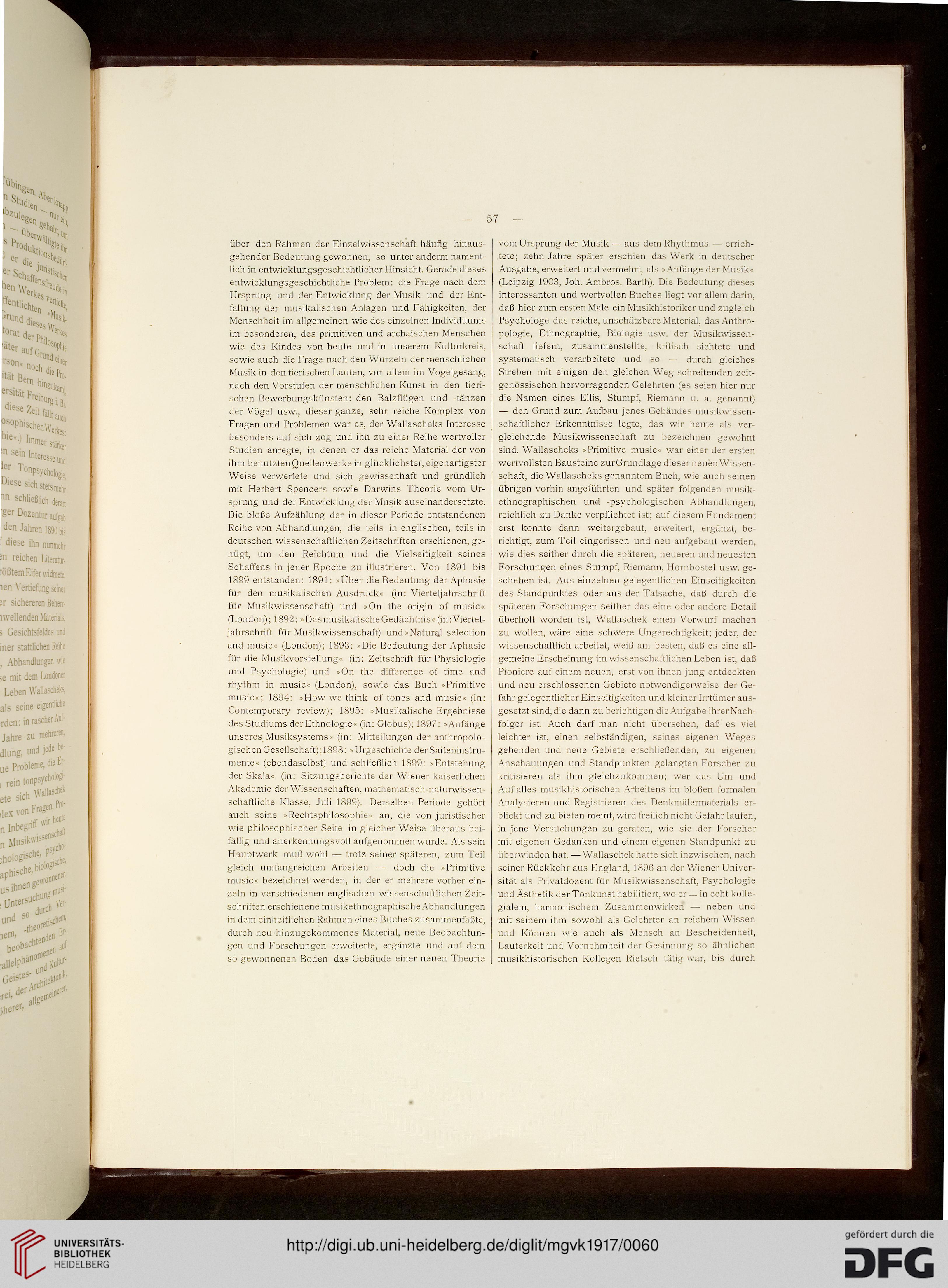HHfHe
l*en,.-, ™ Hl»
6r d* iu„ ^
;rsO
henW
ffentlich,'
f"nddies
torat der.
lt8t Ben, v ^
-'bürg;
***
* ^"Psychologie
nn 5chl'eßüch fer,
'Ser D. .zentur aufgab
den Jahi
n nunmeh-
:n reiche [
"ößtem Eifer widmete
len Vertie] .
:r sichere i
lwellendei
mer stattlichen Reibe
. Abhandl
,e mit dem Londone-
Leben Wallaschek-,
rden: in
Jahre zu mehrerer
dlung. und jede ba-
ue Probleme, die Er-
rein«
ete .ich **■**
lla von Fragen.^
ff wir h*
ist
,heref'
57
über den Rahmen der Einzelwissenschaft häufig hinaus-
gehender Bedeutung gewonnen, so unter anderm nament-
lich in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht Gerade dieses
entwicklungsgeschichtliche Problem: die Frage nach dem
Ursprung und der Entwicklung der Musik und der Ent-
faltung der musikalischen Anlagen und Fähigkeiten, der
Menschheit im allgemeinen wie des einzelnen Individuums
im besonderen, des primitiven und archaischen Menschen
wie des Kindes von heute und in unserem Kulturkreis,
sowie auch die Frage nach den Wurzeln der menschlichen
Musik in den tierischen Lauten, vor allem im Vogelgesang,
nach den Vorstufen der menschlichen Kunst in den tieri-
schen Bewerbungskünsten: den Balzflügen und -tanzen
der Vögel usw., dieser ganze, sehr reiche Komplex von
Fragen und Problemen war es, der Wallascheks Interesse
besonders auf sich zog und ihn zu einer Reihe wertvoller
Studien anregte, in denen er das reiche Material der von
ihm benutztenQuellenwerke in glücklichster, eigenartigster
Weise verwertete und sich gewissenhaft und gründlich
mit Herbert Spencers sowie Darwins Theorie vom Ur-
sprung und der Entwicklung der Musik auseinandersetzte.
Die bloße Aufzählung der in dieser Periode entstandenen
Reihe von Abhandlungen, die teils in englischen, teils in
deutschen wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen, ge-
nügt, um den Reichtum und die Vielseitigkeit seines
Schaffens in jener Epoche zu illustrieren. Von 1891 bis
1899 entstanden: 1891: Ȇber die Bedeutung der Aphasie
für den musikalischen Ausdruck« (in: Vierteljahrschrift
für Musikwissenschaft) und »On the origin of music«
(London); 1892: »DasmusikalischeGedächtnis«(in:Viertel-
jahrschrift für Musikwissenschaft) und »Natural selection
and music« (London); 1893: »Die Bedeutung der Aphasie
für die Musikvorstellung« (in: Zeitschrift für Physiologie
und Psychologie) und »On the difference of time and
rhythm in music« (London), sowie das Buch »Primitive
music«; 1894: »How we think of tones and music« (in:
Contemporary review); 1895: »Musikalische Ergebnisse
des Studiums der Ethnologie« (in: Globus); 1897: »Anfänge
unseres Musiksystems« (in: Mitteilungen der anthropolo-
gischen Gesellschaft);1898: »Urgeschichte derSaiteninstru-
mente« (ebendaselbst) und schließlich 1899: »Entstehung
der Skala« (in: Sitzungsberichte der Wiener kaiserlichen I
Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissen-
schaftliche Klasse, Juli 1899). Derselben Periode gehört
auch seine »Rechtsphilosophie« an, die von juristischer
wie philosophischer Seite in gleicher Weise überaus bei-
fällig und anerkennungsvoll aufgenommen wurde. Als sein
Hauptwerk muß wohl — trotz seiner späteren, zum Teil
gleich umfangreichen Arbeiten — doch die »Primitive
music« bezeichnet werden, in der er mehrere vorher ein-
zeln in verschiedenen englischen wissenschaftlichen Zeit-
schriften erschienene musikethnographische Abhandlungen
in dem einheitlichen Rahmen eines Buches zusammenfaßte,
durch neu hinzugekommenes Material, neue Beobachtun-
gen und Forschungen erweiterte, ergänzte und auf dem
so gewonnenen Boden das Gebäude einer neuen Theorie
vom Ursprung der Musik — aus dem Rhythmus — errich-
tete; zehn Jahre später erschien das Werk in deutscher
Ausgabe, erweitert und vermehrt, als »Anfänge der Musik«
(Leipzig 1903, Joh. Ambros. Barth). Die Bedeutung dieses
interessanten und wertvollen Buches liegt vor allem darin,
daß hier zum ersten Male ein Musikhistoriker und zugleich
Psychologe das reiche, unschätzbare Material, das Anthro-
pologie, Ethnographie, Biologie usw. der Musikwissen-
schaft liefern, zusammenstellte, kritisch sichtete und
systematisch verarbeitete und so — durch gleiches
Streben mit einigen den gleichen Weg schreitenden zeit-
genössischen hervorragenden Gelehrten (es seien hier nur
die Namen eines Ellis, Stumpf, Riemann u. a. genannt)
— den Grund zum Aufbau jenes Gebäudes musikwissen-
schaftlicher Erkenntnisse legte, das wir heute als ver-
gleichende Musikwissenschaft zu bezeichnen gewohnt
sind. Wallascheks »Primitive music« war einer der ersten
wertvollsten Bausteine zurGrundlage dieser neuen Wissen-
schaft, die Wallascheks genanntem Buch, wie auch seinen
übrigen vorhin angeführten und später folgenden musik-
ethnographischen und -psychologischen Abhandlungen,
reichlich zu Danke verpflichtet ist; auf diesem Fundament
erst konnte dann weitergebaut, erweitert, ergänzt, be-
richtigt, zum Teil eingerissen und neu aufgebaut werden,
wie dies seither durch die späteren, neueren und neuesten
Forschungen eines Stumpf, Riemann, Hombostel usw. ge-
schehen ist. Aus einzelnen gelegentlichen Einseitigkeiten
des Standpunktes oder aus der Tatsache, daß durch die
späteren Forschungen seither das eine oder andere Detail
überholt worden ist, Wallaschek einen Vorwurf machen
zu wollen, wäre eine schwere Ungerechtigkeit; jeder, der
wissenschaftlich arbeitet, weiß am besten, daß es eine all-
gemeine Erscheinung im wissenschaftlichen Leben ist, daß
Pioniere auf einem neuen, erst von ihnen jung entdeckten
und neu erschlossenen Gebiete notwendigerweise der Ge-
fahr gelegentlicher Einseitigkeiten und kleiner Irrtümer aus-
gesetzt sind,die dann zu berichtigen dieAufgabe ihrerNach-
folger ist. Auch darf man nicht übersehen, daß es viel
leichter ist, einen selbständigen, seines eigenen Weges
gehenden und neue Gebiete erschließenden, zu eigenen
Anschauungen und Standpunkten gelangten Forscher zu
kritisieren als ihm gleichzukommen; wer das Um und
Auf alles musikhistorischen Arbeitens im bloßen formalen
Analysieren und Registrieren des Denkmälermaterials er-
blickt und zu bieten meint, wird freilich nicht Gefahr laufen,
in jene Versuchungen zu geraten, wie sie der Forscher
mit eigenen Gedanken und einem eigenen Standpunkt zu
überwinden hat. —Wallaschek hatte sich inzwischen, nach
seiner Rückkehr aus England, 1896 an der Wiener Univer-
sität als Privatdozent für Musikwissenschaft, Psychologie
und Ästhetik der Tonkunst habilitiert, wo er _ in echt kolle-
gialem, harmonischem Zusammenwirken — neben und
mit seinem ihm sowohl als Gelehrter an reichem Wissen
und Können wie auch als Mensch an Bescheidenheit,
Lauterkeit und Vornehmheit der Gesinnung so ähnlichen
musikhistorischen Kollegen Rietsch tätig war, bis durch
'.,::;■ ;r:y:,r
l*en,.-, ™ Hl»
6r d* iu„ ^
;rsO
henW
ffentlich,'
f"nddies
torat der.
lt8t Ben, v ^
-'bürg;
***
* ^"Psychologie
nn 5chl'eßüch fer,
'Ser D. .zentur aufgab
den Jahi
n nunmeh-
:n reiche [
"ößtem Eifer widmete
len Vertie] .
:r sichere i
lwellendei
mer stattlichen Reibe
. Abhandl
,e mit dem Londone-
Leben Wallaschek-,
rden: in
Jahre zu mehrerer
dlung. und jede ba-
ue Probleme, die Er-
rein«
ete .ich **■**
lla von Fragen.^
ff wir h*
ist
,heref'
57
über den Rahmen der Einzelwissenschaft häufig hinaus-
gehender Bedeutung gewonnen, so unter anderm nament-
lich in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht Gerade dieses
entwicklungsgeschichtliche Problem: die Frage nach dem
Ursprung und der Entwicklung der Musik und der Ent-
faltung der musikalischen Anlagen und Fähigkeiten, der
Menschheit im allgemeinen wie des einzelnen Individuums
im besonderen, des primitiven und archaischen Menschen
wie des Kindes von heute und in unserem Kulturkreis,
sowie auch die Frage nach den Wurzeln der menschlichen
Musik in den tierischen Lauten, vor allem im Vogelgesang,
nach den Vorstufen der menschlichen Kunst in den tieri-
schen Bewerbungskünsten: den Balzflügen und -tanzen
der Vögel usw., dieser ganze, sehr reiche Komplex von
Fragen und Problemen war es, der Wallascheks Interesse
besonders auf sich zog und ihn zu einer Reihe wertvoller
Studien anregte, in denen er das reiche Material der von
ihm benutztenQuellenwerke in glücklichster, eigenartigster
Weise verwertete und sich gewissenhaft und gründlich
mit Herbert Spencers sowie Darwins Theorie vom Ur-
sprung und der Entwicklung der Musik auseinandersetzte.
Die bloße Aufzählung der in dieser Periode entstandenen
Reihe von Abhandlungen, die teils in englischen, teils in
deutschen wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen, ge-
nügt, um den Reichtum und die Vielseitigkeit seines
Schaffens in jener Epoche zu illustrieren. Von 1891 bis
1899 entstanden: 1891: Ȇber die Bedeutung der Aphasie
für den musikalischen Ausdruck« (in: Vierteljahrschrift
für Musikwissenschaft) und »On the origin of music«
(London); 1892: »DasmusikalischeGedächtnis«(in:Viertel-
jahrschrift für Musikwissenschaft) und »Natural selection
and music« (London); 1893: »Die Bedeutung der Aphasie
für die Musikvorstellung« (in: Zeitschrift für Physiologie
und Psychologie) und »On the difference of time and
rhythm in music« (London), sowie das Buch »Primitive
music«; 1894: »How we think of tones and music« (in:
Contemporary review); 1895: »Musikalische Ergebnisse
des Studiums der Ethnologie« (in: Globus); 1897: »Anfänge
unseres Musiksystems« (in: Mitteilungen der anthropolo-
gischen Gesellschaft);1898: »Urgeschichte derSaiteninstru-
mente« (ebendaselbst) und schließlich 1899: »Entstehung
der Skala« (in: Sitzungsberichte der Wiener kaiserlichen I
Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissen-
schaftliche Klasse, Juli 1899). Derselben Periode gehört
auch seine »Rechtsphilosophie« an, die von juristischer
wie philosophischer Seite in gleicher Weise überaus bei-
fällig und anerkennungsvoll aufgenommen wurde. Als sein
Hauptwerk muß wohl — trotz seiner späteren, zum Teil
gleich umfangreichen Arbeiten — doch die »Primitive
music« bezeichnet werden, in der er mehrere vorher ein-
zeln in verschiedenen englischen wissenschaftlichen Zeit-
schriften erschienene musikethnographische Abhandlungen
in dem einheitlichen Rahmen eines Buches zusammenfaßte,
durch neu hinzugekommenes Material, neue Beobachtun-
gen und Forschungen erweiterte, ergänzte und auf dem
so gewonnenen Boden das Gebäude einer neuen Theorie
vom Ursprung der Musik — aus dem Rhythmus — errich-
tete; zehn Jahre später erschien das Werk in deutscher
Ausgabe, erweitert und vermehrt, als »Anfänge der Musik«
(Leipzig 1903, Joh. Ambros. Barth). Die Bedeutung dieses
interessanten und wertvollen Buches liegt vor allem darin,
daß hier zum ersten Male ein Musikhistoriker und zugleich
Psychologe das reiche, unschätzbare Material, das Anthro-
pologie, Ethnographie, Biologie usw. der Musikwissen-
schaft liefern, zusammenstellte, kritisch sichtete und
systematisch verarbeitete und so — durch gleiches
Streben mit einigen den gleichen Weg schreitenden zeit-
genössischen hervorragenden Gelehrten (es seien hier nur
die Namen eines Ellis, Stumpf, Riemann u. a. genannt)
— den Grund zum Aufbau jenes Gebäudes musikwissen-
schaftlicher Erkenntnisse legte, das wir heute als ver-
gleichende Musikwissenschaft zu bezeichnen gewohnt
sind. Wallascheks »Primitive music« war einer der ersten
wertvollsten Bausteine zurGrundlage dieser neuen Wissen-
schaft, die Wallascheks genanntem Buch, wie auch seinen
übrigen vorhin angeführten und später folgenden musik-
ethnographischen und -psychologischen Abhandlungen,
reichlich zu Danke verpflichtet ist; auf diesem Fundament
erst konnte dann weitergebaut, erweitert, ergänzt, be-
richtigt, zum Teil eingerissen und neu aufgebaut werden,
wie dies seither durch die späteren, neueren und neuesten
Forschungen eines Stumpf, Riemann, Hombostel usw. ge-
schehen ist. Aus einzelnen gelegentlichen Einseitigkeiten
des Standpunktes oder aus der Tatsache, daß durch die
späteren Forschungen seither das eine oder andere Detail
überholt worden ist, Wallaschek einen Vorwurf machen
zu wollen, wäre eine schwere Ungerechtigkeit; jeder, der
wissenschaftlich arbeitet, weiß am besten, daß es eine all-
gemeine Erscheinung im wissenschaftlichen Leben ist, daß
Pioniere auf einem neuen, erst von ihnen jung entdeckten
und neu erschlossenen Gebiete notwendigerweise der Ge-
fahr gelegentlicher Einseitigkeiten und kleiner Irrtümer aus-
gesetzt sind,die dann zu berichtigen dieAufgabe ihrerNach-
folger ist. Auch darf man nicht übersehen, daß es viel
leichter ist, einen selbständigen, seines eigenen Weges
gehenden und neue Gebiete erschließenden, zu eigenen
Anschauungen und Standpunkten gelangten Forscher zu
kritisieren als ihm gleichzukommen; wer das Um und
Auf alles musikhistorischen Arbeitens im bloßen formalen
Analysieren und Registrieren des Denkmälermaterials er-
blickt und zu bieten meint, wird freilich nicht Gefahr laufen,
in jene Versuchungen zu geraten, wie sie der Forscher
mit eigenen Gedanken und einem eigenen Standpunkt zu
überwinden hat. —Wallaschek hatte sich inzwischen, nach
seiner Rückkehr aus England, 1896 an der Wiener Univer-
sität als Privatdozent für Musikwissenschaft, Psychologie
und Ästhetik der Tonkunst habilitiert, wo er _ in echt kolle-
gialem, harmonischem Zusammenwirken — neben und
mit seinem ihm sowohl als Gelehrter an reichem Wissen
und Können wie auch als Mensch an Bescheidenheit,
Lauterkeit und Vornehmheit der Gesinnung so ähnlichen
musikhistorischen Kollegen Rietsch tätig war, bis durch
'.,::;■ ;r:y:,r