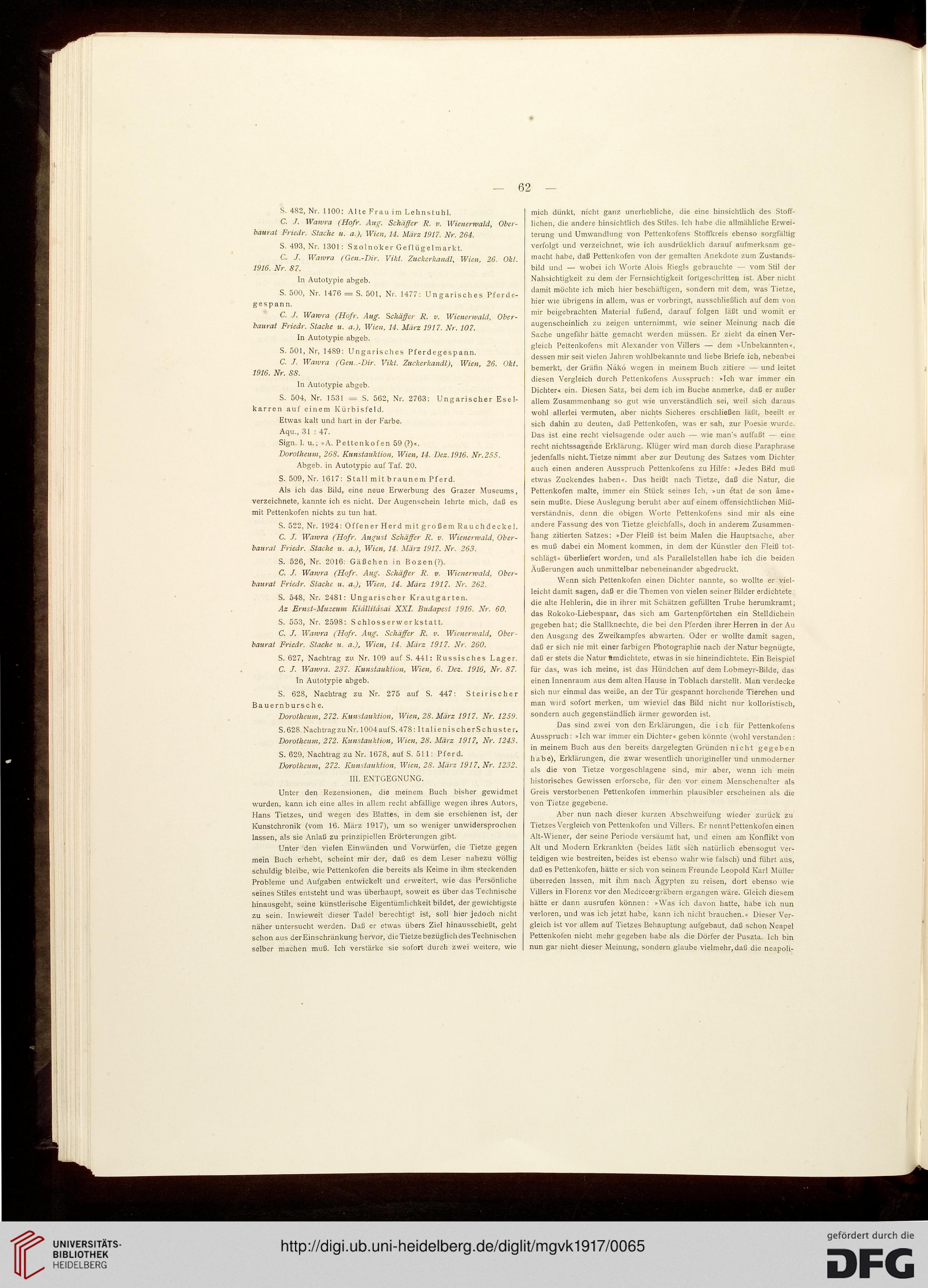- 62
S. 482, Nr. 1100: Alte Frau im Lehnstuhl.
C. .7. Wawra (Hofr. Aug. Schaffst R. v. Wienerwald, Ober-
baurat Friedr. Stacke u. a.), Wien, 14. März 1917. Nr. 264.
S. 493, Nr. 1301: Szolnoker Geflügelmarkt.
C. 7. Wawra (Gen.-T)ir. Vilä. Zuckcrkandl, Wien, 26. Okt.
1916. Nr. 87.
In Autotypie abgeb.
S. 500, Nr. 1476 = S. 501, Nr. 1477: Ungarisches Pferde-
gespann.
C. J. Wawra (Hofr. Aug. Schaffet R. v. Wienerwald, Ober-
baurat Friedr. Stäche u. a.), Wien, 14. März 1917. Nr. 107.
In Autotypie abgeb.
S. 501, Nr, 1489: Ungarisches Pferdegespann.
C. J. Wawra (Gen..-Dir. Vilä. Zuckerkandl), Wien, 26. Okt.
1916. Nr. SS.
In Autotypie abgeb.
S. 504, Nr. 1531 = S. 5025 Nr. 2763: Ungarischer Esel-
karren auf einem Kürbisfeld.
Etwas kalt und hart in der Farbe.
Aqu., 31 : 47.
Sign. I. u., »A. Pettenkofen 59 (?)«.
Dorotheum, 268. Kunstauktion, Wien, 14. Dez. 1916. Nr.255.
Abgeb. in Autotypie auf Taf. 20.
S. 509, Nr. 1617: Stall mit braunem Pferd.
Als ich das Bild, eine neue Erwerbung des Grazer Museums,
verzeichnete, kannte ich es nicht. Der Augenschein lehrte mich, daß es
mit Pettenkofen nichts zu tun hat.
S. 522. Nr. 1924: Offener Herd mit großem Rauch decke I.
C. J. Wawra (Hofr. August Schaff er R. v. Wienerwald, Ober-
baurat Friedr. Stäche u. a.), Wien, 14. März 1917. Nr. 263.
S. 526, Nr. 2016: Gäßchen in Rozen(?).
C. J. Wawra (Hofr. Aug. Schaffet- R. v. Wienerwald, Ober-
baurat Friedr. Stäche u. a.), Wien, 14. März 1917. Nr. 262.
S. 548, Nr. 2481: Ungarischer Krautgarten.
Az Ernst-Muzeum Kidllitdsai XXL Budapest 1916. Nr. 60.
S. 553, Nr. 2598: Schlosserwerkstatt.
C. J. Wawra (Hofr. Aug. Schaffer R. v. Wtcnerwald, Ober-
baurat Friedr. Stäche u. a.), Wien, 14. März 1917. Nr. 260.
S. 627, Nachtrag zu Nr. 109 auf S. 441: Russisches Lager.
C. J. Wawra. 237. Kunstauktion, Wien, 6. Dez. 1916, Nr. 87.
In Autotypie abgeb.
S. 628, Nachtrag zu Nr. 275 auf S. 447: Steirischer
Bauernbursch e.
Dorotheum, 272. Kumtauktion, Wien, 28. März 1917. Nr. 1259.
S. 628. Nachtrag zu Nr. 1004 auf S. 478 italienisch erSchuster.
Dorotheum, 272. Kunstauktion, Wien, 28. März 1917, Nr. 1243.
S. 629, Nachtrag za Nr. 1678, auf S. 511: Pferd.
Dorotheum, 272. Kunstauktion, Wien, 28. März 1917, Nr. 1232.
III. ENTGEGNUNG.
Unter den Rezensionen, die meinem Buch bisher gewidmet
wurden, kann ich eine alles in allem recht abfallige wegen ihres Autors,
Hans Tletzes, und wegen des Blattes, in dem sie erschienen ist, der
Kunstchronik (vom 16. März 1917), um so weniger unwidersprochen
lassen, als sie Anlaß zu prinzipiellen Erörterungen gibt.
Unter den vielen Einwänden und Vorwürfen, die Tietze gegen
mein Buch erhebt, scheint mir der, daß es dem Leser nahezu völlig
schuldig bleibe, wie Pettenkofen die bereits als Keime in ihm steckenden
Probleme und Aufgaben entwickelt und erweitert, wie das Persönliche
seines Stiles entsteht und was überhaupt, soweit es über das Technische
hinausgeht, seine künstlerische Eigentümlichkeit bildet, der gewichtigste
zu sein. Inwieweit dieser Tadel berechtigt ist, soll hier jedoch nicht
näher untersucht werden. Daß er etwas übers Ziel hinausschießt, geht
schon aus der Einschränkung hervor, die Tietze bezüglich des Technischen
selber machen muß. Ich verstärke sie sofort durch zwei weitere, wie
mich dünkt, nicht ganz unerhebliche, die eine hinsichtlich des Stoff-
lichen, die andere hinsichtlich des Stiles. Ich habe die allmähliche Erwei-
terung und Umwandlung von Pettenknfens Stoffkreis ebenso sorgfältig
verfolgt und verzeichnet, wie ich ausdrücklich darauf aufmerksam ge-
macht habe, daß Pettenkofen von der gemalten Anekdote zum Zustands-
büd und — wobei ich Worte Alois Riegls gebrauchte — vom Stil der
Nahsichtigkeit zu dem der Fernsichtigkeit fortgeschritten ist. Aber nicht
damit möchte ich mich hier beschäftigen, sondern mit dem, was Tietze,
hier wie übrigens in allem, was er vorbringt, ausschließlich auf dem von
mir beigebrachten Material fußend, darauf folgen läßt und womit er
augenscheinlich zu zeigen unternimmt, wie seiner Meinung nach die
Sache ungefähr hatte gemacht werden müssen. Er zieht da einen Ver-
gleich Pettenkofens mit Alexander von Villers — dem »Unbekannten«,
dessen mir seit vielen Jahren wohlbekannte und liebe Briefe ich, nebenbei
bemerkt, der Gräfin Näkö wegen in meinem Buch zitiere — und leitet
diesen Vergleich durch Pettenkofens Ausspruch: »Ich war immer ein
Dichter« ein. Diesen Satz, bei dem ich im Buche anmerke, daß er außer
allem Zusammenhang so gut wie unverständlich sei, weil sich daraus
wohl allerlei vermuten, aber nichts Sicheres erschließen laßt, beeilt er
sich dahin zu deuten, daß Pettenkofen, was er sah, zur Poesie wurde.
Das ist eine recht vielsagende oder auch — wie man's auffaßt — eine
recht nichtssagende Erklärung. Klüger wird man durch diese Paraphrase
jedenfalls nicht. Tietze nimmt aber zur Deutung des Satzes vom Dichter
auch einen anderen Ausspruch Pettenkofens zu Hilfe: »Jedes BHd muß
etwas Zuckendes haben«. Das heißt nach Tietze, daß die Natur, die
Pettenkofen malte, immer ein Stück seines Ich, »un etat de son äme«
sein mußte. Diese Auslegung beruht aber auf einem offensichtlichen Miß-
verständnis, denn die obigen Worte Pettenkofens sind mir als eine
andere Fassung des von Tietze gleichfalls, doch in anderem Zusammen-
hang zitierten Satzes: »Der Fleiß ist beim Malen die Hauptsache, aber
es muß dabei ein Moment kommen, in dem der Künstler den Fleiß tnt-
schlägt« überliefert worden, und als Parallelstellen habe ich die beiden
Äußerungen auch unmittelbar nebeneinander abgedruckt.
Wenn sich Pettenkofen einen Dichter nannte, so wollte er viel-
leicht damit sagen, daß er die Themen von vielen seiner Bilder erdichtete:
die alte Hehlerin, die in ihrer mit Schätzen gefüllten Truhe herumkramt;
das Rokoko-Liebespaar, das sich am GartenpfÖrtchen ein Stelldichein
gegeben hat; die Stallknechte, die bei den Pferden ihrer Herren in der Au
den Ausgang des Zweikampfes abwarten. Oder er wollte damit sagen,
daß er sich nie mit einer farbigen Photographie nach der Natur begnügte,
daß er stets die Natur ftmdichtete, etwas in sie hineindichtete. Ein Beispiel
für das, was ich meine, ist das Hündchen auf dem Lobmeyr-Bilde, das
einen Innenraum aus dem alten Hause in Toblach darstellt. Man verdecke
sich nur einmal das weiße, an der Tür gespannt horchende Tierchen und
man wnd sofort merken, um wieviel das Bild nicht nur kolloristisch,
sondern auch gegenständlich ärmer geworden ist.
Das sind zwei von den Erklärungen, die ich für Pettenkofens
Aussprach: »Ich war immer ein Dichter« geben konnte (wohlverstanden:
in meinem Buch aus den bereits dargelegten Gründen nicht gegeben
habe), Erklärungen, die zwar wesentlich unorigineller und unmoderner
als die von Tietze vorgeschlagene sind, mir aber, wenn ich mein
historisches Gewissen erforsche, für den vor einem Menschenalter als
Greis verstorbenen Pettenkofen immerhin plausibler erscheinen als die
von Tietze gegebene.
Aber nun nach dieser kurzen Abschweifung wieder zurück zu
Tietzes Vergleich von Pettenkofen und Villers. Er nennt Pettenkofen einen
Alt-Wiener, der seine Periode versäumt hat, und einen am Konflikt von
Alt und Modern Erkrankten (beides läßt sich natürlich ebensogut ver-
teidigen wie bestreiten, beides ist ebenso wahr wie falsch) und führt aus,
daß es Pettenkofen, hätte er sich von seinem Freunde Leopold Karl Müller
überreden lassen, mit ihm nach Ägypten zu reisen, dort ebenso wie
Villers in Florenz vor den Mediceergräbern ergangen wäre. Gleich diesem
hätte er dann ausrufen können: »Was ich davon hatte, habe ich nun
verloren, und was ich jetzt habe, kann ich nicht braueben.« Dieser Ver-
gleich ist vor allem auf Tietzes Behauptung aufgebaut, daß schon Neapel
Pettenkofen nicht mehr gegeben habe als die Dörfer der Puszta. Ich bin
nun gar nicht dieser Meinung, sondern glaube vielmehr, daß die neapoli-
S. 482, Nr. 1100: Alte Frau im Lehnstuhl.
C. .7. Wawra (Hofr. Aug. Schaffst R. v. Wienerwald, Ober-
baurat Friedr. Stacke u. a.), Wien, 14. März 1917. Nr. 264.
S. 493, Nr. 1301: Szolnoker Geflügelmarkt.
C. 7. Wawra (Gen.-T)ir. Vilä. Zuckcrkandl, Wien, 26. Okt.
1916. Nr. 87.
In Autotypie abgeb.
S. 500, Nr. 1476 = S. 501, Nr. 1477: Ungarisches Pferde-
gespann.
C. J. Wawra (Hofr. Aug. Schaffet R. v. Wienerwald, Ober-
baurat Friedr. Stäche u. a.), Wien, 14. März 1917. Nr. 107.
In Autotypie abgeb.
S. 501, Nr, 1489: Ungarisches Pferdegespann.
C. J. Wawra (Gen..-Dir. Vilä. Zuckerkandl), Wien, 26. Okt.
1916. Nr. SS.
In Autotypie abgeb.
S. 504, Nr. 1531 = S. 5025 Nr. 2763: Ungarischer Esel-
karren auf einem Kürbisfeld.
Etwas kalt und hart in der Farbe.
Aqu., 31 : 47.
Sign. I. u., »A. Pettenkofen 59 (?)«.
Dorotheum, 268. Kunstauktion, Wien, 14. Dez. 1916. Nr.255.
Abgeb. in Autotypie auf Taf. 20.
S. 509, Nr. 1617: Stall mit braunem Pferd.
Als ich das Bild, eine neue Erwerbung des Grazer Museums,
verzeichnete, kannte ich es nicht. Der Augenschein lehrte mich, daß es
mit Pettenkofen nichts zu tun hat.
S. 522. Nr. 1924: Offener Herd mit großem Rauch decke I.
C. J. Wawra (Hofr. August Schaff er R. v. Wienerwald, Ober-
baurat Friedr. Stäche u. a.), Wien, 14. März 1917. Nr. 263.
S. 526, Nr. 2016: Gäßchen in Rozen(?).
C. J. Wawra (Hofr. Aug. Schaffet- R. v. Wienerwald, Ober-
baurat Friedr. Stäche u. a.), Wien, 14. März 1917. Nr. 262.
S. 548, Nr. 2481: Ungarischer Krautgarten.
Az Ernst-Muzeum Kidllitdsai XXL Budapest 1916. Nr. 60.
S. 553, Nr. 2598: Schlosserwerkstatt.
C. J. Wawra (Hofr. Aug. Schaffer R. v. Wtcnerwald, Ober-
baurat Friedr. Stäche u. a.), Wien, 14. März 1917. Nr. 260.
S. 627, Nachtrag zu Nr. 109 auf S. 441: Russisches Lager.
C. J. Wawra. 237. Kunstauktion, Wien, 6. Dez. 1916, Nr. 87.
In Autotypie abgeb.
S. 628, Nachtrag zu Nr. 275 auf S. 447: Steirischer
Bauernbursch e.
Dorotheum, 272. Kumtauktion, Wien, 28. März 1917. Nr. 1259.
S. 628. Nachtrag zu Nr. 1004 auf S. 478 italienisch erSchuster.
Dorotheum, 272. Kunstauktion, Wien, 28. März 1917, Nr. 1243.
S. 629, Nachtrag za Nr. 1678, auf S. 511: Pferd.
Dorotheum, 272. Kunstauktion, Wien, 28. März 1917, Nr. 1232.
III. ENTGEGNUNG.
Unter den Rezensionen, die meinem Buch bisher gewidmet
wurden, kann ich eine alles in allem recht abfallige wegen ihres Autors,
Hans Tletzes, und wegen des Blattes, in dem sie erschienen ist, der
Kunstchronik (vom 16. März 1917), um so weniger unwidersprochen
lassen, als sie Anlaß zu prinzipiellen Erörterungen gibt.
Unter den vielen Einwänden und Vorwürfen, die Tietze gegen
mein Buch erhebt, scheint mir der, daß es dem Leser nahezu völlig
schuldig bleibe, wie Pettenkofen die bereits als Keime in ihm steckenden
Probleme und Aufgaben entwickelt und erweitert, wie das Persönliche
seines Stiles entsteht und was überhaupt, soweit es über das Technische
hinausgeht, seine künstlerische Eigentümlichkeit bildet, der gewichtigste
zu sein. Inwieweit dieser Tadel berechtigt ist, soll hier jedoch nicht
näher untersucht werden. Daß er etwas übers Ziel hinausschießt, geht
schon aus der Einschränkung hervor, die Tietze bezüglich des Technischen
selber machen muß. Ich verstärke sie sofort durch zwei weitere, wie
mich dünkt, nicht ganz unerhebliche, die eine hinsichtlich des Stoff-
lichen, die andere hinsichtlich des Stiles. Ich habe die allmähliche Erwei-
terung und Umwandlung von Pettenknfens Stoffkreis ebenso sorgfältig
verfolgt und verzeichnet, wie ich ausdrücklich darauf aufmerksam ge-
macht habe, daß Pettenkofen von der gemalten Anekdote zum Zustands-
büd und — wobei ich Worte Alois Riegls gebrauchte — vom Stil der
Nahsichtigkeit zu dem der Fernsichtigkeit fortgeschritten ist. Aber nicht
damit möchte ich mich hier beschäftigen, sondern mit dem, was Tietze,
hier wie übrigens in allem, was er vorbringt, ausschließlich auf dem von
mir beigebrachten Material fußend, darauf folgen läßt und womit er
augenscheinlich zu zeigen unternimmt, wie seiner Meinung nach die
Sache ungefähr hatte gemacht werden müssen. Er zieht da einen Ver-
gleich Pettenkofens mit Alexander von Villers — dem »Unbekannten«,
dessen mir seit vielen Jahren wohlbekannte und liebe Briefe ich, nebenbei
bemerkt, der Gräfin Näkö wegen in meinem Buch zitiere — und leitet
diesen Vergleich durch Pettenkofens Ausspruch: »Ich war immer ein
Dichter« ein. Diesen Satz, bei dem ich im Buche anmerke, daß er außer
allem Zusammenhang so gut wie unverständlich sei, weil sich daraus
wohl allerlei vermuten, aber nichts Sicheres erschließen laßt, beeilt er
sich dahin zu deuten, daß Pettenkofen, was er sah, zur Poesie wurde.
Das ist eine recht vielsagende oder auch — wie man's auffaßt — eine
recht nichtssagende Erklärung. Klüger wird man durch diese Paraphrase
jedenfalls nicht. Tietze nimmt aber zur Deutung des Satzes vom Dichter
auch einen anderen Ausspruch Pettenkofens zu Hilfe: »Jedes BHd muß
etwas Zuckendes haben«. Das heißt nach Tietze, daß die Natur, die
Pettenkofen malte, immer ein Stück seines Ich, »un etat de son äme«
sein mußte. Diese Auslegung beruht aber auf einem offensichtlichen Miß-
verständnis, denn die obigen Worte Pettenkofens sind mir als eine
andere Fassung des von Tietze gleichfalls, doch in anderem Zusammen-
hang zitierten Satzes: »Der Fleiß ist beim Malen die Hauptsache, aber
es muß dabei ein Moment kommen, in dem der Künstler den Fleiß tnt-
schlägt« überliefert worden, und als Parallelstellen habe ich die beiden
Äußerungen auch unmittelbar nebeneinander abgedruckt.
Wenn sich Pettenkofen einen Dichter nannte, so wollte er viel-
leicht damit sagen, daß er die Themen von vielen seiner Bilder erdichtete:
die alte Hehlerin, die in ihrer mit Schätzen gefüllten Truhe herumkramt;
das Rokoko-Liebespaar, das sich am GartenpfÖrtchen ein Stelldichein
gegeben hat; die Stallknechte, die bei den Pferden ihrer Herren in der Au
den Ausgang des Zweikampfes abwarten. Oder er wollte damit sagen,
daß er sich nie mit einer farbigen Photographie nach der Natur begnügte,
daß er stets die Natur ftmdichtete, etwas in sie hineindichtete. Ein Beispiel
für das, was ich meine, ist das Hündchen auf dem Lobmeyr-Bilde, das
einen Innenraum aus dem alten Hause in Toblach darstellt. Man verdecke
sich nur einmal das weiße, an der Tür gespannt horchende Tierchen und
man wnd sofort merken, um wieviel das Bild nicht nur kolloristisch,
sondern auch gegenständlich ärmer geworden ist.
Das sind zwei von den Erklärungen, die ich für Pettenkofens
Aussprach: »Ich war immer ein Dichter« geben konnte (wohlverstanden:
in meinem Buch aus den bereits dargelegten Gründen nicht gegeben
habe), Erklärungen, die zwar wesentlich unorigineller und unmoderner
als die von Tietze vorgeschlagene sind, mir aber, wenn ich mein
historisches Gewissen erforsche, für den vor einem Menschenalter als
Greis verstorbenen Pettenkofen immerhin plausibler erscheinen als die
von Tietze gegebene.
Aber nun nach dieser kurzen Abschweifung wieder zurück zu
Tietzes Vergleich von Pettenkofen und Villers. Er nennt Pettenkofen einen
Alt-Wiener, der seine Periode versäumt hat, und einen am Konflikt von
Alt und Modern Erkrankten (beides läßt sich natürlich ebensogut ver-
teidigen wie bestreiten, beides ist ebenso wahr wie falsch) und führt aus,
daß es Pettenkofen, hätte er sich von seinem Freunde Leopold Karl Müller
überreden lassen, mit ihm nach Ägypten zu reisen, dort ebenso wie
Villers in Florenz vor den Mediceergräbern ergangen wäre. Gleich diesem
hätte er dann ausrufen können: »Was ich davon hatte, habe ich nun
verloren, und was ich jetzt habe, kann ich nicht braueben.« Dieser Ver-
gleich ist vor allem auf Tietzes Behauptung aufgebaut, daß schon Neapel
Pettenkofen nicht mehr gegeben habe als die Dörfer der Puszta. Ich bin
nun gar nicht dieser Meinung, sondern glaube vielmehr, daß die neapoli-