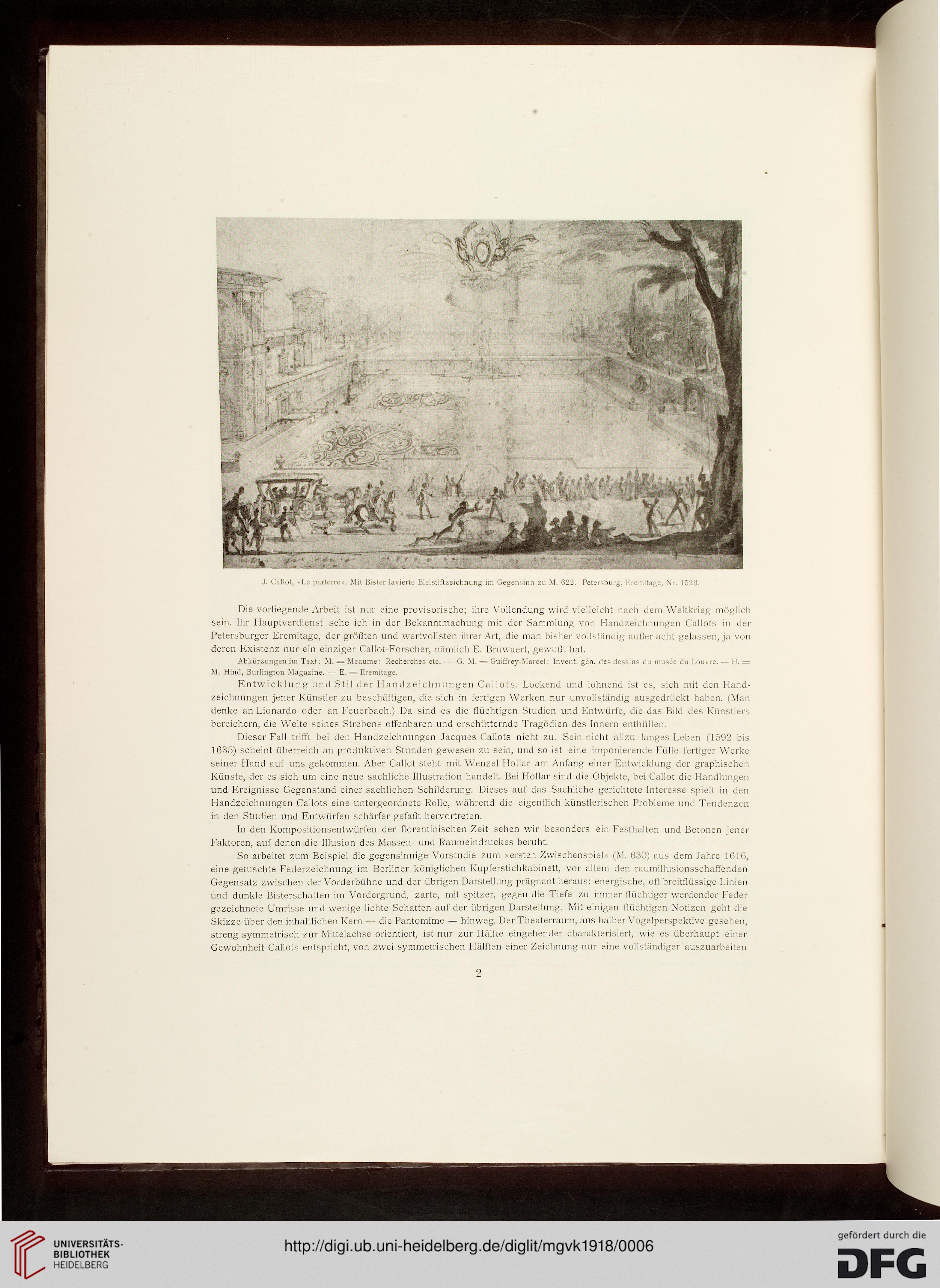#l§-.t^
I. Callot, Leparterre . Mit Bister lavierte Bleistifl eiefmtmg im Gegensinn z \I 622 Petersburg, Eremitage, Nr. 1528
Die vorliegende Arbeit ist nur eine provisorische; ihre Vollendung wird vielleicht nach dem Weltkrieg möglich
sein. Ihr Hauptverdienst sehe ich in der Bekanntmachung mit der Sammlung von Handzeichnungen Callots in der
Petersburger Eremitage, der größten und wertvollsten ihrer Art, die man bisher vollständig außer acht gelassen, ja von
deren Existenz nur ein einziger Callot-Forscher, nämlich E. Bruwaert, gewußt hat.
Abkürzungen im Text: M. = Meaume: Recherches etc. — G. M. = Guiffrey-Marcel: Invent. gen. des dessins du mustie du Louvre. — H. —
M. Hind, Burlington Magazine. — E. = Eremitage.
Entwicklung und Stil der Handzeichnungen Callots. Lockend und lohnend ist es, sich mit den Hand-
zeichnungen jener Künstler zu beschäftigen, die sich in fertigen Werken nur unvollständig ausgedrückt haben. (Man
denke an Lionardo oder an Feuerbach.) Da sind es die flüchtigen Studien und Entwürfe, die das Bild des Künstlers
bereichem, die Weite seines Strebens offenbaren und erschütternde Tragödien des Innern enthüllen.
Dieser Fall trifft bei den Handzeichnungen Jacques Callots nicht zu. Sein nicht allzu langes Leben (1592 bis
1635) scheint überreich an produktiven Stunden gewesen zu sein, und so ist eine imponierende Fülle fertiger Werke
seiner Hand auf uns gekommen. Aber Callot steht mit Wenzel Hollar am Anfang einer Entwicklung der graphischen
Künste, der es sich um eine neue sachliche Illustration handelt. Bei Hollar sind die Objekte, bei Callot die Handlungen
und Ereignisse Gegenstand einer sachlichen Schilderung. Dieses auf das Sachliche gerichtete Interesse spielt in den
Handzeichnungen Callots eine untergeordnete Rolle, während die eigentlich künstlerischen Probleme und Tendenzen
in den Studien und Entwürfen schärfer gefaßt hervortreten.
In den Kompositionsentwürfen der florentinischen Zeit sehen wir besonders ein Festhalten und Betonen jener
Faktoren, auf denen die Illusion des Massen- und Raumeindruckes beruht.
So arbeitet zum Beispiel die gegensinnige Vorstudie zum »ersten Zwischenspiel« (M. 630) aus dem Jahre 1616,
eine getuschte Federzeichnung im Berliner königlichen Kupferstichkabinett, vor allem den raumillusionsschaffenden
Gegensatz zwischen der Vorderbühne und der übrigen Darstellung prägnant heraus: energische, oft breitflüssige Linien
und dunkle Bisterschatten im Vordergrund, zarte, mit spitzer, gegen die Tiefe zu immer flüchtiger werdender Feder
gezeichnete Umrisse und wenige lichte Schatten auf der übrigen Darstellung. Mit einigen flüchtigen Notizen geht die
Skizze über den inhaltlichen Kern — die Pantomime — hinweg. Der Theaterraum, aus halber Vogelperspektive gesehen,
streng symmetrisch zur Mittelachse orientiert, ist nur zur Hälfte eingehender charakterisiert, wie es überhaupt einer
Gewohnheit Callots entspricht, von zwei symmetrischen Hälften einer Zeichnung nur eine vollständiger auszuarbeiten
I. Callot, Leparterre . Mit Bister lavierte Bleistifl eiefmtmg im Gegensinn z \I 622 Petersburg, Eremitage, Nr. 1528
Die vorliegende Arbeit ist nur eine provisorische; ihre Vollendung wird vielleicht nach dem Weltkrieg möglich
sein. Ihr Hauptverdienst sehe ich in der Bekanntmachung mit der Sammlung von Handzeichnungen Callots in der
Petersburger Eremitage, der größten und wertvollsten ihrer Art, die man bisher vollständig außer acht gelassen, ja von
deren Existenz nur ein einziger Callot-Forscher, nämlich E. Bruwaert, gewußt hat.
Abkürzungen im Text: M. = Meaume: Recherches etc. — G. M. = Guiffrey-Marcel: Invent. gen. des dessins du mustie du Louvre. — H. —
M. Hind, Burlington Magazine. — E. = Eremitage.
Entwicklung und Stil der Handzeichnungen Callots. Lockend und lohnend ist es, sich mit den Hand-
zeichnungen jener Künstler zu beschäftigen, die sich in fertigen Werken nur unvollständig ausgedrückt haben. (Man
denke an Lionardo oder an Feuerbach.) Da sind es die flüchtigen Studien und Entwürfe, die das Bild des Künstlers
bereichem, die Weite seines Strebens offenbaren und erschütternde Tragödien des Innern enthüllen.
Dieser Fall trifft bei den Handzeichnungen Jacques Callots nicht zu. Sein nicht allzu langes Leben (1592 bis
1635) scheint überreich an produktiven Stunden gewesen zu sein, und so ist eine imponierende Fülle fertiger Werke
seiner Hand auf uns gekommen. Aber Callot steht mit Wenzel Hollar am Anfang einer Entwicklung der graphischen
Künste, der es sich um eine neue sachliche Illustration handelt. Bei Hollar sind die Objekte, bei Callot die Handlungen
und Ereignisse Gegenstand einer sachlichen Schilderung. Dieses auf das Sachliche gerichtete Interesse spielt in den
Handzeichnungen Callots eine untergeordnete Rolle, während die eigentlich künstlerischen Probleme und Tendenzen
in den Studien und Entwürfen schärfer gefaßt hervortreten.
In den Kompositionsentwürfen der florentinischen Zeit sehen wir besonders ein Festhalten und Betonen jener
Faktoren, auf denen die Illusion des Massen- und Raumeindruckes beruht.
So arbeitet zum Beispiel die gegensinnige Vorstudie zum »ersten Zwischenspiel« (M. 630) aus dem Jahre 1616,
eine getuschte Federzeichnung im Berliner königlichen Kupferstichkabinett, vor allem den raumillusionsschaffenden
Gegensatz zwischen der Vorderbühne und der übrigen Darstellung prägnant heraus: energische, oft breitflüssige Linien
und dunkle Bisterschatten im Vordergrund, zarte, mit spitzer, gegen die Tiefe zu immer flüchtiger werdender Feder
gezeichnete Umrisse und wenige lichte Schatten auf der übrigen Darstellung. Mit einigen flüchtigen Notizen geht die
Skizze über den inhaltlichen Kern — die Pantomime — hinweg. Der Theaterraum, aus halber Vogelperspektive gesehen,
streng symmetrisch zur Mittelachse orientiert, ist nur zur Hälfte eingehender charakterisiert, wie es überhaupt einer
Gewohnheit Callots entspricht, von zwei symmetrischen Hälften einer Zeichnung nur eine vollständiger auszuarbeiten