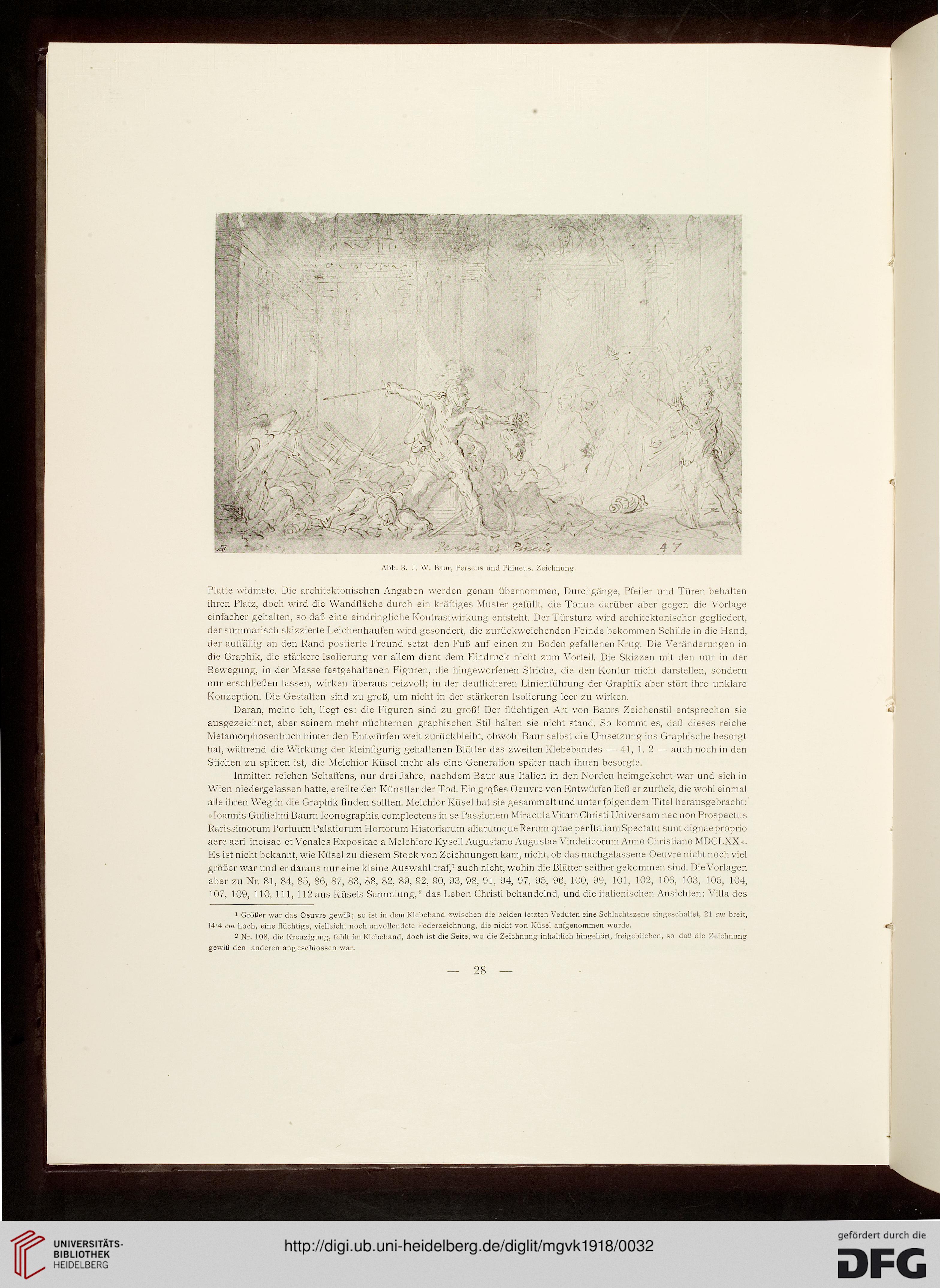hl Z -
-f--: ■ -
«**nr
Abb. 3. J. W. Baur, Perseus und Phineus. Zeichnung.
Platte widmete. Die architektonischen Angaben werden genau übernommen, Durchgänge, Pfeiler und Türen behalten
ihren Platz, doch wird die Wandfläche durch ein kräftiges Muster gefüllt, die Tonne darüber aber gegen die Vorlage
einfacher gehalten, so daß eine eindringliche Kontrastwirkung entsteht. Der Türsturz wird architektonischer gegliedert,
der summarisch skizzierte Leichenhaufen wird gesondert, die zurückweichenden Feinde bekommen Schilde in die Hand,
der auffällig an den Rand postierte Freund setzt den Fuß auf einen zu Boden gefallenen Krug. Die Veränderungen in
die Graphik, die stärkere Isolierung vor allem dient dem Eindruck nicht zum Vorteil. Die Skizzen mit den nur in der
Bewegung, in der Masse festgehaltenen Figuren, die hingeworfenen Striche, die den Kontur nicht darstellen, sondern
nur erschließen lassen, wirken überaus reizvoll; in der deutlicheren Linienführung der Graphik aber stört ihre unklare
Konzeption. Die Gestalten sind zu groß, um nicht in der stärkeren Isolierung leer zu wirken.
Daran, meine ich, liegt es: die Figuren sind zu groß! Der flüchtigen Art von Baurs Zeichenstil entsprechen sie
ausgezeichnet, aber seinem mehr nüchternen graphischen Stil halten sie nicht stand. So kommt es, daß dieses reiche
Metamorphosenbuch hinter den Entwürfen weit zurückbleibt, obwohl Baur selbst die Umsetzung ins Graphische besorgt
hat, während die Wirkung der kleinfigurig gehaltenen Blätter des zweiten Klebebandes — 41,1.2 — auch noch in den
Stichen zu spüren ist, die Melchior Küsel mehr als eine Generation später nach ihnen besorgte.
Inmitten reichen Schaffens, nur drei Jahre, nachdem Baur aus Italien in den Norden heimgekehrt war und sich in
Wien niedergelassen hatte, ereilte den Künstler der Tod. Ein großes Oeuvre von Entwürfen ließ er zurück, die wohl einmal
alle ihren Weg in die Graphik finden sollten. Melchior Küsel hat sie gesammelt und unter folgendem Titel herausgebracht:'
»Ioannis Guilielmi Baum Iconographia complectens in se Passionem MiraculaVitamChristi Universam nee non Prospectus
Rarissimorum Portuum Palatiorum Hortorum Historiarum aliarumqueRerum quae perltaliamSpectatu sunt dignaeproprio
aere aeri incisae et Venales Expositae a MelchioreKysell Augustano Augustae VindelicorumAnno Christiano MDCLXX*.
Es ist nicht bekannt, wie Küsel zu diesem Stock von Zeichnungen kam, nicht, ob das nachgelassene Oeuvre nicht noch viel
größer war und er daraus nur eine kleine Auswahl traf,1 auch nicht, wohin die Blätter seither gekommen sind. Die Vorlagen
aber zu Nr. 81, 84, 85, 86, 87, 83, 88, 82, 89, 92, 90, 93, 98, 91, 94, 97, 95, 96, 100, 99, 101, 102, 106, 103, 105, 104,
107, 109, 110, 111, 112 aus Küsels Sammlung,2 das Leben Christi behandelnd, und die italienischen Ansichten: Villa des
i Größer war das Oeuvre gewiß; so ist in dem Klebeband zwischen die beiden letzten Veduten eine Schlachtszene eingeschaltet, 21 cm breit,
144 cm hoch, eine flüchtige, vielleicht noch unvollendete Federzeichnung, die nicht von Küsel aufgenommen wurde.
2 Nr. 108, die Kreuzigung, fehlt im Klebeband, doch ist die Seite, wo die Zeichnung inhaltlich hingehört, freigebiieben, so daß die Zeichnung
gewiß den anderen angeschlossen war.
28
-f--: ■ -
«**nr
Abb. 3. J. W. Baur, Perseus und Phineus. Zeichnung.
Platte widmete. Die architektonischen Angaben werden genau übernommen, Durchgänge, Pfeiler und Türen behalten
ihren Platz, doch wird die Wandfläche durch ein kräftiges Muster gefüllt, die Tonne darüber aber gegen die Vorlage
einfacher gehalten, so daß eine eindringliche Kontrastwirkung entsteht. Der Türsturz wird architektonischer gegliedert,
der summarisch skizzierte Leichenhaufen wird gesondert, die zurückweichenden Feinde bekommen Schilde in die Hand,
der auffällig an den Rand postierte Freund setzt den Fuß auf einen zu Boden gefallenen Krug. Die Veränderungen in
die Graphik, die stärkere Isolierung vor allem dient dem Eindruck nicht zum Vorteil. Die Skizzen mit den nur in der
Bewegung, in der Masse festgehaltenen Figuren, die hingeworfenen Striche, die den Kontur nicht darstellen, sondern
nur erschließen lassen, wirken überaus reizvoll; in der deutlicheren Linienführung der Graphik aber stört ihre unklare
Konzeption. Die Gestalten sind zu groß, um nicht in der stärkeren Isolierung leer zu wirken.
Daran, meine ich, liegt es: die Figuren sind zu groß! Der flüchtigen Art von Baurs Zeichenstil entsprechen sie
ausgezeichnet, aber seinem mehr nüchternen graphischen Stil halten sie nicht stand. So kommt es, daß dieses reiche
Metamorphosenbuch hinter den Entwürfen weit zurückbleibt, obwohl Baur selbst die Umsetzung ins Graphische besorgt
hat, während die Wirkung der kleinfigurig gehaltenen Blätter des zweiten Klebebandes — 41,1.2 — auch noch in den
Stichen zu spüren ist, die Melchior Küsel mehr als eine Generation später nach ihnen besorgte.
Inmitten reichen Schaffens, nur drei Jahre, nachdem Baur aus Italien in den Norden heimgekehrt war und sich in
Wien niedergelassen hatte, ereilte den Künstler der Tod. Ein großes Oeuvre von Entwürfen ließ er zurück, die wohl einmal
alle ihren Weg in die Graphik finden sollten. Melchior Küsel hat sie gesammelt und unter folgendem Titel herausgebracht:'
»Ioannis Guilielmi Baum Iconographia complectens in se Passionem MiraculaVitamChristi Universam nee non Prospectus
Rarissimorum Portuum Palatiorum Hortorum Historiarum aliarumqueRerum quae perltaliamSpectatu sunt dignaeproprio
aere aeri incisae et Venales Expositae a MelchioreKysell Augustano Augustae VindelicorumAnno Christiano MDCLXX*.
Es ist nicht bekannt, wie Küsel zu diesem Stock von Zeichnungen kam, nicht, ob das nachgelassene Oeuvre nicht noch viel
größer war und er daraus nur eine kleine Auswahl traf,1 auch nicht, wohin die Blätter seither gekommen sind. Die Vorlagen
aber zu Nr. 81, 84, 85, 86, 87, 83, 88, 82, 89, 92, 90, 93, 98, 91, 94, 97, 95, 96, 100, 99, 101, 102, 106, 103, 105, 104,
107, 109, 110, 111, 112 aus Küsels Sammlung,2 das Leben Christi behandelnd, und die italienischen Ansichten: Villa des
i Größer war das Oeuvre gewiß; so ist in dem Klebeband zwischen die beiden letzten Veduten eine Schlachtszene eingeschaltet, 21 cm breit,
144 cm hoch, eine flüchtige, vielleicht noch unvollendete Federzeichnung, die nicht von Küsel aufgenommen wurde.
2 Nr. 108, die Kreuzigung, fehlt im Klebeband, doch ist die Seite, wo die Zeichnung inhaltlich hingehört, freigebiieben, so daß die Zeichnung
gewiß den anderen angeschlossen war.
28