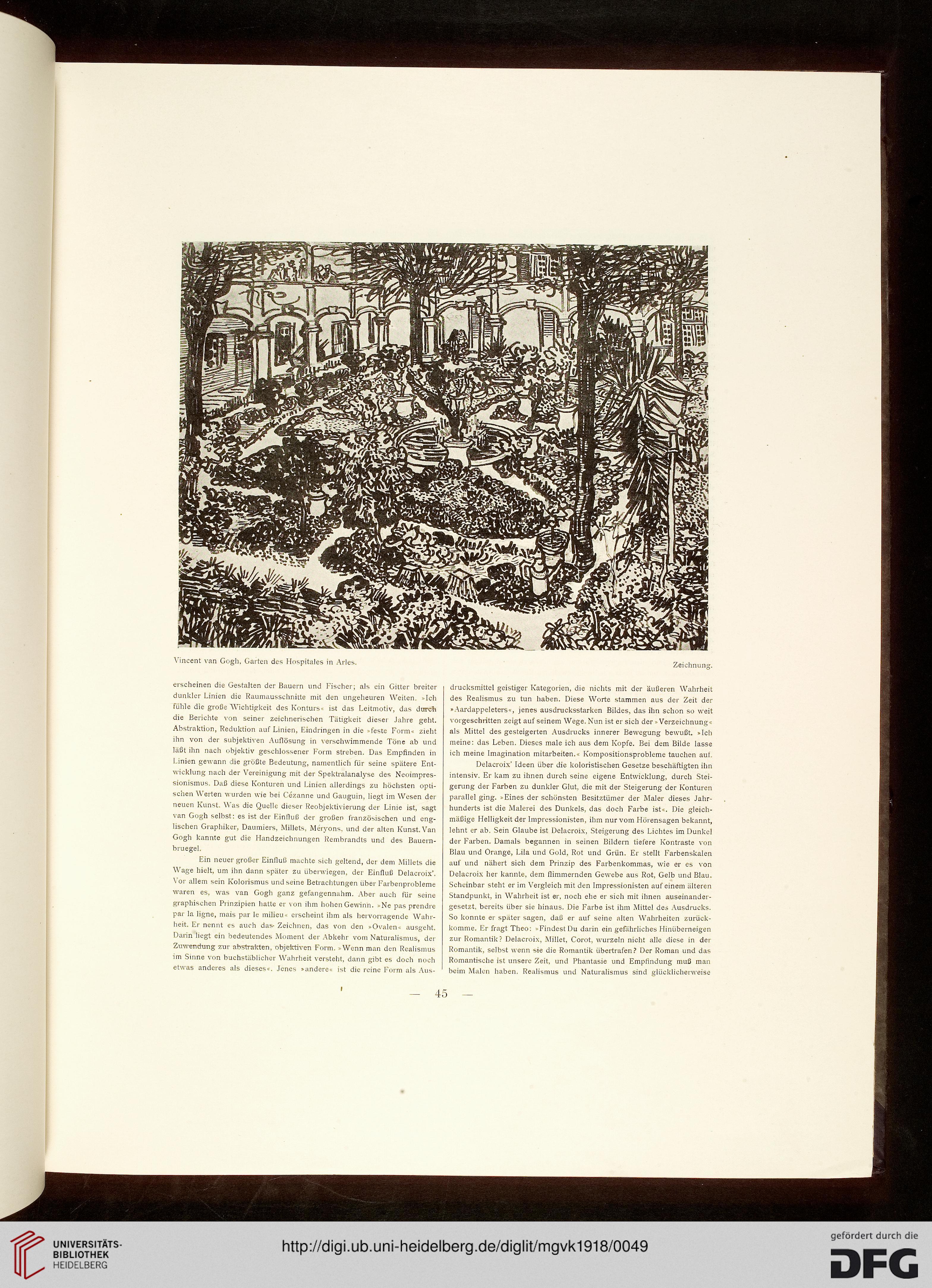Vincent van Gogh, Garten des Hospitales in Arles.
erscheinen die Gestalten der Bauern und Fischer; als ein Gitter breiter
dunkler Linien die Raumausschnitte mit den ungeheuren Weiten. »Ich
fühle die große Wichtigkeit des Konturs« ist das Leitmotiv, das durch
die Berichte von seiner zeichnerischen Tätigkeit dieser Jahre geht.
Abstraktion, Reduktion auf Linien, Eindringen in die «feste Form« zieht
ihn von der subjektiven Auflösung in verschwimmende Töne ab und
laßt ihn nach objektiv geschlossener Form streben. Das Empfinden in
Linien gewann die größte Bedeutung, namentlich für seine spätere Ent-
wicklung nach der Vereinigung mit der Spektralanalyse des Neoimpres-
sionismus. Daß diese Konturen und Linien allerdings zu höchsten opti-
schen Werten wurden wie bei Cezanne und Gauguin, liegt im Wesen der
neuen Kunst. Was die Quelle dieser Reobjektivierung der Linie ist, sagt
van Gogh selbst: es ist der Einfluß der großen französischen und eng-
lischen Graphiker, Daumiers, Millets, Meryons, und der alten Kunst. Van
Gogh kannte gut die Handzeichnungen Rembrandts und des Bauern-
bruegel.
Ein neuer großer Einfluß machte sich geltend, der dem Millets die
Wage hielt, um ihn dann später zu überwiegen, der Einfluß Delacroix'.
Vor allem sein Kolonsmus und seine Betrachtungen über Farbenprobleme
waren es, was van Gogh ganz gefangennahm. Aber auch für seine
graphischen Prinzipien hatte er von ihm hohen Gewinn. »Ne pas prendre
par la ligne, mais par le milieu« erscheint ihm als hervorragende Wahr-
heit. Er nennt es auch das- Zeichnen, das von den »Ovalen« ausgeht.
Darin liegt ein bedeutendes Moment der Abkehr vom Naturalismus, der
Zuwendung zur abstrakten, objektiven Form. »Wenn man den Realismus
im Sinne von buchstäblicher Wahrheit versteht, dann gibt es doch noch
etwas anderes als dieses«. Jenes »andere« ist die reine Form als Aus-
drucksmittel geistiger Kategorien, die nichts mit der äußeren Wahrheit
des Realismus zu tun haben. Diese Worte stammen aus der Zeit der
»Aardappeleters*, jenes ausdrucksstarken Bildes, das ihn schon so weit
vorgeschritten zeigt auf seinem Wege. Nun ist er sich der »Verzeichnung«
als Mittel des gesteigerten Ausdrucks innerer Bewegung bewußt. »Ich
meine: das Leben. Dieses male ich aus dem Kopfe. Bei dem Bilde lasse
ich meine Imagination mitarbeiten.«': Kompositionsproblcme tauchen auf
Delacroix' Ideen über die koloristischen Gesetze beschäftigten ihn
intensiv. Er kam zu ihnen durch seine eigene Entwicklung, durch Stei-
gerung der Farben zu dunkler Glut, die mit der Steigerung der Konturen
parallel ging. »Eines der schönsten Besitztümer der Maler dieses Jahr-
hunderts ist die Malerei des Dunkels, das doch Farbe ist«. Die gleich-
mäßige Helligkeit der Impressionisten, ihm nur vom Hörensagen bekannt,
lehnt er ab. Sein Glaubeist Delacroix, Steigerung des Lichtes im Dunkel
der Farben. Damals begannen in seinen Bildern tiefere Kontraste von
Blau und Orange, Lila und Gold, Rot und Grün. Er stellt Farbenskalen
auf und nähert sich dem Prinzip des Farbenkommas, wie er es von
Delacroix her kannte, dem flimmernden Gewebe aus Rot, Gelb und Blau.
Scheinbar steht er im Vergleich mit den Impressionisten auf einem älteren
Standpunkt, in Wahrheit ist er, noch ehe er sich mit ihnen auseinander-
gesetzt, bereits über sie hinaus. Die Farbe ist ihm Mittel des Ausdrucks.
So konnte er später sagen, daß er auf seine alten Wahrheiten zurück-
komme. Er fragt Theo: »Findest Du darin ein gefährliches Hinüberneigen
zur Romantik? Delacroix, Millet, Corot, wurzeln nicht alle diese in dei
Romantik, selbst wenn sie die Romantik übertrafen? Der Roman und da?
Romantische ist unsere Zeit, und Phantasie und Empfindung muß man
beim Malen haben. Realismus und Naturalismus sind glücklicherweise
— 45
erscheinen die Gestalten der Bauern und Fischer; als ein Gitter breiter
dunkler Linien die Raumausschnitte mit den ungeheuren Weiten. »Ich
fühle die große Wichtigkeit des Konturs« ist das Leitmotiv, das durch
die Berichte von seiner zeichnerischen Tätigkeit dieser Jahre geht.
Abstraktion, Reduktion auf Linien, Eindringen in die «feste Form« zieht
ihn von der subjektiven Auflösung in verschwimmende Töne ab und
laßt ihn nach objektiv geschlossener Form streben. Das Empfinden in
Linien gewann die größte Bedeutung, namentlich für seine spätere Ent-
wicklung nach der Vereinigung mit der Spektralanalyse des Neoimpres-
sionismus. Daß diese Konturen und Linien allerdings zu höchsten opti-
schen Werten wurden wie bei Cezanne und Gauguin, liegt im Wesen der
neuen Kunst. Was die Quelle dieser Reobjektivierung der Linie ist, sagt
van Gogh selbst: es ist der Einfluß der großen französischen und eng-
lischen Graphiker, Daumiers, Millets, Meryons, und der alten Kunst. Van
Gogh kannte gut die Handzeichnungen Rembrandts und des Bauern-
bruegel.
Ein neuer großer Einfluß machte sich geltend, der dem Millets die
Wage hielt, um ihn dann später zu überwiegen, der Einfluß Delacroix'.
Vor allem sein Kolonsmus und seine Betrachtungen über Farbenprobleme
waren es, was van Gogh ganz gefangennahm. Aber auch für seine
graphischen Prinzipien hatte er von ihm hohen Gewinn. »Ne pas prendre
par la ligne, mais par le milieu« erscheint ihm als hervorragende Wahr-
heit. Er nennt es auch das- Zeichnen, das von den »Ovalen« ausgeht.
Darin liegt ein bedeutendes Moment der Abkehr vom Naturalismus, der
Zuwendung zur abstrakten, objektiven Form. »Wenn man den Realismus
im Sinne von buchstäblicher Wahrheit versteht, dann gibt es doch noch
etwas anderes als dieses«. Jenes »andere« ist die reine Form als Aus-
drucksmittel geistiger Kategorien, die nichts mit der äußeren Wahrheit
des Realismus zu tun haben. Diese Worte stammen aus der Zeit der
»Aardappeleters*, jenes ausdrucksstarken Bildes, das ihn schon so weit
vorgeschritten zeigt auf seinem Wege. Nun ist er sich der »Verzeichnung«
als Mittel des gesteigerten Ausdrucks innerer Bewegung bewußt. »Ich
meine: das Leben. Dieses male ich aus dem Kopfe. Bei dem Bilde lasse
ich meine Imagination mitarbeiten.«': Kompositionsproblcme tauchen auf
Delacroix' Ideen über die koloristischen Gesetze beschäftigten ihn
intensiv. Er kam zu ihnen durch seine eigene Entwicklung, durch Stei-
gerung der Farben zu dunkler Glut, die mit der Steigerung der Konturen
parallel ging. »Eines der schönsten Besitztümer der Maler dieses Jahr-
hunderts ist die Malerei des Dunkels, das doch Farbe ist«. Die gleich-
mäßige Helligkeit der Impressionisten, ihm nur vom Hörensagen bekannt,
lehnt er ab. Sein Glaubeist Delacroix, Steigerung des Lichtes im Dunkel
der Farben. Damals begannen in seinen Bildern tiefere Kontraste von
Blau und Orange, Lila und Gold, Rot und Grün. Er stellt Farbenskalen
auf und nähert sich dem Prinzip des Farbenkommas, wie er es von
Delacroix her kannte, dem flimmernden Gewebe aus Rot, Gelb und Blau.
Scheinbar steht er im Vergleich mit den Impressionisten auf einem älteren
Standpunkt, in Wahrheit ist er, noch ehe er sich mit ihnen auseinander-
gesetzt, bereits über sie hinaus. Die Farbe ist ihm Mittel des Ausdrucks.
So konnte er später sagen, daß er auf seine alten Wahrheiten zurück-
komme. Er fragt Theo: »Findest Du darin ein gefährliches Hinüberneigen
zur Romantik? Delacroix, Millet, Corot, wurzeln nicht alle diese in dei
Romantik, selbst wenn sie die Romantik übertrafen? Der Roman und da?
Romantische ist unsere Zeit, und Phantasie und Empfindung muß man
beim Malen haben. Realismus und Naturalismus sind glücklicherweise
— 45