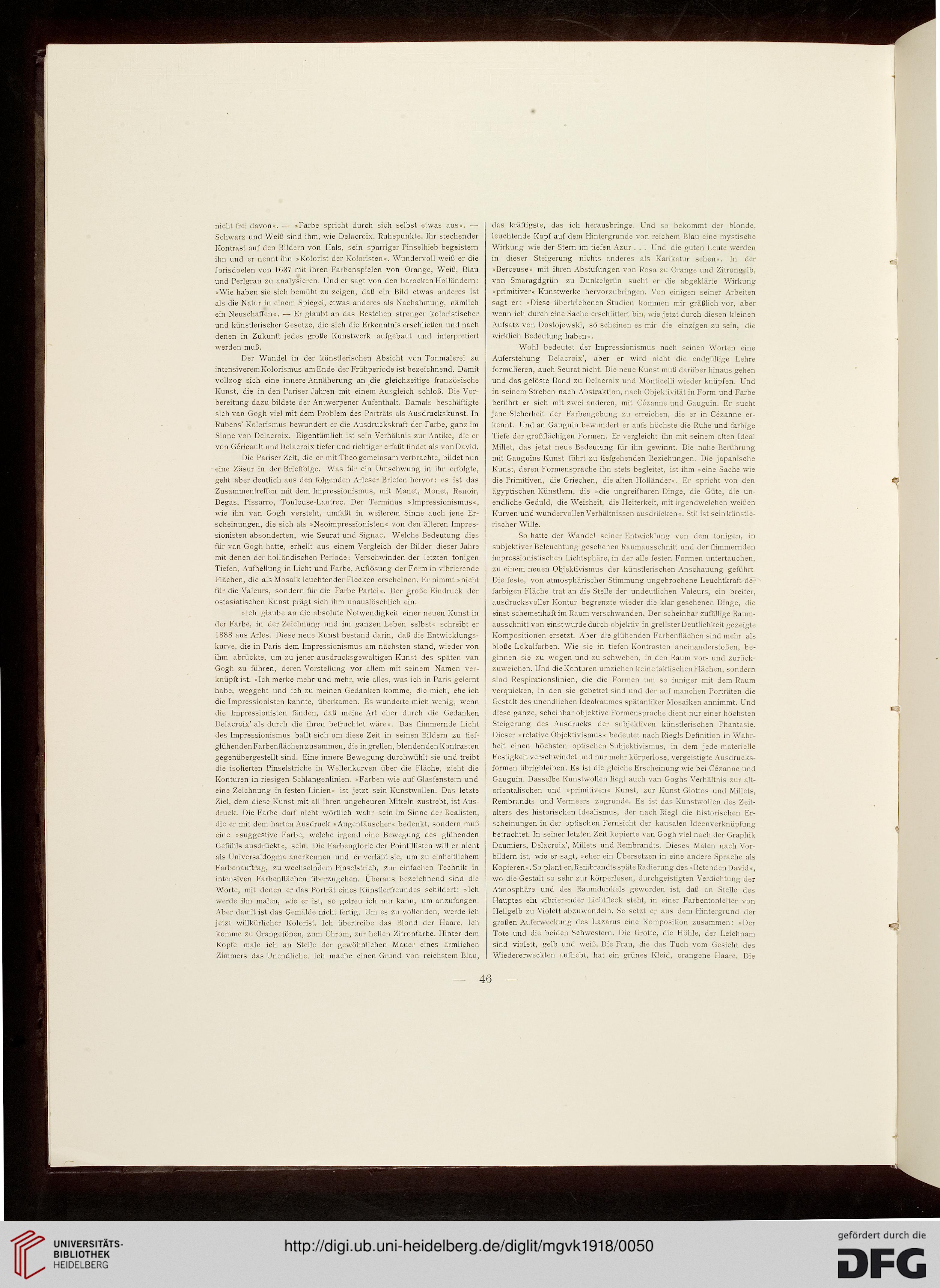nicht frei davon«. — »Farbe spricht durch sich selbst etwas aus«. —
Schwarz und Weiß sind ihm, wie Delacroix, Ruhepunkte. Ihr stechender
Kontrast auf den Bildern von Hals, sein sparriger Pinselhieb begeistern
ihn und er nennt ihn »Kolorist der Koloristen«. Wundervoll weiß er die
Jorisdoelen von 1637 mit ihren Farbenspielen von Orange, Weiß, Blau
und Perlgrau zu analj'sieren. Und er sagt von den barocken Holländern:
»Wie haben sie sich bemüht zu zeigen, daß ein Bild etwas anderes ist
als die Natur in einem Spiegel, etwas anderes als Nachahmung, nämlich
ein Neuschaffen«. — Er glaubt an das Bestehen strenger koloristischer
und künstlerischer Gesetze, die sich die Erkenntnis erschließen und nach
denen in Zukunft jedes große Kunstwerk aufgebaut und interpretiert
werden muß.
Der Wandel in der künstlerischen Absicht von Tonmalerei zu
intensiverem Kolorismus am Ende der Frühperiode ist bezeichnend. Damit
vollzog sich eine innere Annäherung an die gleichzeitige französische
Kunst, die in den Pariser Jahren mit einem Ausgleich schloß. Die Vor-
bereitung dazu bildete der Antwerpener Aufenthalt. Damals beschäftigte
sich van Gogh viel mit dem Problem des Porträts als Ausdruckskunst. In
Rubens' Kolorismus bewundert er die Ausdruckskraft der Farbe, ganz im
Sinne von Delacroix. Eigentümlich ist sein Verhältnis zur Antike, die er
von Gericault undDelacroix tiefer und richtiger erfaßt findet als von David.
Die Pariser Zeit, die er mit Theogemeinsam verbrachte, bildet nun
eine Zäsur in der Brieffolge. Was für ein Umschwung in ihr erfolgte,
geht aber deutlich aus den folgenden Arleser Briefen hervor: es ist das
Zusammentreffen mit dem Impressionismus, mit Manet, Monet, Renoir,
Degas, Pissarro, Toulouse-Lautrec. Der Terminus »Impressionismus«,
wie ihn van Gogh versteht, umfaßt in weiterem Sinne auch jene Er-
scheinungen, die sich als »Neoimpressionisten« von den älteren Impres-
sionisten absonderten, wie Seurat und Signac. Welche Bedeutung dies
für van Gogh hatte, erhellt aus einem Vergleich der Bilder dieser Jahre
mit denen der holländischen Periode: Verschwinden der letzten tonigen
Tiefen, Aufhellung in Licht und Farbe, Auflösung der Form in vibrierende
Flächen, die als Mosaik leuchtender Flecken erscheinen. Er nimmt »nicht
für die Valeurs, sondern für die Farbe Partei«. Der große Eindruck der
ostasiatischen Kunst prägt sich ihm unauslöschlich ein.
»Ich glaube an die absolute Notwendigkeit einer neuen Kunst in
der Farbe, in der Zeichnung und im ganzen Leben selbst« schreibt er
1888 aus Arles. Diese neue Kunst bestand darin, daß die Entwicklungs-
kurve, die in Paris dem Impressionismus am nächsten stand, wieder von
ihm abrückte, um zu jener ausdrucksgewaltigen Kunst des späten van
Gogh zu führen, deren Vorstellung vor allem mit seinem Namen ver-
knüpft ist. »Ich merke mehr und mehr, wie alles, was ich in Paris gelernt
habe, weggeht und ich zu meinen Gedanken komme, die mich, ehe ich
die Impressionisten kannte, überkamen. Es wunderte mich wenig, wenn
die Impressionisten fänden, daß meine Art eher durch die Gedanken
Delacroix' als durch die ihren befruchtet wäre«. Das flimmernde Licht
des Impressionismus ballt sich um diese Zeit in seinen Bildern zu tief-
glühendenFarbenflachen zusammen, die ingrellen, blendenden Kontrasten
gegenübergestellt sind. Eine innere Bewegung durchwühlt sie und treibt
die isolierten Pinselstriche in Wellenkurven über die Fläche, zieht die
Konturen in riesigen Schlangenlinien. »Farben wie auf Glasfenstern und
eine Zeichnung in festen Linien« ist jetzt sein Kunstwollen. Das letzte
Ziel, dem diese Kunst mit all ihren ungeheuren Mitteln zustrebt, ist Aus-
druck. Die Farbe darf nicht wörtlich wahr sein im Sinne der Realisten,
die er mit dem harten Ausdruck »Augentäuscher« bedenkt, sondern muß
eine »suggestive Farbe, welche irgend eine Bewegung des glühenden
Gefühls ausdrückt«, sein. Die Farbenglorie der Pointillisten will er nicht
als Universaldogma anerkennen und er verläßt sie, um zu einheitlichem
Farbenauftrag, zu wechselndem Pinselstrich, zur einfachen Technik in
intensiven Farbenflächen überzugehen. Überaus bezeichnend sind die
Worte, mit denen er das Porträt eines Künstlerfreundes schildert: »Ich
werde ihn malen, wie er ist, so getreu ich nur kann, um anzufangen.
Aber damit ist das Gemälde nicht fertig. Um es zu vollenden, werde ich
jetzt willkürlicher Kolorist. Ich übertreibe das Blond der Haare. Ich
komme zu Orangetönen, zum Chrom, zur hellen Zitronfarbe. Hinter dem
Kopfe male ich an Stelle der gewöhnlichen Mauer eines ärmlichen
Zimmers das Unendliche. Ich mache einen Grund von reichstem Blau,
das kräftigste, das ich herausbringe. Und so bekommt der blonde,
leuchtende Kopf auf dem Hintergrunde von reichem Blau eine mystische
Wirkung wie der Stern im tiefen Azur . . . Und die guten Leute werden
in dieser Steigerung nichts anderes als Karikatur sehen«. In der
»Berceuse« mit ihren Abstufungen von Rosa zu Orange und Zitrongplb,
von Smaragdgrün zu Dunkelgrün sucht er die abgeklärte Wirkung
»primitiver« Kunstwerke hervorzubringen. Von einigen seiner Arbeiten
sagt er: »Diese übertriebenen Studien kommen mir gräßlich vor, aber
wenn ich durch eine Sache erschüttert bin, wie jetzt durch diesen kleinen
Aufsatz von Dostojewski, so scheinen es mir die einzigen zu sein, die
wirklich Bedeutung haben«.
Wohl bedeutet der Impressionismus nach seinen Worten eine
Auferstehung Delacroix', aber er wird nicht die endgültige Lehre
formulieren, auch Seurat nicht. Die neue Kunst muß darüber hinaus gehen
und das gelöste Band zu Delacroix und Monticelli wieder knüpfen. Und
in seinem Streben nach Abstraktion, nach Objektivität in Form und Farbe
berührt er sich mit zwei anderen, mit Cezanne und Gauguin. Er sucht
jene Sicherheit der Farbengebung zu erreichen, die er in Cezanne er-
kennt. Und an Gauguin bewundert er aufs höchste die Ruhe und farbige
Tiefe der großflächigen Formen. Er vergleicht ihn mit seinem alten Ideal
Millet, das jetzt neue Bedeutung für ihn gewinnt. Die nahe Berührung
mit Gauguins Kunst führt zu tiefgehenden Beziehungen. Die japanische
Kunst, deren Formensprache ihn stets begleitet, ist ihm »eine Sache wie
die Primitiven, die Griechen, die alten Holländer«. Er spricht von den
ägyptischen Künstlern, die »die ungreifbaren Dinge, die Güte, die un-
endliche Geduld, die Weisheit, die Heiterkeit, mit irgendwelchen weißen
Kurven und wundervollen Verhältnissen ausdrücken«. Stil ist sein künstle-
rischer Wille.
So hatte der Wandel seiner Entwicklung von dem tonigen, in
subjektiver Beleuchtung gesehenen Raumausschnitt und der flimmernden
impressionistischen Lichtsphäre, in der alle festen Formen untertauchen,
zu einem neuen Objektivismus der künstlerischen Anschauung geführt.
Die feste, von atmosphärischer Stimmung ungebrochene Leuchtkraft der
farbigen Fläche trat an die Stelle der undeutlichen Valeurs, ein breiter,
ausdrucksvoller Kontur begrenzte wieder die klar gesehenen Dinge, die
einst schemenhaft im Raum verschwanden. Der scheinbar zufällige Raum-
ausschnitt von einst wurde durch objektiv in grellster Deutlichkeit gezeigte
Kompositionen ersetzt. Aber die glühenden Farbenflächen sind mehr als
bloße Lokalfarben. Wie sie in tiefen Kontrasten aneinanderstoßen, be-
ginnen sie zu wogen und zu schweben, in den Raum vor- und zurück-
zuweichen. Und dieKonturen umziehen keine taktischen Flächen, sondern
sind Respirationslinien, die die Formen um so inniger mit dem Raum
verquicken, in den sie gebettet sind und der auf manchen Porträten die
Gestalt des unendlichen Idealraumes spätantiker Mosaiken annimmt. Und
diese ganze, scheinbar objektive Formensprache dient nur einer höchsten
Steigerung des Ausdrucks der subjektiven künstlerischen Phantasie.
Dieser »relative Objektivismus« bedeutet nach Riegls Definition in Wahr-
heit einen höchsten optischen Subjektivismus, in dem jede materielle
Festigkeit verschwindet und nur mehr körperlose, vergeistigte Ausdrucks-
formen übrigbleiben. Es ist die gleiche Erscheinung wie bei Cezanne und
Gauguin. Dasselbe Kunstwollen liegt auch van Goghs Verhältnis zur alt-
orientalischen und »primitiven« Kunst, zur Kunst Giottos und Millets,
Rembrandts und Vermeers zugrunde. Es ist das Kunstwollen des Zeit-
alters des historischen Idealismus, der nach Riegl die historischen Er-
scheinungen in der optischen Fernsicht der kausalen Ideenverknüpfung
betrachtet. In seiner letzten Zeit kopierte van Gogh viel nach der Graphik
Daumiers, Delacroix', Millets und Rembrandts. Dieses Malen nach Vor-
bildern ist, wie er sagt, »eher ein Übersetzen in eine andere Sprache als
Kopieren«. So plant er, Rembrandts späte Radierung des »Betenden David«,
wo die Gestalt so sehr zur körperlosen, durchgeistigten Verdichtung der
Atmosphäre und des Raumdunkels geworden ist, daß an Stelle des
Hauptes ein vibrierender Lichtfleck steht, in einer Farbentonleiter von
Hellgelb zu Violett abzuwandeln. So setzt er aus dem Hintergrund der
großen Auferweckung des Lazarus eine Komposition zusammen: »Der
Tote und die beiden Schwestern. Die Grotte, die Hohle, der Leichnam
sind violett, gelb und weiß. Die Frau, die das Tuch vom Gesicht des
Wiedererweckten aufhebt, hat ein grünes Kleid, orangene Haare. Die
46
Schwarz und Weiß sind ihm, wie Delacroix, Ruhepunkte. Ihr stechender
Kontrast auf den Bildern von Hals, sein sparriger Pinselhieb begeistern
ihn und er nennt ihn »Kolorist der Koloristen«. Wundervoll weiß er die
Jorisdoelen von 1637 mit ihren Farbenspielen von Orange, Weiß, Blau
und Perlgrau zu analj'sieren. Und er sagt von den barocken Holländern:
»Wie haben sie sich bemüht zu zeigen, daß ein Bild etwas anderes ist
als die Natur in einem Spiegel, etwas anderes als Nachahmung, nämlich
ein Neuschaffen«. — Er glaubt an das Bestehen strenger koloristischer
und künstlerischer Gesetze, die sich die Erkenntnis erschließen und nach
denen in Zukunft jedes große Kunstwerk aufgebaut und interpretiert
werden muß.
Der Wandel in der künstlerischen Absicht von Tonmalerei zu
intensiverem Kolorismus am Ende der Frühperiode ist bezeichnend. Damit
vollzog sich eine innere Annäherung an die gleichzeitige französische
Kunst, die in den Pariser Jahren mit einem Ausgleich schloß. Die Vor-
bereitung dazu bildete der Antwerpener Aufenthalt. Damals beschäftigte
sich van Gogh viel mit dem Problem des Porträts als Ausdruckskunst. In
Rubens' Kolorismus bewundert er die Ausdruckskraft der Farbe, ganz im
Sinne von Delacroix. Eigentümlich ist sein Verhältnis zur Antike, die er
von Gericault undDelacroix tiefer und richtiger erfaßt findet als von David.
Die Pariser Zeit, die er mit Theogemeinsam verbrachte, bildet nun
eine Zäsur in der Brieffolge. Was für ein Umschwung in ihr erfolgte,
geht aber deutlich aus den folgenden Arleser Briefen hervor: es ist das
Zusammentreffen mit dem Impressionismus, mit Manet, Monet, Renoir,
Degas, Pissarro, Toulouse-Lautrec. Der Terminus »Impressionismus«,
wie ihn van Gogh versteht, umfaßt in weiterem Sinne auch jene Er-
scheinungen, die sich als »Neoimpressionisten« von den älteren Impres-
sionisten absonderten, wie Seurat und Signac. Welche Bedeutung dies
für van Gogh hatte, erhellt aus einem Vergleich der Bilder dieser Jahre
mit denen der holländischen Periode: Verschwinden der letzten tonigen
Tiefen, Aufhellung in Licht und Farbe, Auflösung der Form in vibrierende
Flächen, die als Mosaik leuchtender Flecken erscheinen. Er nimmt »nicht
für die Valeurs, sondern für die Farbe Partei«. Der große Eindruck der
ostasiatischen Kunst prägt sich ihm unauslöschlich ein.
»Ich glaube an die absolute Notwendigkeit einer neuen Kunst in
der Farbe, in der Zeichnung und im ganzen Leben selbst« schreibt er
1888 aus Arles. Diese neue Kunst bestand darin, daß die Entwicklungs-
kurve, die in Paris dem Impressionismus am nächsten stand, wieder von
ihm abrückte, um zu jener ausdrucksgewaltigen Kunst des späten van
Gogh zu führen, deren Vorstellung vor allem mit seinem Namen ver-
knüpft ist. »Ich merke mehr und mehr, wie alles, was ich in Paris gelernt
habe, weggeht und ich zu meinen Gedanken komme, die mich, ehe ich
die Impressionisten kannte, überkamen. Es wunderte mich wenig, wenn
die Impressionisten fänden, daß meine Art eher durch die Gedanken
Delacroix' als durch die ihren befruchtet wäre«. Das flimmernde Licht
des Impressionismus ballt sich um diese Zeit in seinen Bildern zu tief-
glühendenFarbenflachen zusammen, die ingrellen, blendenden Kontrasten
gegenübergestellt sind. Eine innere Bewegung durchwühlt sie und treibt
die isolierten Pinselstriche in Wellenkurven über die Fläche, zieht die
Konturen in riesigen Schlangenlinien. »Farben wie auf Glasfenstern und
eine Zeichnung in festen Linien« ist jetzt sein Kunstwollen. Das letzte
Ziel, dem diese Kunst mit all ihren ungeheuren Mitteln zustrebt, ist Aus-
druck. Die Farbe darf nicht wörtlich wahr sein im Sinne der Realisten,
die er mit dem harten Ausdruck »Augentäuscher« bedenkt, sondern muß
eine »suggestive Farbe, welche irgend eine Bewegung des glühenden
Gefühls ausdrückt«, sein. Die Farbenglorie der Pointillisten will er nicht
als Universaldogma anerkennen und er verläßt sie, um zu einheitlichem
Farbenauftrag, zu wechselndem Pinselstrich, zur einfachen Technik in
intensiven Farbenflächen überzugehen. Überaus bezeichnend sind die
Worte, mit denen er das Porträt eines Künstlerfreundes schildert: »Ich
werde ihn malen, wie er ist, so getreu ich nur kann, um anzufangen.
Aber damit ist das Gemälde nicht fertig. Um es zu vollenden, werde ich
jetzt willkürlicher Kolorist. Ich übertreibe das Blond der Haare. Ich
komme zu Orangetönen, zum Chrom, zur hellen Zitronfarbe. Hinter dem
Kopfe male ich an Stelle der gewöhnlichen Mauer eines ärmlichen
Zimmers das Unendliche. Ich mache einen Grund von reichstem Blau,
das kräftigste, das ich herausbringe. Und so bekommt der blonde,
leuchtende Kopf auf dem Hintergrunde von reichem Blau eine mystische
Wirkung wie der Stern im tiefen Azur . . . Und die guten Leute werden
in dieser Steigerung nichts anderes als Karikatur sehen«. In der
»Berceuse« mit ihren Abstufungen von Rosa zu Orange und Zitrongplb,
von Smaragdgrün zu Dunkelgrün sucht er die abgeklärte Wirkung
»primitiver« Kunstwerke hervorzubringen. Von einigen seiner Arbeiten
sagt er: »Diese übertriebenen Studien kommen mir gräßlich vor, aber
wenn ich durch eine Sache erschüttert bin, wie jetzt durch diesen kleinen
Aufsatz von Dostojewski, so scheinen es mir die einzigen zu sein, die
wirklich Bedeutung haben«.
Wohl bedeutet der Impressionismus nach seinen Worten eine
Auferstehung Delacroix', aber er wird nicht die endgültige Lehre
formulieren, auch Seurat nicht. Die neue Kunst muß darüber hinaus gehen
und das gelöste Band zu Delacroix und Monticelli wieder knüpfen. Und
in seinem Streben nach Abstraktion, nach Objektivität in Form und Farbe
berührt er sich mit zwei anderen, mit Cezanne und Gauguin. Er sucht
jene Sicherheit der Farbengebung zu erreichen, die er in Cezanne er-
kennt. Und an Gauguin bewundert er aufs höchste die Ruhe und farbige
Tiefe der großflächigen Formen. Er vergleicht ihn mit seinem alten Ideal
Millet, das jetzt neue Bedeutung für ihn gewinnt. Die nahe Berührung
mit Gauguins Kunst führt zu tiefgehenden Beziehungen. Die japanische
Kunst, deren Formensprache ihn stets begleitet, ist ihm »eine Sache wie
die Primitiven, die Griechen, die alten Holländer«. Er spricht von den
ägyptischen Künstlern, die »die ungreifbaren Dinge, die Güte, die un-
endliche Geduld, die Weisheit, die Heiterkeit, mit irgendwelchen weißen
Kurven und wundervollen Verhältnissen ausdrücken«. Stil ist sein künstle-
rischer Wille.
So hatte der Wandel seiner Entwicklung von dem tonigen, in
subjektiver Beleuchtung gesehenen Raumausschnitt und der flimmernden
impressionistischen Lichtsphäre, in der alle festen Formen untertauchen,
zu einem neuen Objektivismus der künstlerischen Anschauung geführt.
Die feste, von atmosphärischer Stimmung ungebrochene Leuchtkraft der
farbigen Fläche trat an die Stelle der undeutlichen Valeurs, ein breiter,
ausdrucksvoller Kontur begrenzte wieder die klar gesehenen Dinge, die
einst schemenhaft im Raum verschwanden. Der scheinbar zufällige Raum-
ausschnitt von einst wurde durch objektiv in grellster Deutlichkeit gezeigte
Kompositionen ersetzt. Aber die glühenden Farbenflächen sind mehr als
bloße Lokalfarben. Wie sie in tiefen Kontrasten aneinanderstoßen, be-
ginnen sie zu wogen und zu schweben, in den Raum vor- und zurück-
zuweichen. Und dieKonturen umziehen keine taktischen Flächen, sondern
sind Respirationslinien, die die Formen um so inniger mit dem Raum
verquicken, in den sie gebettet sind und der auf manchen Porträten die
Gestalt des unendlichen Idealraumes spätantiker Mosaiken annimmt. Und
diese ganze, scheinbar objektive Formensprache dient nur einer höchsten
Steigerung des Ausdrucks der subjektiven künstlerischen Phantasie.
Dieser »relative Objektivismus« bedeutet nach Riegls Definition in Wahr-
heit einen höchsten optischen Subjektivismus, in dem jede materielle
Festigkeit verschwindet und nur mehr körperlose, vergeistigte Ausdrucks-
formen übrigbleiben. Es ist die gleiche Erscheinung wie bei Cezanne und
Gauguin. Dasselbe Kunstwollen liegt auch van Goghs Verhältnis zur alt-
orientalischen und »primitiven« Kunst, zur Kunst Giottos und Millets,
Rembrandts und Vermeers zugrunde. Es ist das Kunstwollen des Zeit-
alters des historischen Idealismus, der nach Riegl die historischen Er-
scheinungen in der optischen Fernsicht der kausalen Ideenverknüpfung
betrachtet. In seiner letzten Zeit kopierte van Gogh viel nach der Graphik
Daumiers, Delacroix', Millets und Rembrandts. Dieses Malen nach Vor-
bildern ist, wie er sagt, »eher ein Übersetzen in eine andere Sprache als
Kopieren«. So plant er, Rembrandts späte Radierung des »Betenden David«,
wo die Gestalt so sehr zur körperlosen, durchgeistigten Verdichtung der
Atmosphäre und des Raumdunkels geworden ist, daß an Stelle des
Hauptes ein vibrierender Lichtfleck steht, in einer Farbentonleiter von
Hellgelb zu Violett abzuwandeln. So setzt er aus dem Hintergrund der
großen Auferweckung des Lazarus eine Komposition zusammen: »Der
Tote und die beiden Schwestern. Die Grotte, die Hohle, der Leichnam
sind violett, gelb und weiß. Die Frau, die das Tuch vom Gesicht des
Wiedererweckten aufhebt, hat ein grünes Kleid, orangene Haare. Die
46