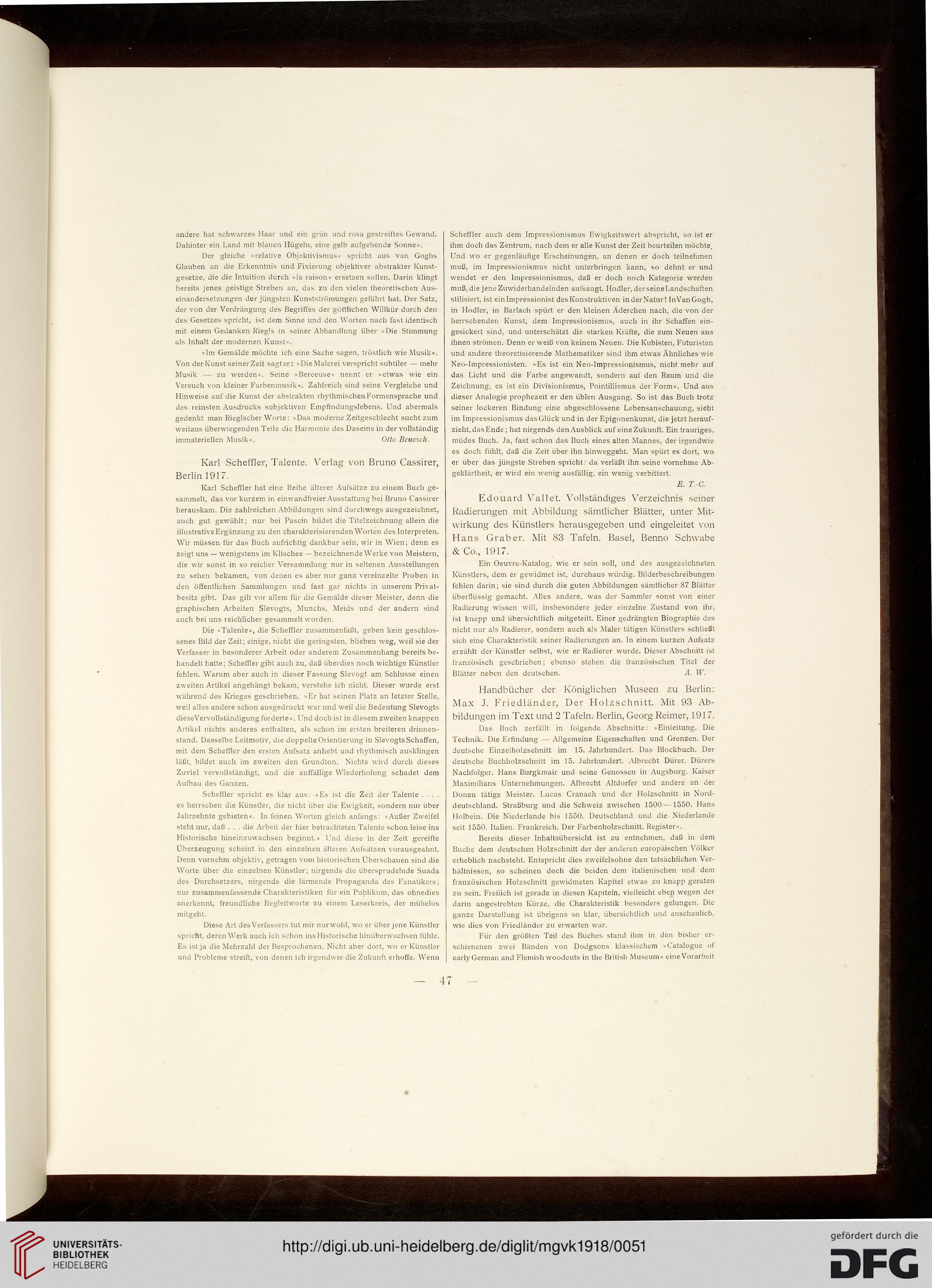WMIIm&M
andere hat schwarzes Haar und ein grün und rosa gestreiftes Gewand.
Dahinter ein Land mit blauen Hügeln, eine gelb aufgehende Sonne«.
Der gleiche »relative Objektivismus« spricht aus van Goghs
Glauben an die Erkenntnis und Fixierung objektiver abstrakter Kunst-
gesetze, die die Intuition durch »la raison« ersetzen sollen. Darin klingt
bereits jenes geistige Streben an, das zu den vielen theoretischen Aus-
einandersetzungen der jüngsten Kunststrümungen geführt hat. Der Satz,
der von der Verdrängung des Begriffes der güttlichen Willkür durch den
des Gesetzes spricht, ist dem Sinne und den Worten nach fast identisch
mit einem Gedanken Riegls in seiner Abhandlung über »Die Stimmung
als Inhalt der modernen Kunst-.
»Im Gemälde möchte ich eine Sache sagen, tröstlich wie Musik«.
Von derKunst seiner Zeit sagt er: »DieMalerei verspricht subtiler — mehr
Musik — zu werden«. Seine »Berceuse« nennt er »etwas wie ein
Versuch von kleiner Farbenmusik«. Zahlreich sind seine Vergleiche und
Hinweise auf die Kunst der abstrakten rhythmischen Formensprache und
des reinsten Ausdrucks subjektiven Empfmdungslebens. Und abermals
gedenkt man Riegischer Worte: »Das moderne Zeitgeschlccht sucht zum
weitaus überwiegenden Teile die Harmonie des Daseins in der vollständig
immateriellen Musik«. Otto Benesch.
Karl Scheffler, Talente. Verlag von Bruno Cassirer,
Berlin 1917.
Karl Scheffler hat eine Reihe älterer Aufsätze zu einem Buch ge-
sammelt, das vor kurzem in einwandfreier Ausstattung bei Bruno Cassirer
herauskam. Die zahlreichen Abbildungen sind durchwegs ausgezeichnet,
auch gut gewählt; nur bei Pascin bildet die Titelzeichnung allein die
illustrative Ergänzung zu den charakterisierenden Worten des Interpreten.
Wir müssen für das Buch aufrichtig dankbar sein, wir in W'ien; denn es
zeigt uns — wenigstens im Klischee — bezeichnende Werke von Meistern,
die wir sonst in so reicher Versammlung nur in seltenen Ausstellungen
zu sehen bekamen, von denen es aber nur ganz vereinzelte Proben in
den Öffentlichen Sammlungen und fast gar nichts in unserem Privat-
besitz gibt. Das gilt vor allem für die Gemälde dieser Meister, denn die
graphischen Arbeiten Sievogts, Munchs, Meids und der andern sind
auch bei uns reichlicher gesammelt worden.
Die »Talente«, die Scheffler zusammenfaßt, geben kein geschlos-
senes Bild der Zeit; einige, nicht die geringsten, blieben weg, weil sie der
Verfasser in besonderer Arbeit oder anderem Zusammenhang bereits be-
handelt hatte; Scheffler gibt auch zu, daß überdies noch wichtige Künstler
fehlen. Warum aber auch in dieser Fassung Slevogt am Schlüsse einen
zweiten Artikel angehängt bekam, verstehe ich nicht. Dieser wurde erst
wahrend des Krieges geschrieben. »Er hat seinen Platz an letzter Stelle,
weit alles andere schon ausgedruckt war und weil die Bedeutung Slevogts
dieseVervollständigung forderte«. Und doch ist in diesem zweiten knappen
Artikel nichts anderes enthalten, als schon im ersten breiteren drinnen-
stand. Dasselbe Leitmotiv, die doppelte Orientierung in Slevogts Schaffen,
mit dem Scheffler den ersten Aufsatz anhebt und rhythmisch ausklingen
läßt, bildet auch im zweiten den Grundton. Nichts wird durch dieses
Zuviel vervollständigt, und die auffällige Wiederholung schadet dem
Aufbau des Ganzen.
Scheffler spricht es klar aus: >Es ist die Zeit der Talente ....
es herrschen die Künstler, die nicht Über die Ewigkeit, sondern nur über
Jahrzehnte gebieten«. In feinen Worten gleich anfangs: »Außer Zweifel
steht nur, daß ... die Arbeit der hier betrachteten Talente schon leise ins
Historische hineinzuwachsen beginnt.« Und diese in der Zeit gereifte
Überzeugung scheint in den einzelnen älteren Aufsätzen vorausgeahnt.
Denn vornehm objektiv, getragen vom historischen Überschauen sind die
Worte über die einzelnen Künstler; nirgends die übersprudelnde Suada
des Durchsetzers, nirgends die lärmende Propaganda des Fanatikers;
nur zusammenlassende Charakteristiken für ein Publikum, das ohnedies
anerkennt, freundliche Begleitworte zu einem Leserkreis, der mühelus
mitgeht.
Diese Art des Verfassers tut mir nurwohl, wo er über jene Künstler
spricht, deren Werk auch ich schon ins Historische hinüberwachsen fühle.
Es ist ja die Mehrzahl der Besprochenen. Nicht aber dort, wo er Künstler
und Probleme streift, von denen ich irgendwie die Zukunft erhoffe. Wenn
Scheffler auch dem Impressionismus Ewigkeitswert abspricht, so ist er
ihm doch das Zentrum, nach dem er alle Kunst der Zeit beurteilen möchte.
Und wo er gegenläufige Erscheinungen, an denen er doch teilnehmen
muß, im Impressionismus nicht unterbringen kann, so dehnt er und
wendet er den Impressionismus, daß er doch noch Kategorie werden
muß, die jene Zuwiderhandelnden aufsaugt. Hodler, der seineLandschaften
stilisiert, ist einImpressionist des Konstruktiven inderNatur! InVanGogh,
in Hodler, in Barlach spürt er den kleinen Äderchen nach, die von der
herrschenden Kunst, dem Impressionismus, auch in ihr Schaffen ein-
gesickert sind, und unterschätzt die starken Kräfte, die zum Neuen aus
ihnen strömen. Denn er weiß von keinem Neuen. Die Kubisten, Futuristen
und andere theoretisicrende Mathematiker sind ihm etwas Ähnliches wie
Neo-Impressionisten. »Es ist ein Neo-Impressionismus, nicht mehr auf
das Licht und die Farbe angewandt, sondern auf den Raum und die
Zeichnung, es ist ein Divisionismus, Pointillismus der Form«. Und aus
dieser Analogie prophezeit er den üblen Ausgang. So ist das Buch trotz
seiner lockeren Bindung eine abgeschlossene Lebensanschauung, sieht
im Impressionismus das Glück und in der Epigonenkunst, die jetzt herauf-
zieht, das Ende; hat nirgends den Ausblick auf eine Zukunft. Ein trauriges,
müdes Buch. Ja, fast schon das Buch eines alten Mannes, der irgendwie
es doch fühlt, daß die Zeit über ihn himveggeht. Man spürt es dort, wo
er über das jüngste Streben spricht: da verläßt ihn seine vornehme Ab-
geklärtheit, er wird ein wenig ausfällig, ein wenig verbittert.
E. T.-C.
Edouard Vallet Vollständiges Verzeichnis seiner
Radierungen mit Abbildung sämtlicher Blätter, unter Mit-
wirkung des Künstlers herausgegeben und eingeleitet von
Hans Grab er. Mit 83 Tafeln. Basel, Benno Schwabe
& Co., 1917.
Ein Oeuvre-Katalog, wie er sein soll, und des ausgezeichneten
Künstlers, dem er gewidmet ist, durchaus würdig. Bilderbeschreibungen
fehlen darin; sie sind durch die guten Abbildungen sämtlicher 87 Blätter
überflüssig gemacht. Alles andere, was der Sammler sonst von einer
Radierung wissen will, insbesondere jeder einzelne Zustand von ihr,
ist knapp und übersichtlich mitgeteilt. Einer gedrängten Biographie des
nicht nur als Radierer, sondern auch als Maler tätigen Künstlers schließt
sich eine Charakteristik seiner Radierungen an. In einem kurzen Aufsatz
erzählt der Künstler selbst, wie er Radierer wurde. Dieser Abschnitt ist
französisch geschrieben; ebenso stehen die französischen Titel der
Blätter neben den deutschen. A. W.
Handbücher der Königlichen Museen zu Berlin:
Max J. Friedländer, Der Holzschnitt. Mit 93 Ab-
bildungen im Text und 2 Tafeln.. Berlin, Georg Reimer, 1917.
Das Buch zerfällt in folgende Abschnitte: »Einleitung. Die
Technik. Die Erfindung — Allgemeine Eigenschaften und Grenzen. Der
deutsche Einzelholzschnitt im 15. Jahrhundert. Das Blockbuch. Der
deutsche Buchholzschnitt im 15. Jahrhundert. Albrecht Dürer. Dürers
Nachfolger. Hans Burgkmair und seine Genossen in Augsburg. Kaiser
Maximilians Unternehmungen. Albrecht Altdorfer und andere an der
Donau tätige Meister. Lucas Cranach und der Holzschnitt in Nord-
deutschland. Straßburg und die Schweiz zwischen 1500—1550. Hans
Holbein. Die Niederlande bis 1550. Deutschland und die Niederlande
seit 1550. Italien. Frankreich. Der Farbenholzschnitt. Register«.
Bereits dieser Inhaltsübersicht ist zu entnehmen, daß in dem
Buche dem deutschen Holzschnitt der der anderen europäischen Völker
erheblich nachsteht. Entspricht dies zweifelsohne den tatsächlichen Ver-
hältnissen, so scheinen doch die beiden dem italienischen und dem
französischen Holzschnitt gewidmeten Kapitel etwas zu knapp geraten
zu sein. Freilich ist gerade in diesen Kapiteln, vielleicht eben wegen der
darin angestrebten Kürze, die Charakteristik besonders gelungen. Die
ganze Darstellung ist übrigens so klar, übersichtlich und anschaulich,
wie dies von Friedländer zu erwarten war.
Für den größten Teil des Buches stand ihm in den bisher er-
schienenen zwei Bänden von Dodgsons klassischem »Catalogue of
earlyGermanand Flemish woodeuts in the British Museum« eine Vorarbeit
47
andere hat schwarzes Haar und ein grün und rosa gestreiftes Gewand.
Dahinter ein Land mit blauen Hügeln, eine gelb aufgehende Sonne«.
Der gleiche »relative Objektivismus« spricht aus van Goghs
Glauben an die Erkenntnis und Fixierung objektiver abstrakter Kunst-
gesetze, die die Intuition durch »la raison« ersetzen sollen. Darin klingt
bereits jenes geistige Streben an, das zu den vielen theoretischen Aus-
einandersetzungen der jüngsten Kunststrümungen geführt hat. Der Satz,
der von der Verdrängung des Begriffes der güttlichen Willkür durch den
des Gesetzes spricht, ist dem Sinne und den Worten nach fast identisch
mit einem Gedanken Riegls in seiner Abhandlung über »Die Stimmung
als Inhalt der modernen Kunst-.
»Im Gemälde möchte ich eine Sache sagen, tröstlich wie Musik«.
Von derKunst seiner Zeit sagt er: »DieMalerei verspricht subtiler — mehr
Musik — zu werden«. Seine »Berceuse« nennt er »etwas wie ein
Versuch von kleiner Farbenmusik«. Zahlreich sind seine Vergleiche und
Hinweise auf die Kunst der abstrakten rhythmischen Formensprache und
des reinsten Ausdrucks subjektiven Empfmdungslebens. Und abermals
gedenkt man Riegischer Worte: »Das moderne Zeitgeschlccht sucht zum
weitaus überwiegenden Teile die Harmonie des Daseins in der vollständig
immateriellen Musik«. Otto Benesch.
Karl Scheffler, Talente. Verlag von Bruno Cassirer,
Berlin 1917.
Karl Scheffler hat eine Reihe älterer Aufsätze zu einem Buch ge-
sammelt, das vor kurzem in einwandfreier Ausstattung bei Bruno Cassirer
herauskam. Die zahlreichen Abbildungen sind durchwegs ausgezeichnet,
auch gut gewählt; nur bei Pascin bildet die Titelzeichnung allein die
illustrative Ergänzung zu den charakterisierenden Worten des Interpreten.
Wir müssen für das Buch aufrichtig dankbar sein, wir in W'ien; denn es
zeigt uns — wenigstens im Klischee — bezeichnende Werke von Meistern,
die wir sonst in so reicher Versammlung nur in seltenen Ausstellungen
zu sehen bekamen, von denen es aber nur ganz vereinzelte Proben in
den Öffentlichen Sammlungen und fast gar nichts in unserem Privat-
besitz gibt. Das gilt vor allem für die Gemälde dieser Meister, denn die
graphischen Arbeiten Sievogts, Munchs, Meids und der andern sind
auch bei uns reichlicher gesammelt worden.
Die »Talente«, die Scheffler zusammenfaßt, geben kein geschlos-
senes Bild der Zeit; einige, nicht die geringsten, blieben weg, weil sie der
Verfasser in besonderer Arbeit oder anderem Zusammenhang bereits be-
handelt hatte; Scheffler gibt auch zu, daß überdies noch wichtige Künstler
fehlen. Warum aber auch in dieser Fassung Slevogt am Schlüsse einen
zweiten Artikel angehängt bekam, verstehe ich nicht. Dieser wurde erst
wahrend des Krieges geschrieben. »Er hat seinen Platz an letzter Stelle,
weit alles andere schon ausgedruckt war und weil die Bedeutung Slevogts
dieseVervollständigung forderte«. Und doch ist in diesem zweiten knappen
Artikel nichts anderes enthalten, als schon im ersten breiteren drinnen-
stand. Dasselbe Leitmotiv, die doppelte Orientierung in Slevogts Schaffen,
mit dem Scheffler den ersten Aufsatz anhebt und rhythmisch ausklingen
läßt, bildet auch im zweiten den Grundton. Nichts wird durch dieses
Zuviel vervollständigt, und die auffällige Wiederholung schadet dem
Aufbau des Ganzen.
Scheffler spricht es klar aus: >Es ist die Zeit der Talente ....
es herrschen die Künstler, die nicht Über die Ewigkeit, sondern nur über
Jahrzehnte gebieten«. In feinen Worten gleich anfangs: »Außer Zweifel
steht nur, daß ... die Arbeit der hier betrachteten Talente schon leise ins
Historische hineinzuwachsen beginnt.« Und diese in der Zeit gereifte
Überzeugung scheint in den einzelnen älteren Aufsätzen vorausgeahnt.
Denn vornehm objektiv, getragen vom historischen Überschauen sind die
Worte über die einzelnen Künstler; nirgends die übersprudelnde Suada
des Durchsetzers, nirgends die lärmende Propaganda des Fanatikers;
nur zusammenlassende Charakteristiken für ein Publikum, das ohnedies
anerkennt, freundliche Begleitworte zu einem Leserkreis, der mühelus
mitgeht.
Diese Art des Verfassers tut mir nurwohl, wo er über jene Künstler
spricht, deren Werk auch ich schon ins Historische hinüberwachsen fühle.
Es ist ja die Mehrzahl der Besprochenen. Nicht aber dort, wo er Künstler
und Probleme streift, von denen ich irgendwie die Zukunft erhoffe. Wenn
Scheffler auch dem Impressionismus Ewigkeitswert abspricht, so ist er
ihm doch das Zentrum, nach dem er alle Kunst der Zeit beurteilen möchte.
Und wo er gegenläufige Erscheinungen, an denen er doch teilnehmen
muß, im Impressionismus nicht unterbringen kann, so dehnt er und
wendet er den Impressionismus, daß er doch noch Kategorie werden
muß, die jene Zuwiderhandelnden aufsaugt. Hodler, der seineLandschaften
stilisiert, ist einImpressionist des Konstruktiven inderNatur! InVanGogh,
in Hodler, in Barlach spürt er den kleinen Äderchen nach, die von der
herrschenden Kunst, dem Impressionismus, auch in ihr Schaffen ein-
gesickert sind, und unterschätzt die starken Kräfte, die zum Neuen aus
ihnen strömen. Denn er weiß von keinem Neuen. Die Kubisten, Futuristen
und andere theoretisicrende Mathematiker sind ihm etwas Ähnliches wie
Neo-Impressionisten. »Es ist ein Neo-Impressionismus, nicht mehr auf
das Licht und die Farbe angewandt, sondern auf den Raum und die
Zeichnung, es ist ein Divisionismus, Pointillismus der Form«. Und aus
dieser Analogie prophezeit er den üblen Ausgang. So ist das Buch trotz
seiner lockeren Bindung eine abgeschlossene Lebensanschauung, sieht
im Impressionismus das Glück und in der Epigonenkunst, die jetzt herauf-
zieht, das Ende; hat nirgends den Ausblick auf eine Zukunft. Ein trauriges,
müdes Buch. Ja, fast schon das Buch eines alten Mannes, der irgendwie
es doch fühlt, daß die Zeit über ihn himveggeht. Man spürt es dort, wo
er über das jüngste Streben spricht: da verläßt ihn seine vornehme Ab-
geklärtheit, er wird ein wenig ausfällig, ein wenig verbittert.
E. T.-C.
Edouard Vallet Vollständiges Verzeichnis seiner
Radierungen mit Abbildung sämtlicher Blätter, unter Mit-
wirkung des Künstlers herausgegeben und eingeleitet von
Hans Grab er. Mit 83 Tafeln. Basel, Benno Schwabe
& Co., 1917.
Ein Oeuvre-Katalog, wie er sein soll, und des ausgezeichneten
Künstlers, dem er gewidmet ist, durchaus würdig. Bilderbeschreibungen
fehlen darin; sie sind durch die guten Abbildungen sämtlicher 87 Blätter
überflüssig gemacht. Alles andere, was der Sammler sonst von einer
Radierung wissen will, insbesondere jeder einzelne Zustand von ihr,
ist knapp und übersichtlich mitgeteilt. Einer gedrängten Biographie des
nicht nur als Radierer, sondern auch als Maler tätigen Künstlers schließt
sich eine Charakteristik seiner Radierungen an. In einem kurzen Aufsatz
erzählt der Künstler selbst, wie er Radierer wurde. Dieser Abschnitt ist
französisch geschrieben; ebenso stehen die französischen Titel der
Blätter neben den deutschen. A. W.
Handbücher der Königlichen Museen zu Berlin:
Max J. Friedländer, Der Holzschnitt. Mit 93 Ab-
bildungen im Text und 2 Tafeln.. Berlin, Georg Reimer, 1917.
Das Buch zerfällt in folgende Abschnitte: »Einleitung. Die
Technik. Die Erfindung — Allgemeine Eigenschaften und Grenzen. Der
deutsche Einzelholzschnitt im 15. Jahrhundert. Das Blockbuch. Der
deutsche Buchholzschnitt im 15. Jahrhundert. Albrecht Dürer. Dürers
Nachfolger. Hans Burgkmair und seine Genossen in Augsburg. Kaiser
Maximilians Unternehmungen. Albrecht Altdorfer und andere an der
Donau tätige Meister. Lucas Cranach und der Holzschnitt in Nord-
deutschland. Straßburg und die Schweiz zwischen 1500—1550. Hans
Holbein. Die Niederlande bis 1550. Deutschland und die Niederlande
seit 1550. Italien. Frankreich. Der Farbenholzschnitt. Register«.
Bereits dieser Inhaltsübersicht ist zu entnehmen, daß in dem
Buche dem deutschen Holzschnitt der der anderen europäischen Völker
erheblich nachsteht. Entspricht dies zweifelsohne den tatsächlichen Ver-
hältnissen, so scheinen doch die beiden dem italienischen und dem
französischen Holzschnitt gewidmeten Kapitel etwas zu knapp geraten
zu sein. Freilich ist gerade in diesen Kapiteln, vielleicht eben wegen der
darin angestrebten Kürze, die Charakteristik besonders gelungen. Die
ganze Darstellung ist übrigens so klar, übersichtlich und anschaulich,
wie dies von Friedländer zu erwarten war.
Für den größten Teil des Buches stand ihm in den bisher er-
schienenen zwei Bänden von Dodgsons klassischem »Catalogue of
earlyGermanand Flemish woodeuts in the British Museum« eine Vorarbeit
47