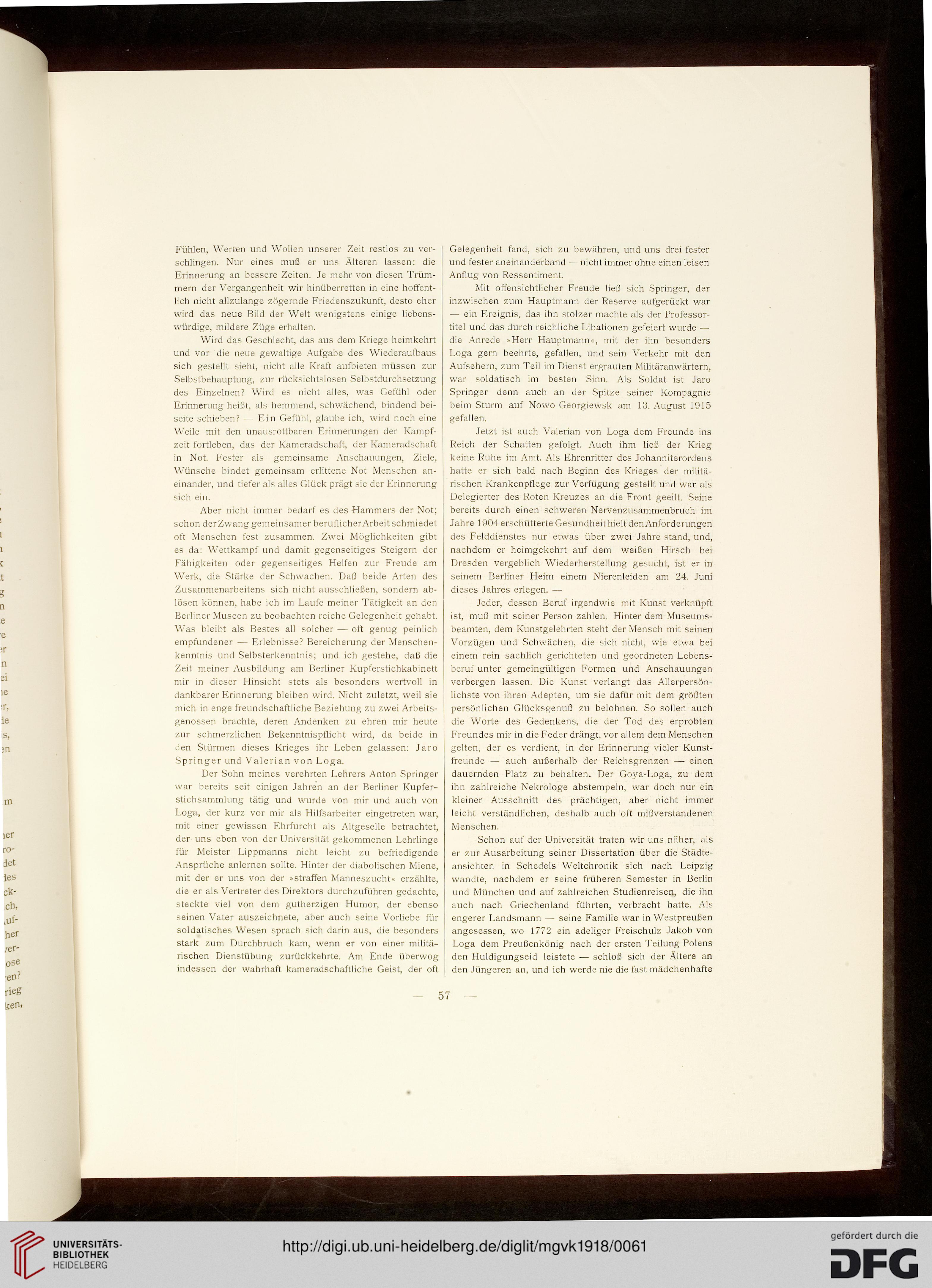Fühlen, Werten und Wollen unserer Zeit restlos zu ver-
schlingen. Nur eines muß er uns Älteren lassen: die
Erinnerung an bessere Zeiten. Je mehr von diesen Trüm-
mern der Vergangenheit wir hinüberretten in eine hoffent-
lich nicht allzulange zögernde Friedenszukunft, desto eher
wird das neue Bild der Welt wenigstens einige liebens-
würdige, mildere Züge erhalten.
Wird das Geschlecht, das aus dem Kriege heimkehrt
und vor die neue gewaltige Aufgabe des Wiederaufbaus
sich gestellt sieht, nicht alle Kraft aufbieten müssen zur
Selbstbehauptung, zur rücksichtslosen Selbstdurchsetzung
des Einzelnen? Wird es nicht alles, was Gefühl oder
Erinnerung heißt, als hemmend, schwächend, bindend bei-
seite schieben? — Ein Gefühl, glaube ich, wird noch eine
Weile mit den unausrottbaren Erinnerungen der Kampf-
zeit fortleben, das der Kameradschaft, der Kameradschaft
in Not. Fester als gemeinsame Anschauungen, Ziele,
Wünsche bindet gemeinsam erlittene Not Menschen an-
einander, und tiefer als alles Glück prägt sie der Erinnerung
sich ein.
Aber nicht immer bedarf es des Hammers der Not;
schon derZwang gemeinsamer beruflicher Arbeit schmiedet
oft Menschen fest zusammen. Zwei Möglichkeiten gibt
es da: Wettkampf und damit gegenseitiges Steigern der
Fähigkeiten oder gegenseitiges Helfen zur Freude am
Werk, die Stärke der Schwachen. Daß beide Arten des
Zusammenarbeitens sich nicht ausschließen, sondern ab-
lösen können, habe ich im Laufe meiner Tätigkeit an den
Berliner Museen zu beobachten reiche Gelegenheit gehabt.
Was bleibt als Bestes all solcher — oft genug peinlich
empfundener — Erlebnisse? Bereicherung der Menschen-
kenntnis und Selbsterkenntnis; und ich gestehe, daß die
Zeit meiner Ausbildung am Berliner Kupferstichkabinett
mir in dieser Hinsicht stets als besonders wertvoll in
dankbarer Erinnerung bleiben wird. Nicht zuletzt, weil sie
mich in enge freundschaftliche Beziehung zu zwei Arbeits-
genossen brachte, deren Andenken zu ehren mir heute
zur schmerzlichen Bekenntnispflicht wird, da beide in
den Stürmen dieses Krieges ihr Leben gelassen: Jaro
Springer und Valerian von Loga.
Der Sohn meines verehrten Lehrers Anton Springer
war bereits seit einigen Jahren an der Berliner Kupfer-
stichsammlung tätig und wurde von mir und auch von
Loga, der kurz vor mir als Hilfsarbeiter eingetreten war,
mit einer gewissen Ehrfurcht als Altgeselle betrachtet,
der uns eben von der Universität gekommenen Lehrlinge
für Meister Lippmanns nicht leicht zu befriedigende
Ansprüche anlernen sollte. Hinter der diabolischen Miene,
mit der er uns von der »straffen Manneszucht« erzählte,
die er als Vertreter des Direktors durchzuführen gedachte,
steckte viel von dem gutherzigen Humor, der ebenso
seinen Vater auszeichnete, aber auch seine Vorliebe für
soldatisches Wesen sprach sich darin aus, die besonders
stark zum Durchbruch kam, wenn er von einer militä-
rischen Dienstübung zurückkehrte. Am Ende überwog
indessen der wahrhaft kameradschaftliche Geist, der oft
Gelegenheit fand, sich zu bewähren, und uns drei fester
und fester aneinanderband — nicht immer ohne einen leisen
Anflug von Ressentiment.
Mit offensichtlicher Freude ließ sich Springer, der
inzwischen zum Hauptmann der Reserve aufgerückt war
— ein Ereignis, das ihn stolzer machte als der Professor-
titel und das durch reichliche Libationen gefeiert wurde —
die Anrede »Herr Hauptmann-, mit der ihn besonders
Loga gern beehrte, gefallen, und sein Verkehr mit den
Aufsehern, zum Teil im Dienst ergrauten Militäranwärtern,
war soldatisch im besten Sinn. Als Soldat ist Jaro
Springer denn auch an der Spitze seiner Kompagnie
beim Sturm auf Nowo Georgiewsk am 13. August 1915
gefallen.
Jetzt ist auch Valerian von Loga dem Freunde ins
Reich der Schatten gefolgt. Auch ihm ließ der Krieg
keine Ruhe im Amt. Als Ehrenritter des Johanniterordens
hatte er sich bald nach Beginn des Krieges der militä-
rischen Krankenpflege zur Verfügung gestellt und war als
Delegierter des Roten Kreuzes an die Front geeilt. Seine
bereits durch einen schweren Nervenzusammenbruch im
Jahre 1904 erschütterte Gesundheit hielt den Anforderungen
des Felddienstes nur etwas über zwei Jahre stand, und,
nachdem er heimgekehrt auf dem weißen Hirsch bei
Dresden vergeblich Wiederherstellung gesucht, ist er in
seinem Berliner Heim einem Nierenleiden am 24. Juni
dieses Jahres erlegen. —
Jeder, dessen Beruf irgendwie mit Kunst verknüpft
ist, muß mit seiner Person zahlen. Hinter dem Museums-
beamten, dem Kunstgelehrten steht der Mensch mit seinen
Vorzügen und Schwächen, die sich nicht, wie etwa bei
einem rein sachlich gerichteten und geordneten Lebens-
beruf unter gemeingültigen Formen und Anschauungen
verbergen lassen. Die Kunst verlangt das Allerpersön-
lichste von ihren Adepten, um sie dafür mit dem größten
persönlichen Glücksgenuß zu belohnen. So sollen auch
die Worte des Gedenkens, die der Tod des erprobten
Freundes mir in die Feder drängt, vor allem dem Menschen
gelten, der es verdient, in der Erinnerung vieler Kunst-
freunde — auch außerhalb der Reichsgrenzen — einen
dauernden Platz zu behalten. Der Goya-Loga, zu dem
ihn zahlreiche Nekrologe abstempeln, war doch nur ein
kleiner Ausschnitt des prächtigen, aber nicht immer
leicht verständlichen, deshalb auch oft mißverstandenen
Menschen.
Schon auf der Universität traten wir uns näher, als
er zur Ausarbeitung seiner Dissertation über die Städte-
ansichten in Schedels Weltchronik sich nach Leipzig
wandte, nachdem er seine früheren Semester in Berlin
und München und auf zahlreichen Studienreisen, die ihn
auch nach Griechenland führten, veibracht hatte. Als
engerer Landsmann — seine Familie war in Westpreußen
angesessen, wo 1772 ein adeliger Freischulz Jakob von
Loga dem Preußenkönig nach der ersten Teilung Polens
den Huldigungseid leistete — schloß sich der Ältere an
den Jüngeren an, und ich werde nie die fast mädchenhafte
57
schlingen. Nur eines muß er uns Älteren lassen: die
Erinnerung an bessere Zeiten. Je mehr von diesen Trüm-
mern der Vergangenheit wir hinüberretten in eine hoffent-
lich nicht allzulange zögernde Friedenszukunft, desto eher
wird das neue Bild der Welt wenigstens einige liebens-
würdige, mildere Züge erhalten.
Wird das Geschlecht, das aus dem Kriege heimkehrt
und vor die neue gewaltige Aufgabe des Wiederaufbaus
sich gestellt sieht, nicht alle Kraft aufbieten müssen zur
Selbstbehauptung, zur rücksichtslosen Selbstdurchsetzung
des Einzelnen? Wird es nicht alles, was Gefühl oder
Erinnerung heißt, als hemmend, schwächend, bindend bei-
seite schieben? — Ein Gefühl, glaube ich, wird noch eine
Weile mit den unausrottbaren Erinnerungen der Kampf-
zeit fortleben, das der Kameradschaft, der Kameradschaft
in Not. Fester als gemeinsame Anschauungen, Ziele,
Wünsche bindet gemeinsam erlittene Not Menschen an-
einander, und tiefer als alles Glück prägt sie der Erinnerung
sich ein.
Aber nicht immer bedarf es des Hammers der Not;
schon derZwang gemeinsamer beruflicher Arbeit schmiedet
oft Menschen fest zusammen. Zwei Möglichkeiten gibt
es da: Wettkampf und damit gegenseitiges Steigern der
Fähigkeiten oder gegenseitiges Helfen zur Freude am
Werk, die Stärke der Schwachen. Daß beide Arten des
Zusammenarbeitens sich nicht ausschließen, sondern ab-
lösen können, habe ich im Laufe meiner Tätigkeit an den
Berliner Museen zu beobachten reiche Gelegenheit gehabt.
Was bleibt als Bestes all solcher — oft genug peinlich
empfundener — Erlebnisse? Bereicherung der Menschen-
kenntnis und Selbsterkenntnis; und ich gestehe, daß die
Zeit meiner Ausbildung am Berliner Kupferstichkabinett
mir in dieser Hinsicht stets als besonders wertvoll in
dankbarer Erinnerung bleiben wird. Nicht zuletzt, weil sie
mich in enge freundschaftliche Beziehung zu zwei Arbeits-
genossen brachte, deren Andenken zu ehren mir heute
zur schmerzlichen Bekenntnispflicht wird, da beide in
den Stürmen dieses Krieges ihr Leben gelassen: Jaro
Springer und Valerian von Loga.
Der Sohn meines verehrten Lehrers Anton Springer
war bereits seit einigen Jahren an der Berliner Kupfer-
stichsammlung tätig und wurde von mir und auch von
Loga, der kurz vor mir als Hilfsarbeiter eingetreten war,
mit einer gewissen Ehrfurcht als Altgeselle betrachtet,
der uns eben von der Universität gekommenen Lehrlinge
für Meister Lippmanns nicht leicht zu befriedigende
Ansprüche anlernen sollte. Hinter der diabolischen Miene,
mit der er uns von der »straffen Manneszucht« erzählte,
die er als Vertreter des Direktors durchzuführen gedachte,
steckte viel von dem gutherzigen Humor, der ebenso
seinen Vater auszeichnete, aber auch seine Vorliebe für
soldatisches Wesen sprach sich darin aus, die besonders
stark zum Durchbruch kam, wenn er von einer militä-
rischen Dienstübung zurückkehrte. Am Ende überwog
indessen der wahrhaft kameradschaftliche Geist, der oft
Gelegenheit fand, sich zu bewähren, und uns drei fester
und fester aneinanderband — nicht immer ohne einen leisen
Anflug von Ressentiment.
Mit offensichtlicher Freude ließ sich Springer, der
inzwischen zum Hauptmann der Reserve aufgerückt war
— ein Ereignis, das ihn stolzer machte als der Professor-
titel und das durch reichliche Libationen gefeiert wurde —
die Anrede »Herr Hauptmann-, mit der ihn besonders
Loga gern beehrte, gefallen, und sein Verkehr mit den
Aufsehern, zum Teil im Dienst ergrauten Militäranwärtern,
war soldatisch im besten Sinn. Als Soldat ist Jaro
Springer denn auch an der Spitze seiner Kompagnie
beim Sturm auf Nowo Georgiewsk am 13. August 1915
gefallen.
Jetzt ist auch Valerian von Loga dem Freunde ins
Reich der Schatten gefolgt. Auch ihm ließ der Krieg
keine Ruhe im Amt. Als Ehrenritter des Johanniterordens
hatte er sich bald nach Beginn des Krieges der militä-
rischen Krankenpflege zur Verfügung gestellt und war als
Delegierter des Roten Kreuzes an die Front geeilt. Seine
bereits durch einen schweren Nervenzusammenbruch im
Jahre 1904 erschütterte Gesundheit hielt den Anforderungen
des Felddienstes nur etwas über zwei Jahre stand, und,
nachdem er heimgekehrt auf dem weißen Hirsch bei
Dresden vergeblich Wiederherstellung gesucht, ist er in
seinem Berliner Heim einem Nierenleiden am 24. Juni
dieses Jahres erlegen. —
Jeder, dessen Beruf irgendwie mit Kunst verknüpft
ist, muß mit seiner Person zahlen. Hinter dem Museums-
beamten, dem Kunstgelehrten steht der Mensch mit seinen
Vorzügen und Schwächen, die sich nicht, wie etwa bei
einem rein sachlich gerichteten und geordneten Lebens-
beruf unter gemeingültigen Formen und Anschauungen
verbergen lassen. Die Kunst verlangt das Allerpersön-
lichste von ihren Adepten, um sie dafür mit dem größten
persönlichen Glücksgenuß zu belohnen. So sollen auch
die Worte des Gedenkens, die der Tod des erprobten
Freundes mir in die Feder drängt, vor allem dem Menschen
gelten, der es verdient, in der Erinnerung vieler Kunst-
freunde — auch außerhalb der Reichsgrenzen — einen
dauernden Platz zu behalten. Der Goya-Loga, zu dem
ihn zahlreiche Nekrologe abstempeln, war doch nur ein
kleiner Ausschnitt des prächtigen, aber nicht immer
leicht verständlichen, deshalb auch oft mißverstandenen
Menschen.
Schon auf der Universität traten wir uns näher, als
er zur Ausarbeitung seiner Dissertation über die Städte-
ansichten in Schedels Weltchronik sich nach Leipzig
wandte, nachdem er seine früheren Semester in Berlin
und München und auf zahlreichen Studienreisen, die ihn
auch nach Griechenland führten, veibracht hatte. Als
engerer Landsmann — seine Familie war in Westpreußen
angesessen, wo 1772 ein adeliger Freischulz Jakob von
Loga dem Preußenkönig nach der ersten Teilung Polens
den Huldigungseid leistete — schloß sich der Ältere an
den Jüngeren an, und ich werde nie die fast mädchenhafte
57