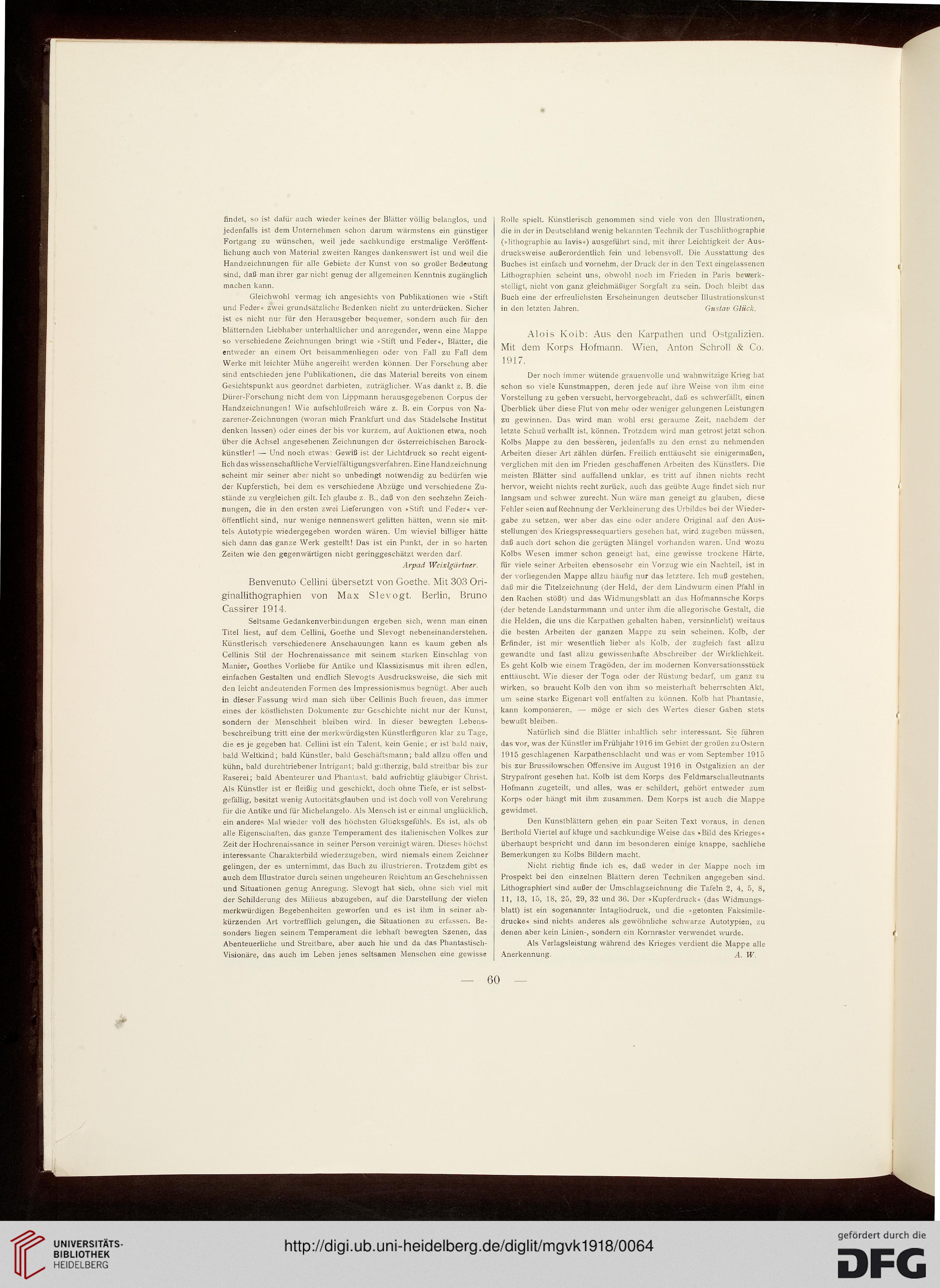findet, so ist dafür auch wieder keines der Blatter völlig belanglos, und
jedenfalls ist dem Unternehmen schon darum wärmstens ein günstiger
Fortgang zu wünschen, weil jede sachkundige erstmalige Veröffent-
lichung auch von Material zweiten Ranges dankenswert ist und weil die
Handzeichnungen für alle Gebiete der Kunst von so großer Bedeutung
sind, daß man ihrer gar nicht genug der allgemeinen Kenntnis zugänglich
machen kann.
Gleichwohl vermag ich angesichts von Publikationen wie »Stift
und Feder« zwei grundsätzliche Bedenken nicht zu unterdrücken. Sicher
ist es nicht nur für den Herausgeber bequemer, sondern auch für den
blätternden Liebhaber unterhaltlicher und anregender, wenn eine Mappe
so verschiedene Zeichnungen bringt wie »Stift und Feder«, Blattei-, die
entweder an einem Ort beisammenliegen oder von Fall zu Fall dem
Werke mit leichter Mühe angereiht werden können. Der Forschung aber
sind entschieden jene Publikationen, die das Material bereits von einem
Gesichtspunkt aus geordnet darbieten, zuträglicher. Was dankt z. B. die
Dürer-Forschung nicht dem von Lippmann herausgegebenen Corpus der
Handzeichnungen! Wie aufschlußreich wäre z. B. ein Corpus von Na-
zarener-Zeichnungen (woran mich Frankfurt und das Städelsche Institut
denken lassen) oder eines der bis vor kurzem, auf Auktionen etwa, noch
über die Achsel angesehenen Zeichnungen der österreichischen Barock-
künstler! — Und noch etwas: Gewiß ist der Lichtdruck so recht eigent-
lich das wissenschaftliche Vervielfältigungsverfahren. Eine Handzeichnung
scheint mir seiner aber nicht so unbedingt notwendig zu bedürfen wie
der Kupferstich, bei dem es verschiedene Abzüge und verschiedene Zu-
stände zu vergleichen gilt. Ich glaube z. B., daß von den sechzehn Zeich-
nungen, die in den ersten zwei Lieferungen von »Stift und Feder« ver-
öffentlicht sind, nur wenige nennenswert gelitten hätten, wenn sie mit-
tels Autotypie wiedergegeben worden wären. Um wieviel billiger hätte
sich dann das ganze Werk gestellt! Das ist ein Punkt, der in so harten
Zeiten wie den gegenwärtigen nicht geringgeschätzt werden darf.
Arpad Weixlgärincr.
Benvenuto Cellini übersetzt von Goethe. Mit 303 Ori-
ginallithographien von Max Slevogt. Berlin, Bruno
Cassirer 1914.
Seltsame Gedankenverbindungen ergeben sich, wenn man einen
Titel liest, auf dem Cellini, Goethe und Slevogt nebeneinanderstehen.
Künstlerisch verschiedenere Anschauungen kann es kaum geben als
Cellinis Stil der Hochrenaissance mit seinem starken Einschlag von
Manier, Goethes Vorüebe für Antike und Klassizismus mit ihren edlen,
einfachen Gestalten und endlich Slevogts Ausdrucksweise, die sich mit
den leicht andeutenden Formen des Impressionismus begnügt. Aber auch
in dieser Fassung wird man sich über Cellinis Buch freuen, das immer
eines der köstlichsten Dokumente zur Geschichte nicht nur der Kunst,
sondern der Menschheit bleiben wird- In dieser bewegten Lebens-
beschreibung tritt eine der merkwürdigsten Künstlerfiguren klar zu Tage,
die es je gegeben hat. Cellini ist ein Talent, kein Genie; er ist bald naiv,
bald Weltkind; bald Künstler, bald Geschäftsmann; bald allzu offen und
kühn, bald durchtriebener Intrigant; bald gutherzig, bald streitbar bis zur
Raserei; bald Abenteurer und Phantast, bald aufrichtig gläubiger Christ.
Als Künstler ist er fleißig und geschickt, doch ohne Tiefe, er ist selbst-
gefällig, besitzt wenig Autoritätsglauben und ist doch voll von Verehrung
für die Antike und für Michelangelo. Als Mensch ist er einmal unglücklich,
ein andere^ Mal wieder voll des höchsten Glucksgefühls. Es ist, als ob
alle Eigenschaften, das ganze Temperament des italienischen Volkes zur
Zeit der Hochrenaissance in seiner Person vereinigt waren. Dieses höchst
interessante Charakterbild wiederzugeben, wird niemals einem Zeichner
gelingen, der es unternimmt, das Buch zu illustrieren. Trotzdem gibt es
auch dem Illustrator durch seinen ungeheuren Reichtum an Geschehnissen
und Situationen genug Anregung. Slevogt hat sich, ohne sich viel mit
der Schilderung des Milieus abzugeben, auf die Darstellung der vielen
merkwürdigen Begebenheiten geworfen und es ist ihm in seiner ab-
kürzenden Art vortrefflich gelungen, die Situationen zu erfassen. Be-
sonders liegen seinem Temperament die lebhaft bewegten Szenen, das
Abenteuerliche und Streitbare, aber auch hie und da das Phantastisch-
Visionäre, das auch im Leben jenes seltsamen Menschen eine gewisse
Rolle spielt. Künstlerisch genommen sind viele von den Illustrationen,
die in der in Deutschland wenig bekannten Technik der Tusehlitbographie
(»litbographie au lavis«) ausgeführt sind, mit ihrer Leichtigkeit der Aus-
drucksweise außerordentlich fein und lebensvoll. Die Ausstattung des
Buches ist einfach und vornehm, der Druck der in den Text eingelassenen
Lithographien scheint uns, obwohl noch im Frieden in Paris bewerk-
stelligt, nicht von ganz gleichmäßiger Sorgfalt zu sein. Doch bleibt das
Buch eine der erfreulichsten Erscheinungen deutscher Illustrationskunst
in den letzten Jahren. Gustav Glück.
Alois Koib: Aus den Karpathen und Ostgalizien.
Mit dem Korps Hofmann. Wien, Anton Schroll & Co.
1917.
Der noch immer wütende grauenvolle und wahnwitzige Krieg hat
schon so viele Kunstmappen, deren jede auf ihre Weise vnn ihm eine
Vorstellung zu geben versucht, hervorgebracht, daß es schwerfällt, einen
Überblick über diese Flut von mehr oder weniger gelungenen Leistungen
zu gewinnen. Das wird man wohl erst geraume Zeit, nachdem der
letzte Schuß verhallt ist, können. Trotzdem wird man getrost jetzt schon
Kolbs Mappe zu den besseren, jedenfalls zu den ernst zu nehmenden
Arbeiten dieser Art zählen dürfen. Freilich enttäuscht sie einigermaßen,
verglichen mit den im Frieden geschaffenen Arbeiten des Künstlers. Die
meisten Blätter sind auffallend unklar, es tritt auf ihnen nichts recht
hervor, weicht nichts recht zurück, auch das geübte Auge findet sich nur
langsam und schwer zurecht. Nun wäre man geneigt zu glauben, diese
Fehler seien auf Rechnung der Verkleinerung des Urbildes bei der Wieder-
gabe zu setzen, wer aber das eine oder andere Original auf den Aus-
stellungen des Kriegspressequartiers gesehen hat, wird zugeben müssen,
daß auch dort schon die gerügten Mängel vorhanden waren. Und wozu
Kolbs Wesen immer schon geneigt hat, eine gewisse trockene Härte,
für viele seiner Arbeiten ebensosehr ein Vorzug wie ein Nachteil, ist in
der vorliegenden Mappe allzu häufig nur das letztere. Ich muß gestehen,
daß mir die Titelzeichnung (der Held, der dem Lindwurm einen Pfahl in
den Rachen stößt) und das Widmungsblatt an das Hofmannsche Korps
(der betende Landsturm mann und unter ihm die allegorische Gestalt, die
die Helden, die uns die Karpathen gehalten haben, versinnücht) weitaus
die besten Arbeiten der ganzen Mappe zu sein scheinen. Kolb, der
Erfinder, ist mir wesentlich Heber als Kolb, der zugleich fast allzu
gewandte und fast allzu gewissenhafte Abschreiber der Wirklichkeit.
Es geht Kolb wie einem Tragöden, der im modernen Konversationsstück
enttäuscht. Wie dieser der Toga oder der Rüstung bedarf, um ganz zu
wirken, so braucht Kolb den von ihm so meisterhaft beherrschten Akt,
um seine starke Eigenart voll entfalten zu können. Kolb hat Phantasie,
kann komponieren, — möge er sich des Wertes dieser Gaben stets
bewußt bleiben.
Natürlich sind die Blätter inhaltlich sehr interessant. Sie führen
das vor, was der Künstler im Frühjahr 1916 im Gebiet der großen zu Ostern
1915 geschlagenen Karpatbenschlacht und was er vom September 1915
bis zur Brussilowschen Offensive im August 1916 in Ostgalizien an der
Strypafront gesehen hat. Kolb ist dem Korps des Feldmarschalleutnants
Hofmann zugeteilt, und alles, was er schildert, gehört entweder zum
Korps oder hängt mit ihm zusammen. Dem Korps ist auch die Mappe
gewidmet.
Den Kunstblättern gehen ein paar Seiten Text voraus, in denen
Berthold Viertel auf kluge und sachkundige Weise das »Bild des Krieges«
überhaupt bespricht und dann im besonderen einige knappe, sachliche
Bemerkungen zu Kolbs Bildern macht.
Nicht richtig finde ich es, daß weder in der Mappe noch im
Prospekt bei den einzelner. Blattern deren Techniken angegeben sind.
Lithographiert sind außer der Umschlagzeichnung die Tafeln 2, 4, 5, 8,
11, 13, 15, 18, 25, 29, 32 und 36. Der »Kupferdruck« (das Widmungs-
blatt) ist ein sogenannter Intagliodruck, und die »getonten Faksimile-
drucke« sind nichts anderes als gewöhnliche schwarze Autotypien, zu
denen aber kein Linien-, sondern ein Kornraster verwendet wurde.
Als Verlagsleistung während des Krieges verdient die Mappe alle
Anerkennung. A. W.
60
jedenfalls ist dem Unternehmen schon darum wärmstens ein günstiger
Fortgang zu wünschen, weil jede sachkundige erstmalige Veröffent-
lichung auch von Material zweiten Ranges dankenswert ist und weil die
Handzeichnungen für alle Gebiete der Kunst von so großer Bedeutung
sind, daß man ihrer gar nicht genug der allgemeinen Kenntnis zugänglich
machen kann.
Gleichwohl vermag ich angesichts von Publikationen wie »Stift
und Feder« zwei grundsätzliche Bedenken nicht zu unterdrücken. Sicher
ist es nicht nur für den Herausgeber bequemer, sondern auch für den
blätternden Liebhaber unterhaltlicher und anregender, wenn eine Mappe
so verschiedene Zeichnungen bringt wie »Stift und Feder«, Blattei-, die
entweder an einem Ort beisammenliegen oder von Fall zu Fall dem
Werke mit leichter Mühe angereiht werden können. Der Forschung aber
sind entschieden jene Publikationen, die das Material bereits von einem
Gesichtspunkt aus geordnet darbieten, zuträglicher. Was dankt z. B. die
Dürer-Forschung nicht dem von Lippmann herausgegebenen Corpus der
Handzeichnungen! Wie aufschlußreich wäre z. B. ein Corpus von Na-
zarener-Zeichnungen (woran mich Frankfurt und das Städelsche Institut
denken lassen) oder eines der bis vor kurzem, auf Auktionen etwa, noch
über die Achsel angesehenen Zeichnungen der österreichischen Barock-
künstler! — Und noch etwas: Gewiß ist der Lichtdruck so recht eigent-
lich das wissenschaftliche Vervielfältigungsverfahren. Eine Handzeichnung
scheint mir seiner aber nicht so unbedingt notwendig zu bedürfen wie
der Kupferstich, bei dem es verschiedene Abzüge und verschiedene Zu-
stände zu vergleichen gilt. Ich glaube z. B., daß von den sechzehn Zeich-
nungen, die in den ersten zwei Lieferungen von »Stift und Feder« ver-
öffentlicht sind, nur wenige nennenswert gelitten hätten, wenn sie mit-
tels Autotypie wiedergegeben worden wären. Um wieviel billiger hätte
sich dann das ganze Werk gestellt! Das ist ein Punkt, der in so harten
Zeiten wie den gegenwärtigen nicht geringgeschätzt werden darf.
Arpad Weixlgärincr.
Benvenuto Cellini übersetzt von Goethe. Mit 303 Ori-
ginallithographien von Max Slevogt. Berlin, Bruno
Cassirer 1914.
Seltsame Gedankenverbindungen ergeben sich, wenn man einen
Titel liest, auf dem Cellini, Goethe und Slevogt nebeneinanderstehen.
Künstlerisch verschiedenere Anschauungen kann es kaum geben als
Cellinis Stil der Hochrenaissance mit seinem starken Einschlag von
Manier, Goethes Vorüebe für Antike und Klassizismus mit ihren edlen,
einfachen Gestalten und endlich Slevogts Ausdrucksweise, die sich mit
den leicht andeutenden Formen des Impressionismus begnügt. Aber auch
in dieser Fassung wird man sich über Cellinis Buch freuen, das immer
eines der köstlichsten Dokumente zur Geschichte nicht nur der Kunst,
sondern der Menschheit bleiben wird- In dieser bewegten Lebens-
beschreibung tritt eine der merkwürdigsten Künstlerfiguren klar zu Tage,
die es je gegeben hat. Cellini ist ein Talent, kein Genie; er ist bald naiv,
bald Weltkind; bald Künstler, bald Geschäftsmann; bald allzu offen und
kühn, bald durchtriebener Intrigant; bald gutherzig, bald streitbar bis zur
Raserei; bald Abenteurer und Phantast, bald aufrichtig gläubiger Christ.
Als Künstler ist er fleißig und geschickt, doch ohne Tiefe, er ist selbst-
gefällig, besitzt wenig Autoritätsglauben und ist doch voll von Verehrung
für die Antike und für Michelangelo. Als Mensch ist er einmal unglücklich,
ein andere^ Mal wieder voll des höchsten Glucksgefühls. Es ist, als ob
alle Eigenschaften, das ganze Temperament des italienischen Volkes zur
Zeit der Hochrenaissance in seiner Person vereinigt waren. Dieses höchst
interessante Charakterbild wiederzugeben, wird niemals einem Zeichner
gelingen, der es unternimmt, das Buch zu illustrieren. Trotzdem gibt es
auch dem Illustrator durch seinen ungeheuren Reichtum an Geschehnissen
und Situationen genug Anregung. Slevogt hat sich, ohne sich viel mit
der Schilderung des Milieus abzugeben, auf die Darstellung der vielen
merkwürdigen Begebenheiten geworfen und es ist ihm in seiner ab-
kürzenden Art vortrefflich gelungen, die Situationen zu erfassen. Be-
sonders liegen seinem Temperament die lebhaft bewegten Szenen, das
Abenteuerliche und Streitbare, aber auch hie und da das Phantastisch-
Visionäre, das auch im Leben jenes seltsamen Menschen eine gewisse
Rolle spielt. Künstlerisch genommen sind viele von den Illustrationen,
die in der in Deutschland wenig bekannten Technik der Tusehlitbographie
(»litbographie au lavis«) ausgeführt sind, mit ihrer Leichtigkeit der Aus-
drucksweise außerordentlich fein und lebensvoll. Die Ausstattung des
Buches ist einfach und vornehm, der Druck der in den Text eingelassenen
Lithographien scheint uns, obwohl noch im Frieden in Paris bewerk-
stelligt, nicht von ganz gleichmäßiger Sorgfalt zu sein. Doch bleibt das
Buch eine der erfreulichsten Erscheinungen deutscher Illustrationskunst
in den letzten Jahren. Gustav Glück.
Alois Koib: Aus den Karpathen und Ostgalizien.
Mit dem Korps Hofmann. Wien, Anton Schroll & Co.
1917.
Der noch immer wütende grauenvolle und wahnwitzige Krieg hat
schon so viele Kunstmappen, deren jede auf ihre Weise vnn ihm eine
Vorstellung zu geben versucht, hervorgebracht, daß es schwerfällt, einen
Überblick über diese Flut von mehr oder weniger gelungenen Leistungen
zu gewinnen. Das wird man wohl erst geraume Zeit, nachdem der
letzte Schuß verhallt ist, können. Trotzdem wird man getrost jetzt schon
Kolbs Mappe zu den besseren, jedenfalls zu den ernst zu nehmenden
Arbeiten dieser Art zählen dürfen. Freilich enttäuscht sie einigermaßen,
verglichen mit den im Frieden geschaffenen Arbeiten des Künstlers. Die
meisten Blätter sind auffallend unklar, es tritt auf ihnen nichts recht
hervor, weicht nichts recht zurück, auch das geübte Auge findet sich nur
langsam und schwer zurecht. Nun wäre man geneigt zu glauben, diese
Fehler seien auf Rechnung der Verkleinerung des Urbildes bei der Wieder-
gabe zu setzen, wer aber das eine oder andere Original auf den Aus-
stellungen des Kriegspressequartiers gesehen hat, wird zugeben müssen,
daß auch dort schon die gerügten Mängel vorhanden waren. Und wozu
Kolbs Wesen immer schon geneigt hat, eine gewisse trockene Härte,
für viele seiner Arbeiten ebensosehr ein Vorzug wie ein Nachteil, ist in
der vorliegenden Mappe allzu häufig nur das letztere. Ich muß gestehen,
daß mir die Titelzeichnung (der Held, der dem Lindwurm einen Pfahl in
den Rachen stößt) und das Widmungsblatt an das Hofmannsche Korps
(der betende Landsturm mann und unter ihm die allegorische Gestalt, die
die Helden, die uns die Karpathen gehalten haben, versinnücht) weitaus
die besten Arbeiten der ganzen Mappe zu sein scheinen. Kolb, der
Erfinder, ist mir wesentlich Heber als Kolb, der zugleich fast allzu
gewandte und fast allzu gewissenhafte Abschreiber der Wirklichkeit.
Es geht Kolb wie einem Tragöden, der im modernen Konversationsstück
enttäuscht. Wie dieser der Toga oder der Rüstung bedarf, um ganz zu
wirken, so braucht Kolb den von ihm so meisterhaft beherrschten Akt,
um seine starke Eigenart voll entfalten zu können. Kolb hat Phantasie,
kann komponieren, — möge er sich des Wertes dieser Gaben stets
bewußt bleiben.
Natürlich sind die Blätter inhaltlich sehr interessant. Sie führen
das vor, was der Künstler im Frühjahr 1916 im Gebiet der großen zu Ostern
1915 geschlagenen Karpatbenschlacht und was er vom September 1915
bis zur Brussilowschen Offensive im August 1916 in Ostgalizien an der
Strypafront gesehen hat. Kolb ist dem Korps des Feldmarschalleutnants
Hofmann zugeteilt, und alles, was er schildert, gehört entweder zum
Korps oder hängt mit ihm zusammen. Dem Korps ist auch die Mappe
gewidmet.
Den Kunstblättern gehen ein paar Seiten Text voraus, in denen
Berthold Viertel auf kluge und sachkundige Weise das »Bild des Krieges«
überhaupt bespricht und dann im besonderen einige knappe, sachliche
Bemerkungen zu Kolbs Bildern macht.
Nicht richtig finde ich es, daß weder in der Mappe noch im
Prospekt bei den einzelner. Blattern deren Techniken angegeben sind.
Lithographiert sind außer der Umschlagzeichnung die Tafeln 2, 4, 5, 8,
11, 13, 15, 18, 25, 29, 32 und 36. Der »Kupferdruck« (das Widmungs-
blatt) ist ein sogenannter Intagliodruck, und die »getonten Faksimile-
drucke« sind nichts anderes als gewöhnliche schwarze Autotypien, zu
denen aber kein Linien-, sondern ein Kornraster verwendet wurde.
Als Verlagsleistung während des Krieges verdient die Mappe alle
Anerkennung. A. W.
60