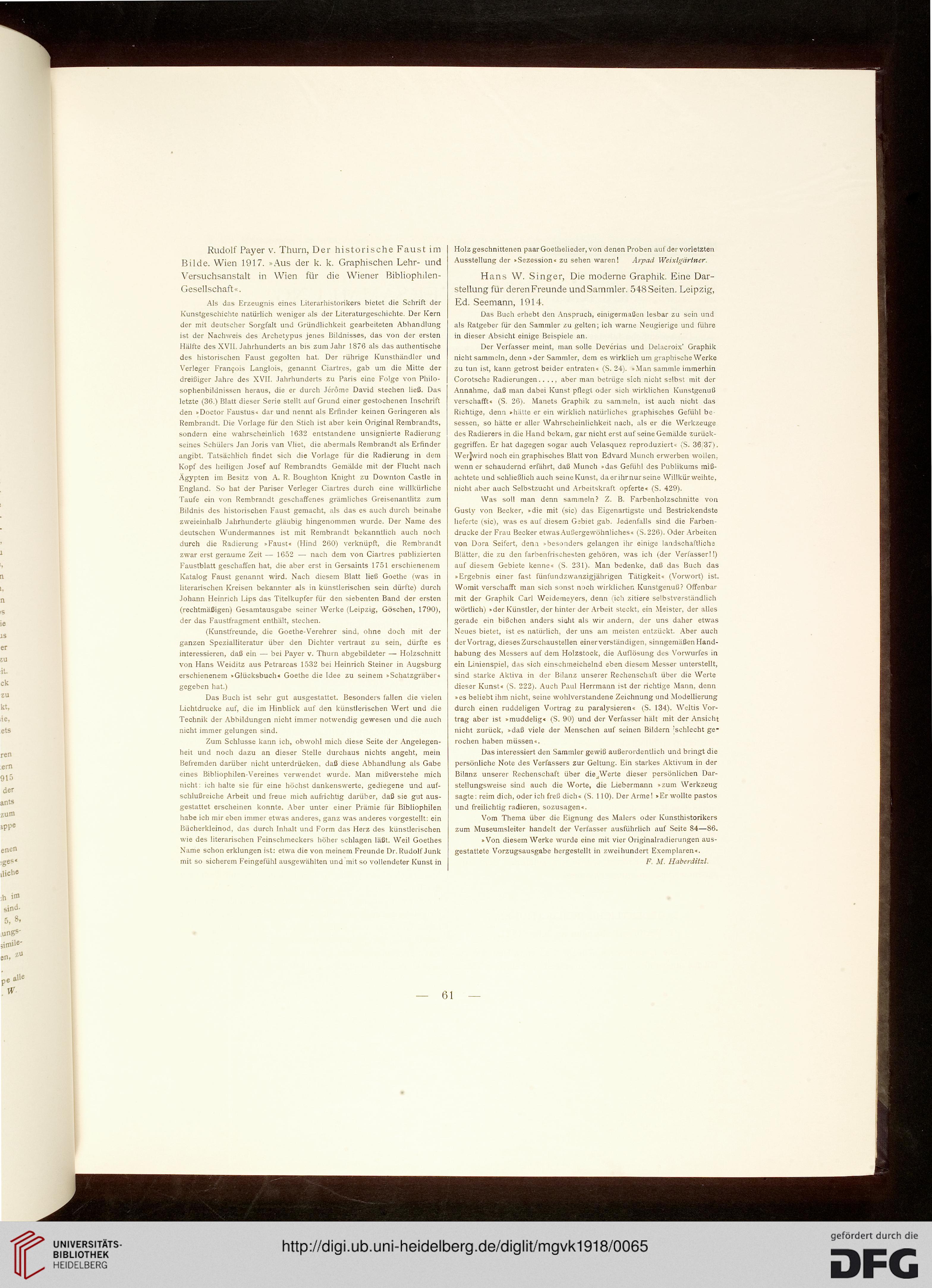Rudolf Payer v. Thurn, Der historische Faust im
Bilde. Wien 1917. »Aus der k. k. Graphischen Lehr- und
Versuchsanstalt in Wien für die Wiener Bibliophilen-
Gesellschaft«.
Als das Erzeugnis eines Literarhistorikers bietet die Schrift der
Kunstgeschichte natürlich weniger als der Literaturgeschichte. Der Kern
der mit deutscher Sorgfalt und Gründlichkeit gearbeiteten Abhandlung
ist der Nachweis des Archetypus jenes Bildnisses, das von der ersten
Hälfte des XVII. Jahrhunderts an bis zum Jahr 1876 als das authentische
des historischen Faust gegolten hat. Der rührige Kunsthändler und
Verleger Francois Langlois, genannt Ciartres, gab um die Mitte der
dreißiger Jahre des XVII. Jahrhunderts zu Paris eine Folge von Philo-
sophenbildnissen heraus, die er durch Jeröme David stechen ließ. Das
letzte (36.) Blatt dieser Serie stellt auf Grund einer gestochenen Inschrift
den >Doctor Faustus« dar und nennt als Erfinder keinen Geringeren als
Rembrandt. Die Vorlage für den Stich ist aber kein Original Rembrandts,
sondern eine wahrscheinlich 1632 entstandene unsignierte Radierung
seines Schülers Jan Joris van Vhet, die abermals Rembrandt als Erfinder
angibt. Tatsächlich findet sich die Vorlage für die Radierung in dem
Kopf des heiligen Josef auf Rembrandts Gemälde mit der Flucht nach
Ägypten im Besitz von A. R. Boughton Knight zu Downton Castle in
England. So hat der Pariser Verleger Ciartres durch eine willkürliche
Taufe ein von Rembrandt geschaffenes grämliches Greisenantlitz zum
Bildnis des historischen Faust gemacht, als das es auch durch beinahe
zweieinhalb Jahrhunderte gläubig hingenommen wurde. Der Name des
deutschen Wundermannes ist mit Rembrandt bekanntlich auch noch
durch die Radierung »Faust« (Hind 260) verknüpft, die Rembrandt
zwar erst geraume Zeit — 1652 — nach dem von Ciartres publizierten
Faustblatt geschaffen hat, die aber erst in Gersaints 1751 erschienenem
Katalog Faust genannt wird. Nach diesem Blatt ließ Goethe (was in
literarischen Kreisen bekannter als in künstlerischen sein dürfte) durch
Johann Heinrich Lips das Titelkupfer für den siebenten Band der ersten
(rechtmäßigeni Gesamtausgabe seiner Werke (Leipzig, Göschen, 1790),
der das Faustfragment enthält, stechen.
(Kunstfreunde, die Goethe-Verehrer sind, ohne doch mit der
ganzen Spezialliteratur über den Dichter vertraut zu sein, dürfte es
interessieren, daß ein — bei Payer v. Thurn abgebildeter — Holzschnitt
von Hans Weiditz aus Petrarcas 1532 bei Heinrich Steiner in Augsburg
erschienenem »Glücksbuch« Goethe die Idee zu seinem »Schatzgräber«
gegeben hat.)
Das Buch ist sehr gut ausgestattet. Besonders lallen die vielen
Lichtdrucke auf, die im Hinblick auf den künstlerischen Wert und die
Technik der Abbildungen nicht immer notwendig gewesen und die auch
nicht immer gelungen sind.
Zum Schlüsse kann ich, obwohl mich diese Seite der Angelegen-
heit und noch dazu an dieser Stelle durchaus nichts angeht, mein
Befremden darüber nicht unterdrücken, daß diese Abhandlung als Gabe
eines Bibliophilen-Vereines verwendet wurde. Man mißverstehe mich
nicht: ich halte sie für eine höchst dankenswerte, gediegene und auf-
schlußreiche Arbeit und freue mich aufrichtig darüber, daß sie gut aus-
gestattet erscheinen konnte. Aber unter einer Prämie für Bibliophilen
habe ich mir eben immer etwas anderes, ganz was anderes vorgestellt: ein
Bücherkleinod, das durch Inhalt und Form das Herz des künstlerischen
wie des literarischen Feinschmeckers höher schlagen läßt. Weil Goethes
Name schon erklungen ist: etwa die von meinem Freunde Dr. Rudolf Junk
mit so sicherem Feingefühl ausgewählten und mit so vollendeter Kunst in
Holz geschnittenen paar Goethelieder, von denen Proben aut der vorletzten
Ausstellung der »Sezession« zu sehen waren! Arpad Wetxlifärtner-
Hans W. Singer, Die moderne Graphik. Eine Dar-
stellung für deren Freunde und Sammler. 548Seiten. Leipzig,
Ed. Seemann, 1914.
Das Buch erhebt den Anspruch, einigermaßen lesbar zu sein und
als Ratgeber für den Sammler zu gelten; ich warne Neugierige und führe
in dieser Absicht einige Beispiele an.
Der Verfasser meint, man solle Deverias und Delacroix' Graphik
nicht sammeln, denn »der Sammler, dem es wirklich um graphische Werke
zu tun ist, kann getrost beider entraten« (S. 24). »Man sammle immerhin
Corotsche Radierungen.....aber man betrüge sich nicht sslbst mit der
Annahme, daß man dabei Kunst pflegt oder sich wirklichen Kunstgenuß
verschafft« (S. 26). Manets Graphik zu sammeln, ist auch nicht das
Richtige, denn »hatte er ein wirklich natürliches graphisches Gefühl be-
sessen, so hätte er aller Wahrscheinlichkeit nach, als er die Werkzeuge
des Radierers in die Hand bekam, gar nicht erst auf seine Gemälde zurück-
gegriffen. Er bat dagegen sogar auch Velasquez reproduziert« (S. 36/37).
Werjwird noch ein graphisches Blatt von Edvard Manch erwerben wollen,
wenn er schaudernd erfährt, daß Munch »das Gefühl des Publikums miß-
achtete und schließlich auch seineKunst, da enhrnur seine Willkür weihte,
nicht aber auch Selbstzucht und Arbeitskraft opferte« (S. 429).
Was soll man denn sammeln? Z. B. Farbenholzschnitte von
Gusty von Becker, »die mit (sie) das Eigenartigste und Bestrickendste
lieferte (sie), was es auf diesem Gebiet gab. Jedenfalls sind die Farben-
drucke der Frau Becker etwas Außergewöhnliches« (S.226). Oder Arbeiten
von Dora Seifert, dena »besonders gelangen ihr einige landschaftliche
Blätter, die zu den farbenfrischesten gehören, was ich (der Verfasser!!)
auf diesem Gebiete kenne« (S. 231). Man bedenke, daß das Buch das
»Ergebnis einer fast fünfundzwanzigjährigen Tätigkeit« (Vorwort) ist.
Womit verschafft man sich sonst noch wirklichen Kunstgenuß? Offenbar
mit der Graphik Carl Weidemeyers, denn ('ich zitiere selbstverständlich
wörtlich) »der Künstler, der hinter der Arbeit steckt, ein Meister, der alles
gerade ein bißchen anders siej.it als wir andern, der uns daher etwas
Neues bietet, ist es natürlich, der uns am meisten entzückt. Aber auch
derVortrag, dieses Zurschaustellen einerverständigen, sinngemäßen Hand-
habung des Messers auf dem Holzstock, die Auflösung des Vorwurfes in
ein Linienspiel, das sich einschmeichelnd eben diesem Messer unterstellt,
sind starke Aktiva in der Bilanz unserer Rechenschaft über die Werte
dieser Kunst« (S. 222). Auch Paul Herrmann ist der richtige Mann, denn
»es beliebt ihm nicht, seine wohlverstandene Zeichnung und Modellierung
durch einen ruddeligen Vortrag zu paralysieren« (S. 134). Weltis Vor-
trag aber ist »muddelig« (S. 90) und der Verfasser hält mit der Ansicht
nicht zurück, »daß viele der Menschen auf seinen Bildern ^schlecht ge-
rochen haben müssen<*.
Das interessiert den Sammler gewiß außerordentlich und bringt die
persönliche Note des Verfassers zur Geltung. Ein starkes Aktivum in der
Bilanz unserer Rechenschaft über die^Werte dieser persönlichen Dar-
stellungsweise sind auch die Worte, die Liebermann »zum Werkzeug
sagte: reim dich, oder ich freß dich« (S. 110). Der Arme! »Er wollte pastos
und freilichtig radieren, sozusagen«.
Vom Thema über die Eignung des Malers oder Kunsthistorikers
zum Museumsleiter handelt der Verfasser ausführlich auf Seite 84—86.
»Von diesem Werke wurde eine mit vier Originalradierungen aus-
gestattete Vorzugsausgabe hergestellt in zweihundert Exemplaren«.
F. M. Haberditzl.
. alle
61
Bilde. Wien 1917. »Aus der k. k. Graphischen Lehr- und
Versuchsanstalt in Wien für die Wiener Bibliophilen-
Gesellschaft«.
Als das Erzeugnis eines Literarhistorikers bietet die Schrift der
Kunstgeschichte natürlich weniger als der Literaturgeschichte. Der Kern
der mit deutscher Sorgfalt und Gründlichkeit gearbeiteten Abhandlung
ist der Nachweis des Archetypus jenes Bildnisses, das von der ersten
Hälfte des XVII. Jahrhunderts an bis zum Jahr 1876 als das authentische
des historischen Faust gegolten hat. Der rührige Kunsthändler und
Verleger Francois Langlois, genannt Ciartres, gab um die Mitte der
dreißiger Jahre des XVII. Jahrhunderts zu Paris eine Folge von Philo-
sophenbildnissen heraus, die er durch Jeröme David stechen ließ. Das
letzte (36.) Blatt dieser Serie stellt auf Grund einer gestochenen Inschrift
den >Doctor Faustus« dar und nennt als Erfinder keinen Geringeren als
Rembrandt. Die Vorlage für den Stich ist aber kein Original Rembrandts,
sondern eine wahrscheinlich 1632 entstandene unsignierte Radierung
seines Schülers Jan Joris van Vhet, die abermals Rembrandt als Erfinder
angibt. Tatsächlich findet sich die Vorlage für die Radierung in dem
Kopf des heiligen Josef auf Rembrandts Gemälde mit der Flucht nach
Ägypten im Besitz von A. R. Boughton Knight zu Downton Castle in
England. So hat der Pariser Verleger Ciartres durch eine willkürliche
Taufe ein von Rembrandt geschaffenes grämliches Greisenantlitz zum
Bildnis des historischen Faust gemacht, als das es auch durch beinahe
zweieinhalb Jahrhunderte gläubig hingenommen wurde. Der Name des
deutschen Wundermannes ist mit Rembrandt bekanntlich auch noch
durch die Radierung »Faust« (Hind 260) verknüpft, die Rembrandt
zwar erst geraume Zeit — 1652 — nach dem von Ciartres publizierten
Faustblatt geschaffen hat, die aber erst in Gersaints 1751 erschienenem
Katalog Faust genannt wird. Nach diesem Blatt ließ Goethe (was in
literarischen Kreisen bekannter als in künstlerischen sein dürfte) durch
Johann Heinrich Lips das Titelkupfer für den siebenten Band der ersten
(rechtmäßigeni Gesamtausgabe seiner Werke (Leipzig, Göschen, 1790),
der das Faustfragment enthält, stechen.
(Kunstfreunde, die Goethe-Verehrer sind, ohne doch mit der
ganzen Spezialliteratur über den Dichter vertraut zu sein, dürfte es
interessieren, daß ein — bei Payer v. Thurn abgebildeter — Holzschnitt
von Hans Weiditz aus Petrarcas 1532 bei Heinrich Steiner in Augsburg
erschienenem »Glücksbuch« Goethe die Idee zu seinem »Schatzgräber«
gegeben hat.)
Das Buch ist sehr gut ausgestattet. Besonders lallen die vielen
Lichtdrucke auf, die im Hinblick auf den künstlerischen Wert und die
Technik der Abbildungen nicht immer notwendig gewesen und die auch
nicht immer gelungen sind.
Zum Schlüsse kann ich, obwohl mich diese Seite der Angelegen-
heit und noch dazu an dieser Stelle durchaus nichts angeht, mein
Befremden darüber nicht unterdrücken, daß diese Abhandlung als Gabe
eines Bibliophilen-Vereines verwendet wurde. Man mißverstehe mich
nicht: ich halte sie für eine höchst dankenswerte, gediegene und auf-
schlußreiche Arbeit und freue mich aufrichtig darüber, daß sie gut aus-
gestattet erscheinen konnte. Aber unter einer Prämie für Bibliophilen
habe ich mir eben immer etwas anderes, ganz was anderes vorgestellt: ein
Bücherkleinod, das durch Inhalt und Form das Herz des künstlerischen
wie des literarischen Feinschmeckers höher schlagen läßt. Weil Goethes
Name schon erklungen ist: etwa die von meinem Freunde Dr. Rudolf Junk
mit so sicherem Feingefühl ausgewählten und mit so vollendeter Kunst in
Holz geschnittenen paar Goethelieder, von denen Proben aut der vorletzten
Ausstellung der »Sezession« zu sehen waren! Arpad Wetxlifärtner-
Hans W. Singer, Die moderne Graphik. Eine Dar-
stellung für deren Freunde und Sammler. 548Seiten. Leipzig,
Ed. Seemann, 1914.
Das Buch erhebt den Anspruch, einigermaßen lesbar zu sein und
als Ratgeber für den Sammler zu gelten; ich warne Neugierige und führe
in dieser Absicht einige Beispiele an.
Der Verfasser meint, man solle Deverias und Delacroix' Graphik
nicht sammeln, denn »der Sammler, dem es wirklich um graphische Werke
zu tun ist, kann getrost beider entraten« (S. 24). »Man sammle immerhin
Corotsche Radierungen.....aber man betrüge sich nicht sslbst mit der
Annahme, daß man dabei Kunst pflegt oder sich wirklichen Kunstgenuß
verschafft« (S. 26). Manets Graphik zu sammeln, ist auch nicht das
Richtige, denn »hatte er ein wirklich natürliches graphisches Gefühl be-
sessen, so hätte er aller Wahrscheinlichkeit nach, als er die Werkzeuge
des Radierers in die Hand bekam, gar nicht erst auf seine Gemälde zurück-
gegriffen. Er bat dagegen sogar auch Velasquez reproduziert« (S. 36/37).
Werjwird noch ein graphisches Blatt von Edvard Manch erwerben wollen,
wenn er schaudernd erfährt, daß Munch »das Gefühl des Publikums miß-
achtete und schließlich auch seineKunst, da enhrnur seine Willkür weihte,
nicht aber auch Selbstzucht und Arbeitskraft opferte« (S. 429).
Was soll man denn sammeln? Z. B. Farbenholzschnitte von
Gusty von Becker, »die mit (sie) das Eigenartigste und Bestrickendste
lieferte (sie), was es auf diesem Gebiet gab. Jedenfalls sind die Farben-
drucke der Frau Becker etwas Außergewöhnliches« (S.226). Oder Arbeiten
von Dora Seifert, dena »besonders gelangen ihr einige landschaftliche
Blätter, die zu den farbenfrischesten gehören, was ich (der Verfasser!!)
auf diesem Gebiete kenne« (S. 231). Man bedenke, daß das Buch das
»Ergebnis einer fast fünfundzwanzigjährigen Tätigkeit« (Vorwort) ist.
Womit verschafft man sich sonst noch wirklichen Kunstgenuß? Offenbar
mit der Graphik Carl Weidemeyers, denn ('ich zitiere selbstverständlich
wörtlich) »der Künstler, der hinter der Arbeit steckt, ein Meister, der alles
gerade ein bißchen anders siej.it als wir andern, der uns daher etwas
Neues bietet, ist es natürlich, der uns am meisten entzückt. Aber auch
derVortrag, dieses Zurschaustellen einerverständigen, sinngemäßen Hand-
habung des Messers auf dem Holzstock, die Auflösung des Vorwurfes in
ein Linienspiel, das sich einschmeichelnd eben diesem Messer unterstellt,
sind starke Aktiva in der Bilanz unserer Rechenschaft über die Werte
dieser Kunst« (S. 222). Auch Paul Herrmann ist der richtige Mann, denn
»es beliebt ihm nicht, seine wohlverstandene Zeichnung und Modellierung
durch einen ruddeligen Vortrag zu paralysieren« (S. 134). Weltis Vor-
trag aber ist »muddelig« (S. 90) und der Verfasser hält mit der Ansicht
nicht zurück, »daß viele der Menschen auf seinen Bildern ^schlecht ge-
rochen haben müssen<*.
Das interessiert den Sammler gewiß außerordentlich und bringt die
persönliche Note des Verfassers zur Geltung. Ein starkes Aktivum in der
Bilanz unserer Rechenschaft über die^Werte dieser persönlichen Dar-
stellungsweise sind auch die Worte, die Liebermann »zum Werkzeug
sagte: reim dich, oder ich freß dich« (S. 110). Der Arme! »Er wollte pastos
und freilichtig radieren, sozusagen«.
Vom Thema über die Eignung des Malers oder Kunsthistorikers
zum Museumsleiter handelt der Verfasser ausführlich auf Seite 84—86.
»Von diesem Werke wurde eine mit vier Originalradierungen aus-
gestattete Vorzugsausgabe hergestellt in zweihundert Exemplaren«.
F. M. Haberditzl.
. alle
61