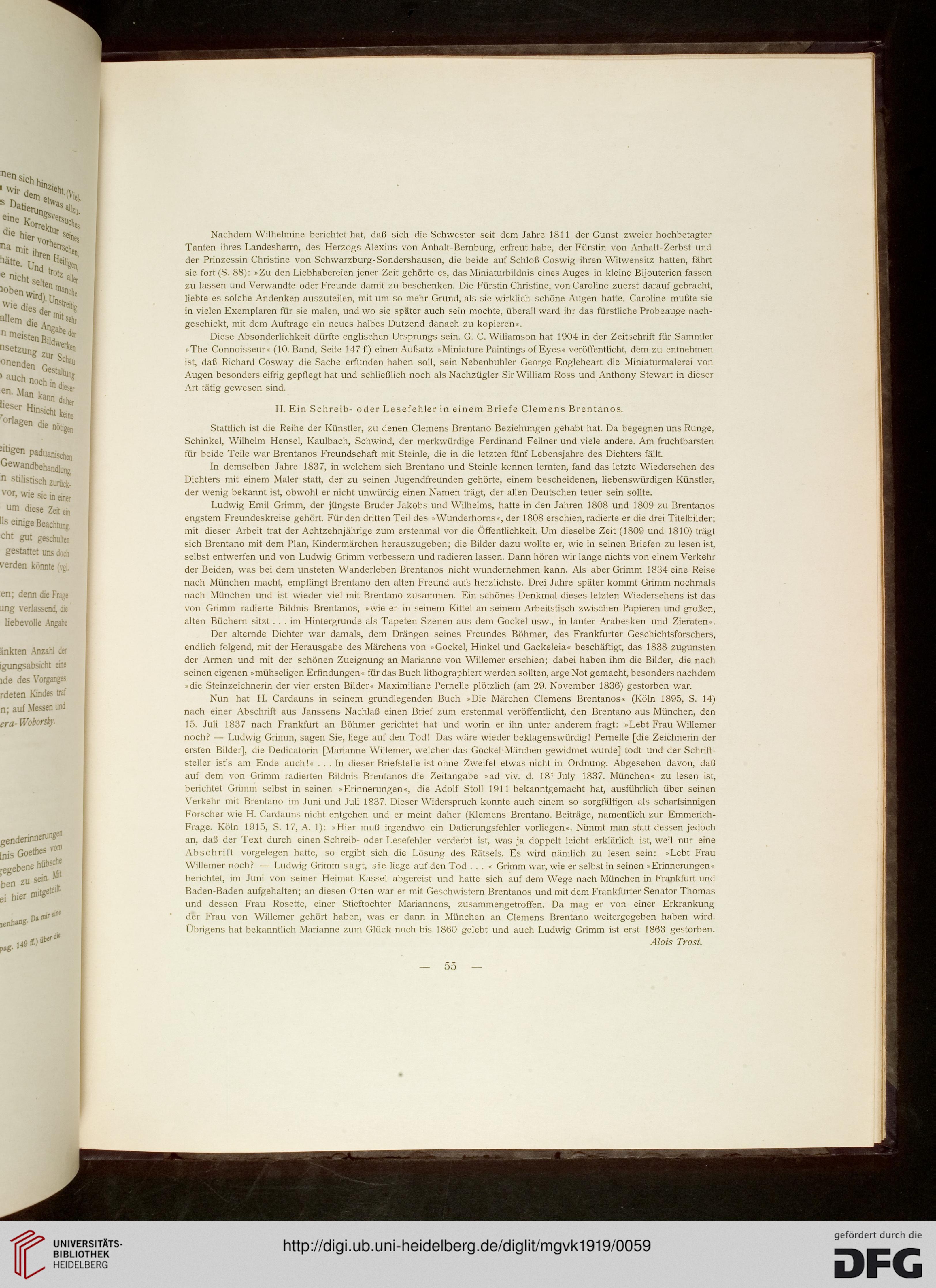316,1 sich w
«nicht SeIte^a,,er
U',e^sd;L"SS
«Mem die a m,ts*r
onenden r hh
» auch eStalS
noch in diese
en. .Man l. er
'::»'-£
°rlagen * notige„
J» Paduanischea
Ge«'andbehandlung,
n stilistisch zurücfc.
vor» wie sie iaana
um diese Zeit ein
lls einige Beachtung.
cht gut geschulten
gestattet un-
i'erden könnte (»gl
en; denn die Frage
ing verlassend, die
liebevolle .Angabe
inkten .Anzahl der
igungsabsicht eine
ide des Vorganges
rdeten Kindes traf
n; auf Messen und
era-Woborsty-
gendennnerunge»
tais Goethes vo»
«»»*&
ben zu sein- >
\ hiermit31
Nachdem Wilhelmine berichtet hat, daß sich die Schwester seit dem Jahre 1811 der Gunst zweier hochbetagter
Tanten ihres Landesherrn, des Herzogs Alexius von Anhalt-Bernburg, erfreut habe, der Fürstin von Anhalt-Zerbst und
der Prinzessin Christine von Schwarzburg-Sondershausen, die beide auf Schloß Coswig ihren Witwensitz hatten, fährt
sie fort (S. 88): »Zu den Liebhabereien jener Zeit gehörte es, das Miniaturbildnis eines Auges in kleine Bijouterien fassen
zu lassen und Verwandte oder Freunde damit zu beschenken. Die Fürstin Christine, von Caroline zuerst darauf gebracht,
liebte es solche Andenken auszuteilen, mit um so mehr Grund, als sie wirklich schöne Augen hatte. Caroline mußte sie
in vielen Exemplaren für sie malen, und wo sie später auch sein mochte, überall ward ihr das fürstliche Probeauge nach-
geschickt, mit dem Auftrage ein neues halbes Dutzend danach zu kopieren«.
Diese Absonderlichkeit dürfte englischen Ursprungs sein. G. C. Wiliamson hat 1904 in der Zeitschrift für Sammler
»The Connoisseur« (10. Band, Seite 147 f.) einen Aufsatz »Miniature Paintings of Eyes« veröffentlicht, dem zu entnehmen
ist, daß Richard Cosway die Sache erfunden haben soll, sein Nebenbuhler George Engleheart die Miniaturmalerei von
Augen besonders eifrig gepflegt hat und schließlich noch als Nachzügler Sir William Ross und Anthony Stewart in dieser
Art tätig gewesen sind.
II. Ein Schreib- oder Lesefehler in einem Briefe Clemens Brentanos.
Stattlich ist die Reihe der Künstler, zu denen Clemens Brentano Beziehungen gehabt hat. Da begegnen uns Runge,
Schinkel, Wilhelm Hensel, Kaulbach, Schwind, der merkwürdige Ferdinand Fellner und viele andere. Am fruchtbarsten
für beide Teile war Brentanos Freundschaft mit Steinle, die in die letzten fünf Lebensjahre des Dichters fällt.
In demselben Jahre 1837, in welchem sich Brentano und Steinle kennen lernten, fand das letzte Wiedersehen des
Dichters mit einem Maler statt, der zu seinen Jugendfreunden gehörte, einem bescheidenen, liebenswürdigen Künstler,
der wenig bekannt ist, obwohl er nicht unwürdig einen Namen trägt, der allen Deutschen teuer sein sollte.
Ludwig Emil Grimm, der jüngste Bruder Jakobs und Wilhelms, hatte in den Jahren 1808 und 1809 zu Brentanos
engstem Freundeskreise gehört. Für den dritten Teil des »Wunderhorns«, der 1808 erschien, radierte er die drei Titelbilder,
mit dieser Arbeit trat der Achtzehnjährige zum erstenmal vor die Öffentlichkeit. Um dieselbe Zeit (1809 und 1810) trägt
sich Brentano mit dem Plan, Kindermärchen herauszugeben; die Bilder dazu wollte er, wie in seinen Briefen zu lesen ist,
selbst entwerfen und von Ludwig Grimm verbessern und radieren lassen. Dann hören wir lange nichts von einem Verkehr
der Beiden, was bei dem unsteten Wanderleben Brentanos nicht wundernehmen kann. Als aber Grimm 1834 eine Reise
nach München macht, empfängt Brentano den alten Freund aufs herzlichste. Drei Jahre später kommt Grimm nochmals
nach München und ist wieder viel mit Brentano zusammen. Ein schönes Denkmal dieses letzten Wiedersehens ist das
von Grimm radierte Bildnis Brentanos, »wie er in seinem Kittel an seinem Arbeitstisch zwischen Papieren und großen,
alten Büchern sitzt ... im Hintergrunde als Tapeten Szenen aus dem Gockel usw., in lauter Arabesken und Zieraten«.
Der alternde Dichter war damals, dem Drängen seines Freundes Böhmer, des Frankfurter Geschichtsforschers,
endlich folgend, mit der Herausgabe des Märchens von »Gockel, Hinkel und Gackeleia« beschäftigt, das 1838 zugunsten
der Armen und mit der schönen Zueignung an Marianne von Willemer erschien; dabei haben ihm die Bilder, die nach
seinen eigenen »mühseligen Erfindungen« für das Buch lithographiert werden sollten, arge Not gemacht, besonders nachdem
»die Steinzeichnerin der vier ersten Bilder« Maximiliane Pernelle plötzlich (am 29. November 1836) gestorben war.
Nun hat H. Cardauns in seinem grundlegenden Buch »Die Märchen Clemens Brentanos« (Köln 1895, S. 14)
nach einer Abschrift aus Janssens Nachlaß einen Brief zum erstenmal veröffentlicht, den Brentano aus München, den
15. Juli 1837 nach Frankfurt an Böhmer gerichtet hat und worin er ihn unter anderem fragt: »Lebt Frau Willemer
noch? — Ludwig Grimm, sagen Sie, liege auf den Tod! Das wäre wieder beklagenswürdig! Pernelle [die Zeichnerin der
ersten Bilder], die Dedicatorin [Marianne Willemer, welcher das Gockel-Märchen gewidmet wurde] todt und der Schrift-
steller ist's am Ende auch!« ... In dieser Briefstelle ist ohne Zweifel etwas nicht in Ordnung. Abgesehen davon, daß
auf dem von Grimm radierten Bildnis Brentanos die Zeitangabe »ad viv. d. 18' July 1837. München« zu lesen ist,
berichtet Grimm selbst in seinen »Erinnerungen«, die Adolf Stoll 1911 bekanntgemacht hat, ausführlich über seinen
Verkehr mit Brentano im Juni und Juli 1837. Dieser Widerspruch konnte auch einem so sorgfältigen als scharfsinnigen
Forscher wie H. Cardauns nicht entgehen und er meint daher (Klemens Brentano. Beiträge, namentlich zur Emmerich-
Frage. Köln 1915, S. 17, A. 1): »Hier muß irgendwo ein Datierungsfehler vorliegen«. Nimmt man statt dessen jedoch
an, daß der Text durch einen Schreib- oder Lesefehler verderbt ist, was ja doppelt leicht erklärlich ist, weil nur eine
Abschrift vorgelegen hatte, so ergibt sich die Lösung des Rätsels. Es wird nämlich zu lesen sein: »Lebt Frau
Willemer noch? — Ludwig Grimm sagt, sie liege aufdenTod . . . « Grimm war, wie er selbst in seinen »Erinnerungen«
berichtet, im Juni von seiner Heimat Kassel abgereist und hatte sich auf dem Wege nach München in Frankfurt und
Baden-Baden aufgehalten; an diesen Orten war er mit Geschwistern Brentanos und mit dem Frankfurter Senator Thomas
und dessen Frau Rosette, einer Stieftochter Mariannens, zusammengetroffen. Da mag er von einer Erkrankung
der Frau von Willemer gehört haben, was er dann in München an Clemens Brentano weitergegeben haben wird.
Übrigens hat bekanntlich Marianne zum Glück noch bis 1860 gelebt und auch Ludwig Grimm ist erst 1863 gestorben.
Alois Trost.
— 55 —
«nicht SeIte^a,,er
U',e^sd;L"SS
«Mem die a m,ts*r
onenden r hh
» auch eStalS
noch in diese
en. .Man l. er
'::»'-£
°rlagen * notige„
J» Paduanischea
Ge«'andbehandlung,
n stilistisch zurücfc.
vor» wie sie iaana
um diese Zeit ein
lls einige Beachtung.
cht gut geschulten
gestattet un-
i'erden könnte (»gl
en; denn die Frage
ing verlassend, die
liebevolle .Angabe
inkten .Anzahl der
igungsabsicht eine
ide des Vorganges
rdeten Kindes traf
n; auf Messen und
era-Woborsty-
gendennnerunge»
tais Goethes vo»
«»»*&
ben zu sein- >
\ hiermit31
Nachdem Wilhelmine berichtet hat, daß sich die Schwester seit dem Jahre 1811 der Gunst zweier hochbetagter
Tanten ihres Landesherrn, des Herzogs Alexius von Anhalt-Bernburg, erfreut habe, der Fürstin von Anhalt-Zerbst und
der Prinzessin Christine von Schwarzburg-Sondershausen, die beide auf Schloß Coswig ihren Witwensitz hatten, fährt
sie fort (S. 88): »Zu den Liebhabereien jener Zeit gehörte es, das Miniaturbildnis eines Auges in kleine Bijouterien fassen
zu lassen und Verwandte oder Freunde damit zu beschenken. Die Fürstin Christine, von Caroline zuerst darauf gebracht,
liebte es solche Andenken auszuteilen, mit um so mehr Grund, als sie wirklich schöne Augen hatte. Caroline mußte sie
in vielen Exemplaren für sie malen, und wo sie später auch sein mochte, überall ward ihr das fürstliche Probeauge nach-
geschickt, mit dem Auftrage ein neues halbes Dutzend danach zu kopieren«.
Diese Absonderlichkeit dürfte englischen Ursprungs sein. G. C. Wiliamson hat 1904 in der Zeitschrift für Sammler
»The Connoisseur« (10. Band, Seite 147 f.) einen Aufsatz »Miniature Paintings of Eyes« veröffentlicht, dem zu entnehmen
ist, daß Richard Cosway die Sache erfunden haben soll, sein Nebenbuhler George Engleheart die Miniaturmalerei von
Augen besonders eifrig gepflegt hat und schließlich noch als Nachzügler Sir William Ross und Anthony Stewart in dieser
Art tätig gewesen sind.
II. Ein Schreib- oder Lesefehler in einem Briefe Clemens Brentanos.
Stattlich ist die Reihe der Künstler, zu denen Clemens Brentano Beziehungen gehabt hat. Da begegnen uns Runge,
Schinkel, Wilhelm Hensel, Kaulbach, Schwind, der merkwürdige Ferdinand Fellner und viele andere. Am fruchtbarsten
für beide Teile war Brentanos Freundschaft mit Steinle, die in die letzten fünf Lebensjahre des Dichters fällt.
In demselben Jahre 1837, in welchem sich Brentano und Steinle kennen lernten, fand das letzte Wiedersehen des
Dichters mit einem Maler statt, der zu seinen Jugendfreunden gehörte, einem bescheidenen, liebenswürdigen Künstler,
der wenig bekannt ist, obwohl er nicht unwürdig einen Namen trägt, der allen Deutschen teuer sein sollte.
Ludwig Emil Grimm, der jüngste Bruder Jakobs und Wilhelms, hatte in den Jahren 1808 und 1809 zu Brentanos
engstem Freundeskreise gehört. Für den dritten Teil des »Wunderhorns«, der 1808 erschien, radierte er die drei Titelbilder,
mit dieser Arbeit trat der Achtzehnjährige zum erstenmal vor die Öffentlichkeit. Um dieselbe Zeit (1809 und 1810) trägt
sich Brentano mit dem Plan, Kindermärchen herauszugeben; die Bilder dazu wollte er, wie in seinen Briefen zu lesen ist,
selbst entwerfen und von Ludwig Grimm verbessern und radieren lassen. Dann hören wir lange nichts von einem Verkehr
der Beiden, was bei dem unsteten Wanderleben Brentanos nicht wundernehmen kann. Als aber Grimm 1834 eine Reise
nach München macht, empfängt Brentano den alten Freund aufs herzlichste. Drei Jahre später kommt Grimm nochmals
nach München und ist wieder viel mit Brentano zusammen. Ein schönes Denkmal dieses letzten Wiedersehens ist das
von Grimm radierte Bildnis Brentanos, »wie er in seinem Kittel an seinem Arbeitstisch zwischen Papieren und großen,
alten Büchern sitzt ... im Hintergrunde als Tapeten Szenen aus dem Gockel usw., in lauter Arabesken und Zieraten«.
Der alternde Dichter war damals, dem Drängen seines Freundes Böhmer, des Frankfurter Geschichtsforschers,
endlich folgend, mit der Herausgabe des Märchens von »Gockel, Hinkel und Gackeleia« beschäftigt, das 1838 zugunsten
der Armen und mit der schönen Zueignung an Marianne von Willemer erschien; dabei haben ihm die Bilder, die nach
seinen eigenen »mühseligen Erfindungen« für das Buch lithographiert werden sollten, arge Not gemacht, besonders nachdem
»die Steinzeichnerin der vier ersten Bilder« Maximiliane Pernelle plötzlich (am 29. November 1836) gestorben war.
Nun hat H. Cardauns in seinem grundlegenden Buch »Die Märchen Clemens Brentanos« (Köln 1895, S. 14)
nach einer Abschrift aus Janssens Nachlaß einen Brief zum erstenmal veröffentlicht, den Brentano aus München, den
15. Juli 1837 nach Frankfurt an Böhmer gerichtet hat und worin er ihn unter anderem fragt: »Lebt Frau Willemer
noch? — Ludwig Grimm, sagen Sie, liege auf den Tod! Das wäre wieder beklagenswürdig! Pernelle [die Zeichnerin der
ersten Bilder], die Dedicatorin [Marianne Willemer, welcher das Gockel-Märchen gewidmet wurde] todt und der Schrift-
steller ist's am Ende auch!« ... In dieser Briefstelle ist ohne Zweifel etwas nicht in Ordnung. Abgesehen davon, daß
auf dem von Grimm radierten Bildnis Brentanos die Zeitangabe »ad viv. d. 18' July 1837. München« zu lesen ist,
berichtet Grimm selbst in seinen »Erinnerungen«, die Adolf Stoll 1911 bekanntgemacht hat, ausführlich über seinen
Verkehr mit Brentano im Juni und Juli 1837. Dieser Widerspruch konnte auch einem so sorgfältigen als scharfsinnigen
Forscher wie H. Cardauns nicht entgehen und er meint daher (Klemens Brentano. Beiträge, namentlich zur Emmerich-
Frage. Köln 1915, S. 17, A. 1): »Hier muß irgendwo ein Datierungsfehler vorliegen«. Nimmt man statt dessen jedoch
an, daß der Text durch einen Schreib- oder Lesefehler verderbt ist, was ja doppelt leicht erklärlich ist, weil nur eine
Abschrift vorgelegen hatte, so ergibt sich die Lösung des Rätsels. Es wird nämlich zu lesen sein: »Lebt Frau
Willemer noch? — Ludwig Grimm sagt, sie liege aufdenTod . . . « Grimm war, wie er selbst in seinen »Erinnerungen«
berichtet, im Juni von seiner Heimat Kassel abgereist und hatte sich auf dem Wege nach München in Frankfurt und
Baden-Baden aufgehalten; an diesen Orten war er mit Geschwistern Brentanos und mit dem Frankfurter Senator Thomas
und dessen Frau Rosette, einer Stieftochter Mariannens, zusammengetroffen. Da mag er von einer Erkrankung
der Frau von Willemer gehört haben, was er dann in München an Clemens Brentano weitergegeben haben wird.
Übrigens hat bekanntlich Marianne zum Glück noch bis 1860 gelebt und auch Ludwig Grimm ist erst 1863 gestorben.
Alois Trost.
— 55 —