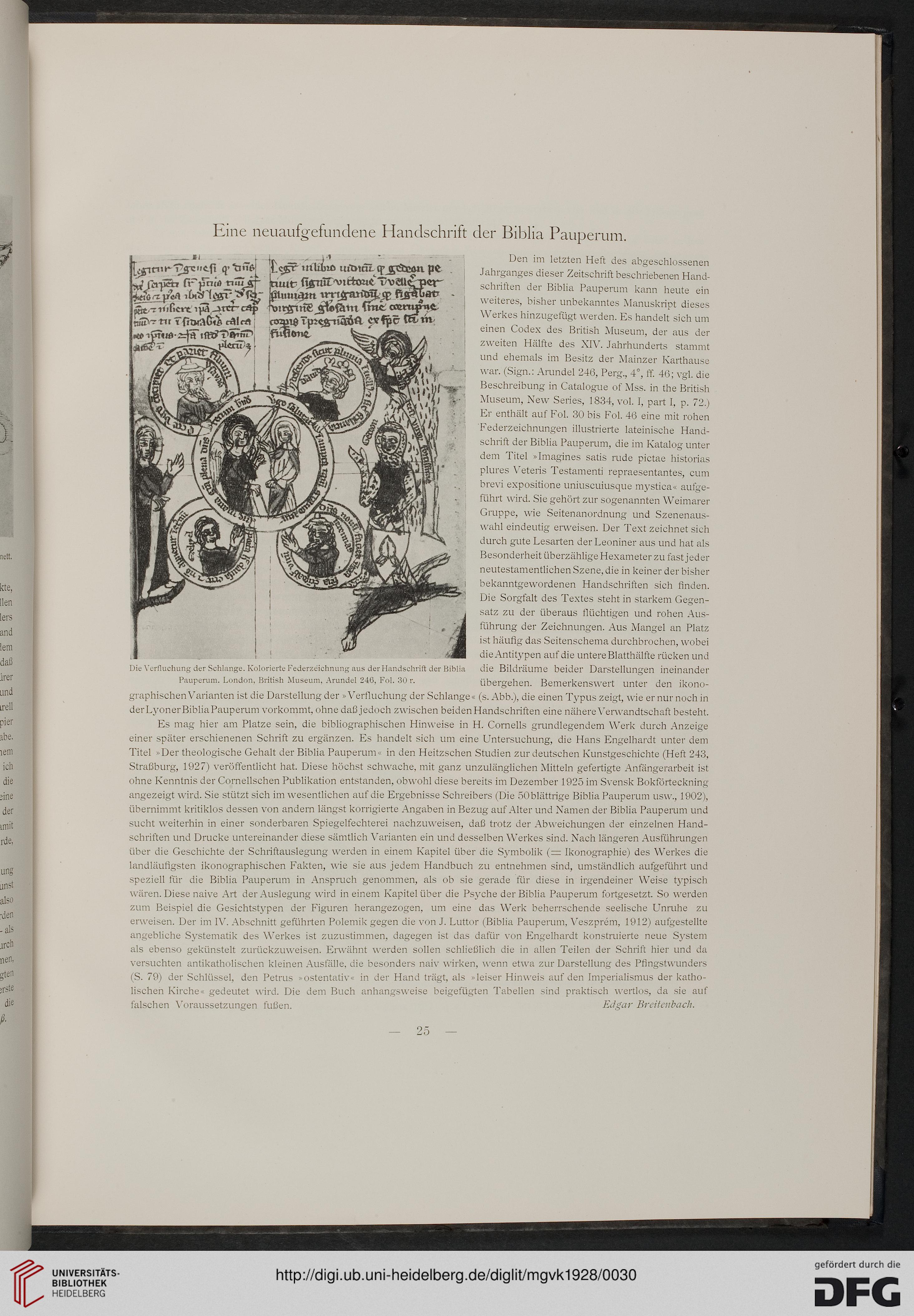Eine neuaufgefundene Handschrift der Biblia Pauperum.
Den im letzten Heft des abgeschlossenen
Jahrganges dieser Zeitschrift beschriebenen Hand-
schriften der Biblia Pauperum kann heute ein
weiteres, bisher unbekanntes Manuskript dieses
Werkes hinzugefügt werden. Es handelt sich um
einen Codex des British Museum, der aus der
zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts stammt
und ehemals im Besitz der Mainzer Karthause
w ar. (Sign.: Arundel 240, Perg., 4°, ff. 46; vgl. die
Beschreibung in Catalogue of Mss. in the British
Museum, New Series, 1834, vol. I, pari I, p. 72.)
Er enthält auf Fol. 30 bis Fol. 46 eine mit rohen
Federzeichnungen illustrierte lateinische Hand-
schrift der Biblia Pauperum, die im Katalog unter
dem Titel »Imagines satis rude pictae historias
plures Veteris Testament! repraesentantes, cum
brevi expositione uniuscuiusque mystica« aufge-
führt wird. Sie gehört zur sogenannten Weimarer
Gruppe, wie Seitenanordnung und Szenenaus-
wahl eindeutig erweisen. Der Text zeichnet sich
durch gute Lesarten der Leoniner aus und hat als
Besonderheit überzählige Hexameter zu fast jeder
neutestamentlichen Szene, die in keiner der bisher
bekanntgewordenen Handschriften sich finden.
Die Sorgfalt des Textes steht in starkem Gegen-
satz zu der überaus flüchtigen und rohen Aus-
führung der Zeichnungen. Aus Mangel an Platz
ist häufig das Seitenschema durchbrochen, wobei
dieAntitypen auf die untere Blatthälfte rücken und
Die Verfluchung der Schlange. Kolorierte Federzeichnung aus der Handschrift der Biblia die Bildräume beider Darstellungen ineinander
P:uiperum. London, British Museum, Arundel 246, Fol. 30 r. übergehen. Bemerkenswert unter den ikono-
graphischen Varianten ist die Darstellung der »Verfluchung der Schlange« (s. Abb.), die einen Typus zeigt, wie er nur noch in
der Lyoner Biblia Pauperum vorkommt, ohne daß jedoch zwischen beiden Handschriften eine nähere Verwandtschaft besteht.
Es mag hier am Platze sein, die bibliographischen Hinweise in H. Cornells grundlegendem Werk durch Anzeige
einer später erschienenen Schrift zu ergänzen. Es handelt sich um eine Untersuchung, die Hans Engelhardt unter dem
Titel »Der theologische Gehalt der Biblia Pauperum« in den Heitzschen Studien zur deutschen Kunstgeschichte (Heft 243,
Straßburg, 1927) veröffentlicht hat. Diese höchst schwache, mit ganz unzulänglichen Mitteln gefertigte Anfängerarbeit ist
ohne Kenntnis der Comellschen Publikation entstanden, obwohl diese bereits im Dezember 1925 im Svensk Boktorteckning
angezeigt wird. Sie stützt sich im wesentlichen auf die Ergebnisse Schreibers (Die 50blättrige Biblia Pauperum usw., 1902),
übernimmt kritiklos dessen von andern längst korrigierte Angaben in Bezug auf Alter und Namen der Biblia Pauperum und
sucht weiterhin in einer sonderbaren Spiegelfechterei nachzuweisen, daß trotz der Abw eichungen der einzelnen Hand-
schriften und Drucke untereinander diese sämtlich Varianten ein und desselben Werkes sind. Nach längeren Ausführungen
über die Geschichte der Schriftauslegung werden in einem Kapitel über die Symbolik (= Ikonographie) des Werkes die
landläufigsten ikonographischen Fakten, wie sie aus jedem Handbuch zu entnehmen sind, umständlich aufgeführt und
speziell für die Biblia Pauperum in Anspruch genommen, als ob sie gerade für diese in irgendeiner Weise typisch
wären. Diese naive Art der Auslegung wird in einem Kapitel über die Psyche der Biblia Pauperum fortgesetzt. So werden
zum Beispiel die Gesichtstypen der Figuren herangezogen, um eine das Werk beherrschende seelische Llnruhe zu
erweisen. Der im IV. Abschnitt geführten Polemik gegen die von J. Luttor (Biblia Pauperum, Veszprem, 1912) aufgestellte
angebliche Systematik des Werkes ist zuzustimmen, dagegen ist das dafür von Engelhardt konstruierte neue System
als ebenso gekünstelt zurückzuweisen. Erwähnt werden sollen schließlich die in allen Teilen der Schrift hier und da
versuchten antikatholischen kleinen Ausfälle, die besonders naiv wirken, wenn etwa zur Darstellung des Pfingstwunders
(S. 79) der Schlüssel, den Petrus »ostentativ« in der Hand trägt, als »leiser Hinweis auf den Imperialismus der katho-
lischen Kirche« gedeutet wird. Die dem Buch anhangsweise beigefügten Tabellen sind praktisch wertlos, da sie auf
falschen Voraussetzungen fußen. Edgar Breitenbach.
— 25 —
Den im letzten Heft des abgeschlossenen
Jahrganges dieser Zeitschrift beschriebenen Hand-
schriften der Biblia Pauperum kann heute ein
weiteres, bisher unbekanntes Manuskript dieses
Werkes hinzugefügt werden. Es handelt sich um
einen Codex des British Museum, der aus der
zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts stammt
und ehemals im Besitz der Mainzer Karthause
w ar. (Sign.: Arundel 240, Perg., 4°, ff. 46; vgl. die
Beschreibung in Catalogue of Mss. in the British
Museum, New Series, 1834, vol. I, pari I, p. 72.)
Er enthält auf Fol. 30 bis Fol. 46 eine mit rohen
Federzeichnungen illustrierte lateinische Hand-
schrift der Biblia Pauperum, die im Katalog unter
dem Titel »Imagines satis rude pictae historias
plures Veteris Testament! repraesentantes, cum
brevi expositione uniuscuiusque mystica« aufge-
führt wird. Sie gehört zur sogenannten Weimarer
Gruppe, wie Seitenanordnung und Szenenaus-
wahl eindeutig erweisen. Der Text zeichnet sich
durch gute Lesarten der Leoniner aus und hat als
Besonderheit überzählige Hexameter zu fast jeder
neutestamentlichen Szene, die in keiner der bisher
bekanntgewordenen Handschriften sich finden.
Die Sorgfalt des Textes steht in starkem Gegen-
satz zu der überaus flüchtigen und rohen Aus-
führung der Zeichnungen. Aus Mangel an Platz
ist häufig das Seitenschema durchbrochen, wobei
dieAntitypen auf die untere Blatthälfte rücken und
Die Verfluchung der Schlange. Kolorierte Federzeichnung aus der Handschrift der Biblia die Bildräume beider Darstellungen ineinander
P:uiperum. London, British Museum, Arundel 246, Fol. 30 r. übergehen. Bemerkenswert unter den ikono-
graphischen Varianten ist die Darstellung der »Verfluchung der Schlange« (s. Abb.), die einen Typus zeigt, wie er nur noch in
der Lyoner Biblia Pauperum vorkommt, ohne daß jedoch zwischen beiden Handschriften eine nähere Verwandtschaft besteht.
Es mag hier am Platze sein, die bibliographischen Hinweise in H. Cornells grundlegendem Werk durch Anzeige
einer später erschienenen Schrift zu ergänzen. Es handelt sich um eine Untersuchung, die Hans Engelhardt unter dem
Titel »Der theologische Gehalt der Biblia Pauperum« in den Heitzschen Studien zur deutschen Kunstgeschichte (Heft 243,
Straßburg, 1927) veröffentlicht hat. Diese höchst schwache, mit ganz unzulänglichen Mitteln gefertigte Anfängerarbeit ist
ohne Kenntnis der Comellschen Publikation entstanden, obwohl diese bereits im Dezember 1925 im Svensk Boktorteckning
angezeigt wird. Sie stützt sich im wesentlichen auf die Ergebnisse Schreibers (Die 50blättrige Biblia Pauperum usw., 1902),
übernimmt kritiklos dessen von andern längst korrigierte Angaben in Bezug auf Alter und Namen der Biblia Pauperum und
sucht weiterhin in einer sonderbaren Spiegelfechterei nachzuweisen, daß trotz der Abw eichungen der einzelnen Hand-
schriften und Drucke untereinander diese sämtlich Varianten ein und desselben Werkes sind. Nach längeren Ausführungen
über die Geschichte der Schriftauslegung werden in einem Kapitel über die Symbolik (= Ikonographie) des Werkes die
landläufigsten ikonographischen Fakten, wie sie aus jedem Handbuch zu entnehmen sind, umständlich aufgeführt und
speziell für die Biblia Pauperum in Anspruch genommen, als ob sie gerade für diese in irgendeiner Weise typisch
wären. Diese naive Art der Auslegung wird in einem Kapitel über die Psyche der Biblia Pauperum fortgesetzt. So werden
zum Beispiel die Gesichtstypen der Figuren herangezogen, um eine das Werk beherrschende seelische Llnruhe zu
erweisen. Der im IV. Abschnitt geführten Polemik gegen die von J. Luttor (Biblia Pauperum, Veszprem, 1912) aufgestellte
angebliche Systematik des Werkes ist zuzustimmen, dagegen ist das dafür von Engelhardt konstruierte neue System
als ebenso gekünstelt zurückzuweisen. Erwähnt werden sollen schließlich die in allen Teilen der Schrift hier und da
versuchten antikatholischen kleinen Ausfälle, die besonders naiv wirken, wenn etwa zur Darstellung des Pfingstwunders
(S. 79) der Schlüssel, den Petrus »ostentativ« in der Hand trägt, als »leiser Hinweis auf den Imperialismus der katho-
lischen Kirche« gedeutet wird. Die dem Buch anhangsweise beigefügten Tabellen sind praktisch wertlos, da sie auf
falschen Voraussetzungen fußen. Edgar Breitenbach.
— 25 —