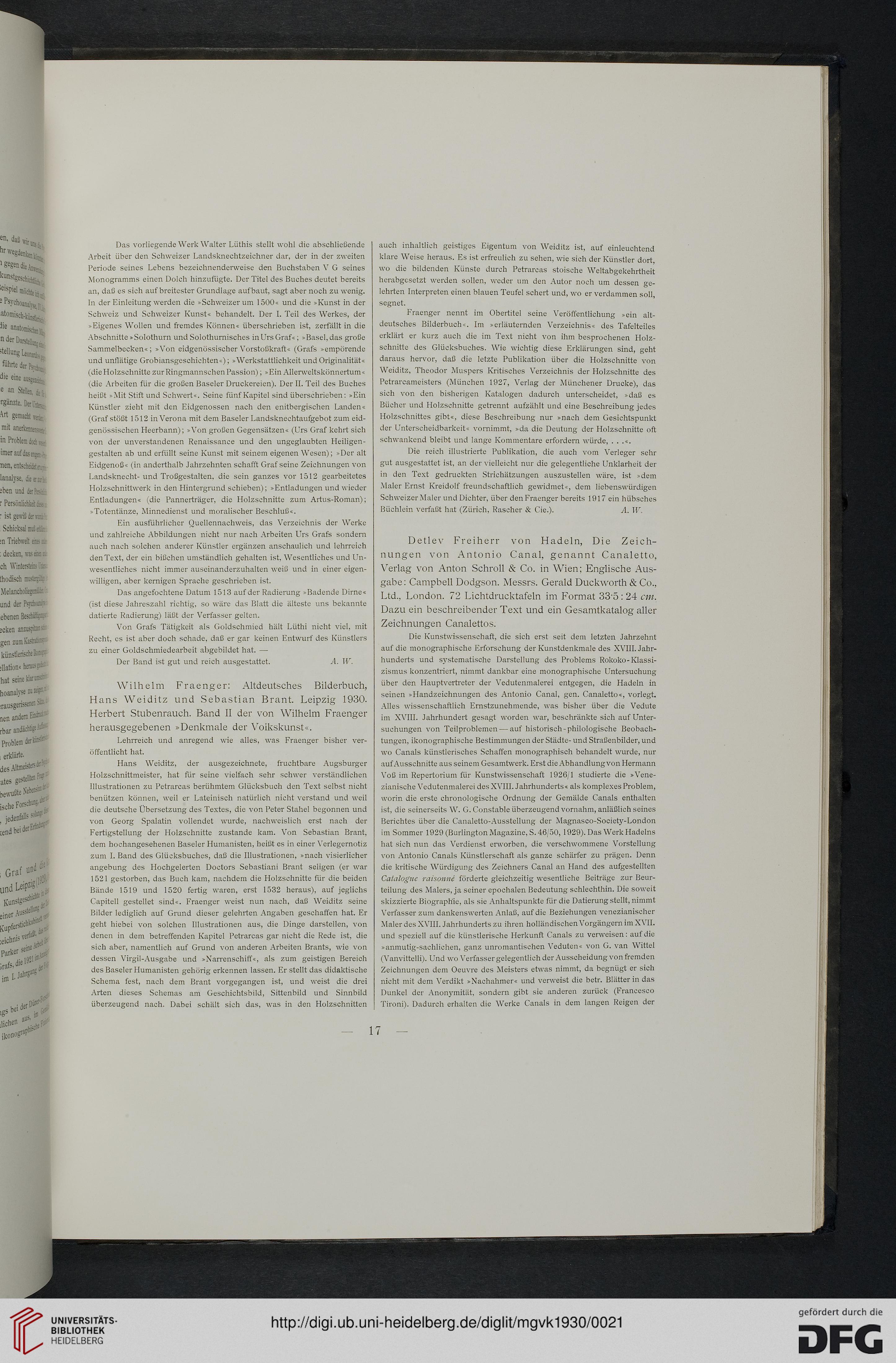Das vorliegende Werk Walter Lüthis stellt wohl die abschließende
Arbeit über den Schweizer Landsknechtzeichner dar, der in der zweiten
Periode seines Lebens bezeichnenderweise den Buchstaben V G seines
Monogramms einen Dolch hinzufügte. Der Titel des Buches deutet bereits
an, daß es sich auf breitester Grundlage aufbaut, sagt aber noch zu wenig.
In der Einleitung werden die »Schweizer um 1500« und die »Kunst in der
Schweiz und Schweizer Kunst« behandelt. Der I. Teil des Werkes, der
»Eigenes Wollen und fremdes Können« überschrieben ist, zerfällt in die
Abschnitte >SoIothurn und Solothurnisches in Urs Graf« ; »Basel, das große
Sammelbecken«; »Von eidgenössischer Vorstoßkraft« (Grafs »empörende
und unflätige Grobiansgeschichten«); »Werkstattlich keit und Originalität«
(dieHolzschnitte zur Ringmannschen Passion); »Ein Allerweltskönnertum«
(die Arbeiten für die großen Baseler Druckereien). Der II. Teil des Buches
heißt ».Mit Stift und Schwert«. Seine fünf Kapitel sind überschrieben: »Ein
Künstler zieht mit den Eidgenossen nach den enitbergischen Landen«
(Graf stößt 1512 in Verona mit dem Baseler Landsknechtaufgebot zum eid-
genössischen Heerbann); »Von großen Gegensätzen« (Urs Graf kehrt sich
von der unverstandenen Renaissance und den ungeglaubten Heiligen-
gestalten ab und erfüllt seine Kunst mit seinem eigenen Wesen); »Der alt
Eidgenoß« (in anderthalb Jahrzehnten schafft Graf seine Zeichnungen von
Landsknecht- und Troßgestalten, die sein ganzes vor 1512 gearbeitetes
Holzschnittwerk in den Hintergrund schieben); »Entladungen und wieder
Entladungen« (die Pannerträger, die Holzschnitte zum Artus-Roman);
»Totentänze, Minnedienst und moralischer Beschluß«.
Ein ausführlicher Quellennachweis, das Verzeichnis der Werke
und zahlreiche Abbildungen nicht nur nach Arbeiten Urs Grafs sondern
auch nach solchen anderer Künstler ergänzen anschaulich und lehrreich
denText, der ein bißchen umständlich gehalten ist. Wesentliches und Un-
wesentliches nicht immer auseinanderzuhalten weiß und in einer eigen-
willigen, aber kernigen Sprache geschrieben ist.
Das angefochtene Datum 1513 auf der Radierung »Badende Dirne«
(ist diese Jahreszahl richtig, so wäre das Blatt die älteste uns bekannte
datierte Radierung) läßt der Verfasser gelten.
Von Grafs Tätigkeit als Goldschmied hält Lüthi nicht viel, mit
Recht, es ist aber doch schade, daß er gar keinen Entwurf des Künstlers
zu einer Goldschmiedearbeit abgebildet hat. —
Der Band ist gut und reich ausgestattet. A. W.
Wilhelm Fr aenger: Altdeutsches Bilderbuch,
Hans Weiditz und Sebastian Brant. Leipzig 1930.
Herbert Stubenrauch. Band II der von Wilhelm Fraenger
herausgegebenen »Denkmale der Volkskunst«.
Lehrreich und anregend wie alles, was Fraenger bisher ver-
öffentlicht hat.
Hans Weiditz, der ausgezeichnete, fruchtbare Augsburger
Holzschnittmeister, hat für seine vielfach sehr schwer verständlichen
Illustrationen zu Petrarcas berühmtem Glücksbuch den Text selbst nicht
benützen können, weil er Lateinisch natürlich nicht verstand und weil
die deutsche Übersetzung des Textes, die von Peter Stahel begonnen und
von Georg Spalatin vollendet wurde, nachweislich erst nach der
Fertigstellung der Holzschnitte zustande kam. Von Sebastian Brant,
dem hochangesehenen Baseler Humanisten, heißt es in einer Verlegernotiz
zum I. Band des Glücksbuches, daß die Illustrationen, »nach visierlicher
angebung des Hochgelerten Doctors Sebastiani Brant seligen (er war
1521 gestorben, das Buch kam, nachdem die Holzschnitte für die beiden
Bände 1519 und 1520 fertig waren, erst 1532 heraus), auf jeglichs
Capitell gestellet sind«. Fraenger weist nun nach, daß Weiditz seine
Bilder lediglich auf Grund dieser gelehrten Angaben geschaffen hat. Er
geht hiebet von solchen Illustrationen aus, die Dinge darstellen, von
denen in dem betreffenden Kapitel Petrarcas gar nicht die Rede ist, die
sich aber, namentlich auf Grund von anderen Arbeiten Brants, wie von
dessen Virgil-Ausgabe und »Narrenschiff«, als zum geistigen Bereich
des Baseler Humanisten gehörig erkennen lassen. Er stellt das didaktische
Schema fest, nach dem Brant vorgegangen ist, und weist die drei
Arten dieses Schemas am Geschichtsbild, Sittenbild und Sinnbild
überzeugend nach. Dabei schält sich das, was in den Holzschnitten
auch inhaltlich geistiges Eigentum von Weiditz ist, auf einleuchtend
klare Weise heraus. Es ist erfreulich zu sehen, wie sich der Künstler dort
wo die bildenden Künste durch Petrarcas stoische Weltabgekehrtheit
herabgesetzt werden sollen, weder um den Autor noch um dessen ge-
lehrten Interpreten einen blauen Teufel schert und, wo er verdammen soll
segnet.
Fraenger nennt im Obertitel seine Veröffentlichung »ein alt-
deutsches Bilderbuch«. Im »erläuternden Verzeichnis« des Tafelteiles
erklärt er kurz auch die im Text nicht von ihm besprochenen Holz-
schnitte des Glücksbuches. Wie wichtig diese Erklärungen sind, geht
daraus hervor, daß die letzte Publikation über die Holzschnitte von
Weiditz, Theodor Muspers Kritisches Verzeichnis der Holzschnitte des
Petrarcameisters (München 1927, Verlag der Münchener Drucke), das
sich von den bisherigen Katalogen dadurch unterscheidet, »daß es
Bücher und Holzschnitte getrennt aufzählt und eine Beschreibung jedes
Holzschnittes gibt«, diese Beschreibung nur »nach dem Gesichtspunkt
der Unterscheidbarkeit« vornimmt, »da die Deutung der Holzschnitte oft
schwankend bleibt und lange Kommentare erfordern würde, . .
Die reich illustrierte Publikation, die auch vom Verleger sehr
gut ausgestattet ist, an der vielleicht nur die gelegentliche Unklarheit der
in den Text gedruckten Strichätzungen auszustellen wäre, ist »dem
Maler Ernst Kreidolf freundschaftlich gewidmet«, dem liebenswürdigen
Schweizer Maler und Dichter, über den Fraenger bereits 1917 ein hübsches
Büchlein verfaßt hat (Zürich, Rascher & Cie.). A. W.
Detlev Freiherr von Hadeln, Die Zeich-
nungen von Antonio Canal, genannt Canaletto,
Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien; Englische Aus-
gabe: Campbell Dodgson. Messrs. Gerald Duckworth & Co.,
Ltd., London. 72 Lichtdrucktafeln im Format 33'5: 24 cm.
Dazu ein beschreibender Text und ein Gesamtkatalog aller
Zeichnungen Canalettos.
Die Kunstwissenschaft, die sich erst seit dem letzten Jahrzehnt
auf die monographische Erforschung der Kunstdenkmale des XVIII. Jahr-
hunderts und systematische Darstellung des Problems Rokoko-Klassi-
zismus konzentriert, nimmt dankbar eine monographische Untersuchung
über den Hauptvertreter der Vedutenmalerei entgegen, die Hadeln in
seinen »Handzeichnungen des Antonio Canal, gen. Canaletto«, vorlegt.
Alles wissenschaftlich Ernstzunehmende, was bisher über die Vedute
im XVIII. Jahrhundert gesagt worden war, beschränkte sich auf Unter-
suchungen von Teilproblemen — auf historisch-philologische Beobach-
tungen, ikonographische Bestimmungen der Städte- und Straßenbilder, und
wo Canals künstlerisches Schaffen monographisch behandelt wurde, nur
auf Ausschnitte aus seinem Gesamtwerk. Erst die Abhandlung von Hermann
Yoß im Repertorium für Kunstwissenschaft 1926/1 studierte die »Vene-
zianische Vedutenmalerei des XVIII. Jahrhunderts < als komplexes Problem,
worin die erste chronologische Ordnung der Gemälde Canals enthalten
ist, die seinerseits W. G. Constable überzeugend vornahm, anläßlich seines
Berichtes über die Canaletto-Ausstellung der Magnasco-Society-London
im Sommer 1929 (Burlington Magazine, S. 46/50, 1929). Das Werk Hadelns
hat sich nun das Verdienst erworben, die verschwommene Vorstellung
von Antonio Canals Künstlerschaft als ganze schärfer zu prägen. Denn
die kritische Würdigung des Zeichners Canal an Hand des aufgestellten
Caialogue raisonne förderte gleichzeitig wesentliche Beiträge zur Beur-
teilung des Malers, ja seiner epochalen Bedeutung schlechthin. Die soweit
skizzierte Biographie, als sie Anhaltspunkte für die Datierung stellt, nimmt
Verfasser zum dankenswerten Anlaß, auf die Beziehungen venezianischer
Maler des XVIII. Jahrhunderts zu ihren holländischen Vorgängern im XVII.
und speziell auf die künstlerische Herkunft Canals zu verweisen: auf die
»anmutig-sachlichen, ganz unromantischen Veduten« von G. van Wittel
(Vanvittelli). Und wo Verfasser gelegentlich der Ausscheidung von fremden
Zeichnungen dem Oeuvre des Meisters etwas nimmt, da begnügt er sich
nicht mit dem Verdikt »Nachahmer« und verweist die betr. Blätter in das
Dunkel der Anonymität, sondern gibt sie anderen zurück (Francesco
Tironi). Dadurch erhalten die Werke Canals in dem langen Reigen der
Arbeit über den Schweizer Landsknechtzeichner dar, der in der zweiten
Periode seines Lebens bezeichnenderweise den Buchstaben V G seines
Monogramms einen Dolch hinzufügte. Der Titel des Buches deutet bereits
an, daß es sich auf breitester Grundlage aufbaut, sagt aber noch zu wenig.
In der Einleitung werden die »Schweizer um 1500« und die »Kunst in der
Schweiz und Schweizer Kunst« behandelt. Der I. Teil des Werkes, der
»Eigenes Wollen und fremdes Können« überschrieben ist, zerfällt in die
Abschnitte >SoIothurn und Solothurnisches in Urs Graf« ; »Basel, das große
Sammelbecken«; »Von eidgenössischer Vorstoßkraft« (Grafs »empörende
und unflätige Grobiansgeschichten«); »Werkstattlich keit und Originalität«
(dieHolzschnitte zur Ringmannschen Passion); »Ein Allerweltskönnertum«
(die Arbeiten für die großen Baseler Druckereien). Der II. Teil des Buches
heißt ».Mit Stift und Schwert«. Seine fünf Kapitel sind überschrieben: »Ein
Künstler zieht mit den Eidgenossen nach den enitbergischen Landen«
(Graf stößt 1512 in Verona mit dem Baseler Landsknechtaufgebot zum eid-
genössischen Heerbann); »Von großen Gegensätzen« (Urs Graf kehrt sich
von der unverstandenen Renaissance und den ungeglaubten Heiligen-
gestalten ab und erfüllt seine Kunst mit seinem eigenen Wesen); »Der alt
Eidgenoß« (in anderthalb Jahrzehnten schafft Graf seine Zeichnungen von
Landsknecht- und Troßgestalten, die sein ganzes vor 1512 gearbeitetes
Holzschnittwerk in den Hintergrund schieben); »Entladungen und wieder
Entladungen« (die Pannerträger, die Holzschnitte zum Artus-Roman);
»Totentänze, Minnedienst und moralischer Beschluß«.
Ein ausführlicher Quellennachweis, das Verzeichnis der Werke
und zahlreiche Abbildungen nicht nur nach Arbeiten Urs Grafs sondern
auch nach solchen anderer Künstler ergänzen anschaulich und lehrreich
denText, der ein bißchen umständlich gehalten ist. Wesentliches und Un-
wesentliches nicht immer auseinanderzuhalten weiß und in einer eigen-
willigen, aber kernigen Sprache geschrieben ist.
Das angefochtene Datum 1513 auf der Radierung »Badende Dirne«
(ist diese Jahreszahl richtig, so wäre das Blatt die älteste uns bekannte
datierte Radierung) läßt der Verfasser gelten.
Von Grafs Tätigkeit als Goldschmied hält Lüthi nicht viel, mit
Recht, es ist aber doch schade, daß er gar keinen Entwurf des Künstlers
zu einer Goldschmiedearbeit abgebildet hat. —
Der Band ist gut und reich ausgestattet. A. W.
Wilhelm Fr aenger: Altdeutsches Bilderbuch,
Hans Weiditz und Sebastian Brant. Leipzig 1930.
Herbert Stubenrauch. Band II der von Wilhelm Fraenger
herausgegebenen »Denkmale der Volkskunst«.
Lehrreich und anregend wie alles, was Fraenger bisher ver-
öffentlicht hat.
Hans Weiditz, der ausgezeichnete, fruchtbare Augsburger
Holzschnittmeister, hat für seine vielfach sehr schwer verständlichen
Illustrationen zu Petrarcas berühmtem Glücksbuch den Text selbst nicht
benützen können, weil er Lateinisch natürlich nicht verstand und weil
die deutsche Übersetzung des Textes, die von Peter Stahel begonnen und
von Georg Spalatin vollendet wurde, nachweislich erst nach der
Fertigstellung der Holzschnitte zustande kam. Von Sebastian Brant,
dem hochangesehenen Baseler Humanisten, heißt es in einer Verlegernotiz
zum I. Band des Glücksbuches, daß die Illustrationen, »nach visierlicher
angebung des Hochgelerten Doctors Sebastiani Brant seligen (er war
1521 gestorben, das Buch kam, nachdem die Holzschnitte für die beiden
Bände 1519 und 1520 fertig waren, erst 1532 heraus), auf jeglichs
Capitell gestellet sind«. Fraenger weist nun nach, daß Weiditz seine
Bilder lediglich auf Grund dieser gelehrten Angaben geschaffen hat. Er
geht hiebet von solchen Illustrationen aus, die Dinge darstellen, von
denen in dem betreffenden Kapitel Petrarcas gar nicht die Rede ist, die
sich aber, namentlich auf Grund von anderen Arbeiten Brants, wie von
dessen Virgil-Ausgabe und »Narrenschiff«, als zum geistigen Bereich
des Baseler Humanisten gehörig erkennen lassen. Er stellt das didaktische
Schema fest, nach dem Brant vorgegangen ist, und weist die drei
Arten dieses Schemas am Geschichtsbild, Sittenbild und Sinnbild
überzeugend nach. Dabei schält sich das, was in den Holzschnitten
auch inhaltlich geistiges Eigentum von Weiditz ist, auf einleuchtend
klare Weise heraus. Es ist erfreulich zu sehen, wie sich der Künstler dort
wo die bildenden Künste durch Petrarcas stoische Weltabgekehrtheit
herabgesetzt werden sollen, weder um den Autor noch um dessen ge-
lehrten Interpreten einen blauen Teufel schert und, wo er verdammen soll
segnet.
Fraenger nennt im Obertitel seine Veröffentlichung »ein alt-
deutsches Bilderbuch«. Im »erläuternden Verzeichnis« des Tafelteiles
erklärt er kurz auch die im Text nicht von ihm besprochenen Holz-
schnitte des Glücksbuches. Wie wichtig diese Erklärungen sind, geht
daraus hervor, daß die letzte Publikation über die Holzschnitte von
Weiditz, Theodor Muspers Kritisches Verzeichnis der Holzschnitte des
Petrarcameisters (München 1927, Verlag der Münchener Drucke), das
sich von den bisherigen Katalogen dadurch unterscheidet, »daß es
Bücher und Holzschnitte getrennt aufzählt und eine Beschreibung jedes
Holzschnittes gibt«, diese Beschreibung nur »nach dem Gesichtspunkt
der Unterscheidbarkeit« vornimmt, »da die Deutung der Holzschnitte oft
schwankend bleibt und lange Kommentare erfordern würde, . .
Die reich illustrierte Publikation, die auch vom Verleger sehr
gut ausgestattet ist, an der vielleicht nur die gelegentliche Unklarheit der
in den Text gedruckten Strichätzungen auszustellen wäre, ist »dem
Maler Ernst Kreidolf freundschaftlich gewidmet«, dem liebenswürdigen
Schweizer Maler und Dichter, über den Fraenger bereits 1917 ein hübsches
Büchlein verfaßt hat (Zürich, Rascher & Cie.). A. W.
Detlev Freiherr von Hadeln, Die Zeich-
nungen von Antonio Canal, genannt Canaletto,
Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien; Englische Aus-
gabe: Campbell Dodgson. Messrs. Gerald Duckworth & Co.,
Ltd., London. 72 Lichtdrucktafeln im Format 33'5: 24 cm.
Dazu ein beschreibender Text und ein Gesamtkatalog aller
Zeichnungen Canalettos.
Die Kunstwissenschaft, die sich erst seit dem letzten Jahrzehnt
auf die monographische Erforschung der Kunstdenkmale des XVIII. Jahr-
hunderts und systematische Darstellung des Problems Rokoko-Klassi-
zismus konzentriert, nimmt dankbar eine monographische Untersuchung
über den Hauptvertreter der Vedutenmalerei entgegen, die Hadeln in
seinen »Handzeichnungen des Antonio Canal, gen. Canaletto«, vorlegt.
Alles wissenschaftlich Ernstzunehmende, was bisher über die Vedute
im XVIII. Jahrhundert gesagt worden war, beschränkte sich auf Unter-
suchungen von Teilproblemen — auf historisch-philologische Beobach-
tungen, ikonographische Bestimmungen der Städte- und Straßenbilder, und
wo Canals künstlerisches Schaffen monographisch behandelt wurde, nur
auf Ausschnitte aus seinem Gesamtwerk. Erst die Abhandlung von Hermann
Yoß im Repertorium für Kunstwissenschaft 1926/1 studierte die »Vene-
zianische Vedutenmalerei des XVIII. Jahrhunderts < als komplexes Problem,
worin die erste chronologische Ordnung der Gemälde Canals enthalten
ist, die seinerseits W. G. Constable überzeugend vornahm, anläßlich seines
Berichtes über die Canaletto-Ausstellung der Magnasco-Society-London
im Sommer 1929 (Burlington Magazine, S. 46/50, 1929). Das Werk Hadelns
hat sich nun das Verdienst erworben, die verschwommene Vorstellung
von Antonio Canals Künstlerschaft als ganze schärfer zu prägen. Denn
die kritische Würdigung des Zeichners Canal an Hand des aufgestellten
Caialogue raisonne förderte gleichzeitig wesentliche Beiträge zur Beur-
teilung des Malers, ja seiner epochalen Bedeutung schlechthin. Die soweit
skizzierte Biographie, als sie Anhaltspunkte für die Datierung stellt, nimmt
Verfasser zum dankenswerten Anlaß, auf die Beziehungen venezianischer
Maler des XVIII. Jahrhunderts zu ihren holländischen Vorgängern im XVII.
und speziell auf die künstlerische Herkunft Canals zu verweisen: auf die
»anmutig-sachlichen, ganz unromantischen Veduten« von G. van Wittel
(Vanvittelli). Und wo Verfasser gelegentlich der Ausscheidung von fremden
Zeichnungen dem Oeuvre des Meisters etwas nimmt, da begnügt er sich
nicht mit dem Verdikt »Nachahmer« und verweist die betr. Blätter in das
Dunkel der Anonymität, sondern gibt sie anderen zurück (Francesco
Tironi). Dadurch erhalten die Werke Canals in dem langen Reigen der