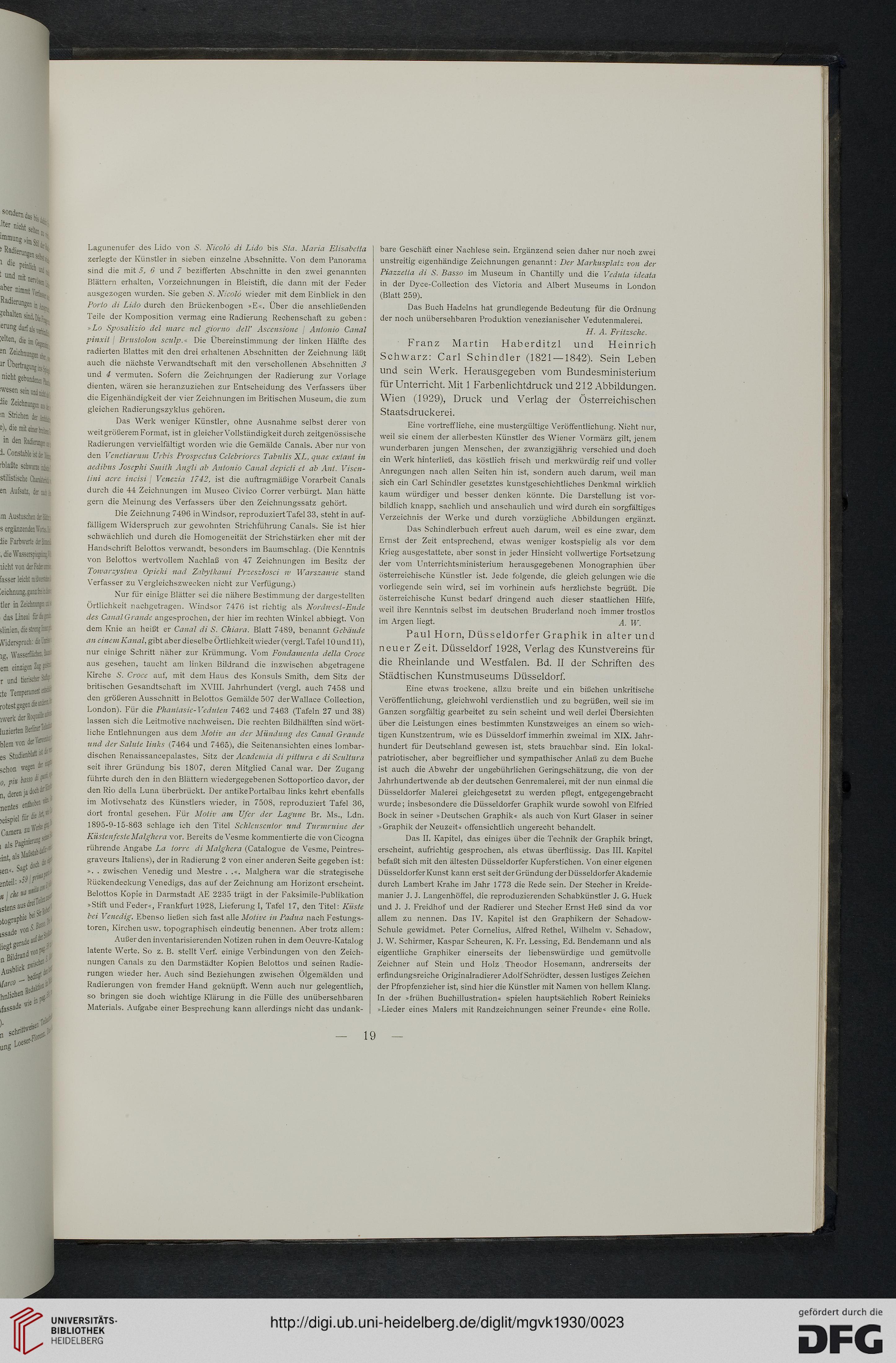PS.
Altai- ,
KS*'
a5blic^
Lagunenufer des Lido von 5. Nicola di Lido bis Sla. Marin Elisabctta
zerlegte der Künstler in sieben einzelne Abschnitte. Von dem Panorama
sind die mit 5, 6 und 7 bezifferten Abschnitte in den zwei genannten
Blättern erhalten, Vorzeiehnungen in Bleistift, die dann mit der Feder
ausgezogen wurden. Sie geben S. Nicola wieder mit dem Einblick in den
Porto di Lido durch den Brückenbogen »E«. Über die anschließenden
Teile der Komposition vermag eine Radierung Rechenschaft zu geben:
»Lo Sposalizio dcl marc HCl gionto dcll' Asccnsione \ Antonio Canal
pinxit I Brustolon sculp.« Die Übereinstimmung der linken Hälfte des
radierten Blattes mit den drei erhaltenen Abschnitten der Zeichnung läßt
auch die nächste Verwandtschaft mit den verschollenen Abschnitten 3
und 4 vermuten. Sofern die Zeichaungen der Radierung zur Vorlage
dienten, wären sie heranzuziehen zur Entscheidung des Verfassers über
die Eigenhändigkeit der vier Zeichnungen im Britischen Museum, die zum
gleichen Radierungszyklus gehören.
Das Werk weniger Künstler, ohne Ausnahme selbst derer von
weit größerem Format, ist in gleicher Vollständigkeit durch zeitgenössische
Radierungen vervielfältigt worden wie die Gemälde Canals. Aber nur von
den Venetiaruni Urhis Prospectns Celebriorcs Tabulis XL, quae exlant in
aedibus Joscphi Smith Angli ab Antonio Canal depicti et ab Ant. Visen-
Uni acre incisi \ Venezia 1742, ist die auftragmäßige Vorarbeit Canals
durch die 44 Zeichnungen im Museo Civico Correr verbürgt. Man hatte
gern die Meinung des Verfassers über den Zeichnungssatz gehört.
Die Zeichnung 7496 in Windsor, reproduziert Tafel 33, steht in auf-
fälligem Widerspruch zur gewohnten Strichführung Canals. Sie ist hier
schwächlich und durch die Homogeneität der Strichstärken eher mit der
Handschrift Beiottos verwandt, besonders im Baumschlag. (Die Kenntnis
von Beiottos wertvollem Nachlaß von 47 Zeichnungen im Besitz der
Towarzysitva Opieki nad Zabyfkami Przesziosci w Warszawte stand
Verfasser zu Vergleichszwecken nicht zur Verfügung.)
Nur für einige Blätter sei die nähere Bestimmung der dargestellten
Örtlichkeit nachgetragen. Windsor 7476 ist richtig als Nordwest-Ende
des CanalGrandc angesprochen, der hier im rechten Winkel abbiegt. Von
dem Knie an heißt er Canal di S. Chiara. Blatt 74S9, benannt Gebäude
an einem Kanal, gibt aber dieselbe Örtlichkeit wieder (vergl. Tafel 10 und 11),
nur einige Schritt näher zur Krümmung. Vom Pondamenla della Crocc
aus gesehen, taucht am linken Bildrand die inzwischen abgetragene
Kirche S. Crocc auf, mit dem Haus des Konsuls Smith, dem Sitz der
britischen Gesandtschaft im XVIII. Jahrhundert (vergl. auch 7458 und
den größeren Ausschnitt in Beiottos Gemälde 507 derWallace Collection,
London). Für die Phantasie-Veduten 7462 und 7463 (Tafeln 27 und 38)
lassen sich die Leitmotive nachweisen. Die rechten Bildhälften sind wört-
liche Entlehnungen aus dem Motiv an der Mündung des Canal Grande
und der Salute links (7464 und 7465), die Seitenansichten eines lombar-
dischen Renaissancepalastes, Sitz der Acadcmia di pittura e di Scultura
seit ihrer Gründung bis 1807, deren Mitglied Canal war. Der Zugang
führte durch den in den Blättern wiedergegebenen Sottoportico davor, der
den Rio della Luna überbrückt. Der antike Portalbau links kehrt ebenfalls
im Motivschatz des Künstlers wieder, in 7508, reproduziert Tafel 36,
dort frontal gesehen. Für Motiv am Ufer der Lagune ßr. Ms., Ldn.
1895-9-15-863 schlage ich den Titel Schleusentor und Turmruine der
KüstenfesteMalghcra vor. Bereits deVesme kommentierte die vonCicogna
rührende Angabe La torrc di Malghcra (Catalogue de Vesme, Peintres-
graveurs Italiens), der in Radierung 2 von einer anderen Seite gegeben ist:
». . zwischen Venedig und Mestre . .«. Malghera war die strategische
Rückendeckung Venedigs, das auf der Zeichnung am Horizont erscheint.
Beiottos Kopie in Darmstadt AE 2235 trägt in der Faksimile-Publikation
>Stift und Feder«, Frankfurt 1928, Lieferung I, Tafel 17, den Titel: Küste
bei Venedig. Ebenso ließen sich fast alle Motive in Padua nach Festungs-
toren, Kirchen usw. topographisch eindeutig benennen. Aber trotz allem:
Außer den inventarisierenden Notizen ruhen in dem Oeuvre-Katalog
latente Werte. So z. B. stellt Verf. einige Verbindungen von den Zeich-
nungen Canals zu den Darmstädter Kopien Beiottos und seinen Radie-
rungen wieder her. Auch sind Beziehungen zwischen Ölgemälden und
Radierungen von fremder Hand geknüpft. Wenn auch nur gelegentlich,
so bringen sie doch wichtige Klärung in die Fülle des unübersehbaren
Materials. Aufgabe einer Besprechung kann allerdings nicht das undank-
bare Geschäft einer Nachlese sein. Ergänzend seien daher nur noch zwei
unstreitig eigenhändige Zeichnungen genannt: Der Markusplatz von der
Piazzelta di S. Basso im Museum in Chantüly und die Veduta ideata
in der Dyce-Collection des Victoria and Albert Museums in London
(Blatt 259).
Das Buch Hadelns hat grundlegende Bedeutung für die Ordnung
der noch unübersehbaren Produktion venezianischer Vedutenmalerei.
H. A. Fritzsche.
Franz Martin Haberditzl und Heinrich
Schwarz: Carl Schindler (1821 — 1842). Sein Leben
und sein Werk. Herausgegeben vom Bundesministerium
für Unterricht. Mit 1 Farbenlichtdruck und 212 Abbildungen.
Wien (1929), Druck und Verlag der Österreichischen
Staatsdruckerei.
Eine vortreffliche, eine mustergültige Veröffentlichung. Nicht nur,
weil sie einem der allerbesten Künstler des Wiener Vormärz gilt, jenem
wunderbaren jungen Menschen, der zwanzigjährig verschied und doch
ein Werk hinterließ, das köstlich frisch und merkwürdig reif und voller
Anregungen nach allen Seiten hin ist, sondern auch darum, weil man
sich ein Carl Schindler gesetztes kunstgeschichtliches Denkmal wirklich
kaum würdiger und besser denken könnte. Die Darstellung ist vor-
bildlich knapp, sachlich und anschaulich und wird durch ein sorgfältiges
Verzeichnis der Werke und durch vorzügliche Abbildungen ergänzt.
Das Schindlerbuch erfreut auch darum, weil es eine zwar, dem
Ernst der Zeit entsprechend, etwas weniger kostspielig als vor dem
Krieg ausgestattete, aber sonst in jeder Hinsicht vollwertige Fortsetzung
der vom Unterrichtsministerium herausgegebenen Monographien über
österreichische Künstler ist. Jede folgende, die gleich gelungen wie die
vorliegende sein wird, sei im vorhinein aufs herzlichste begrüßt. Die
österreichische Kunst bedarf dringend auch dieser staatlichen Hilfe,
weil ihre Kenntnis selbst im deutschen Bruderland noch immer trostlos
im Argen liegt. A. W.
Paul Horn, Düsseldorfer Graphik in alter und
neuer Zeit. Düsseldorf 1928, Verlag des Kunstvereins für
die Rheinlande und Westfalen. Bd. II der Schriften des
Städtischen Kunstmuseums Düsseldorf.
Eine etwas trockene, allzu breite und ein bißchen unkritische
Veröffentlichung, gleichwohl verdienstlich und zu begrüßen, weil sie im
Ganzen sorgfältig gearbeitet zu sein scheint und weil derlei Übersichten
über die Leistungen eines bestimmten Kunstzweiges an einem so wich-
tigen Kunstzentrum, wie es Düsseldorf immerhin zweimal im XIX. Jahr-
hundert für Deutschland gewesen ist, stets brauchbar sind. Ein lokal-
patriotischer, aber begreiflicher und sympathischer Anlaß zu dem Buche
ist auch die Abwehr der ungebührlichen Geringschätzung, die von der
Jahrhundertwende ab der deutschen Genremalerei, mit der nun einmal die
Düsseldorfer Malerei gleichgesetzt zu werden pflegt, entgegengebracht
wurde; insbesondere die Düsseldorfer Graphik wurde sowohl von Elfried
Bock in seiner »Deutschen Graphik« als auch von Kurt Glaser in seiner
»Graphik der Neuzeit« offensichtlich ungerecht behandelt.
Das II. Kapitel, das einiges über die Technik der Graphik bringt,
erscheint, aufrichtig gesprochen, als etwas überflüssig. Das III. Kapitel
befaßt sich mit den ältesten Düsseldorfer Kupferstichen. Von einer eigenen
Düsseldorfer Kunst kann erst seit derGründung der Düsseldorfer Akademie
durch Lambert Krähe im Jahr 1773 die Rede sein. Der Stecher in Kreide-
manier J. J. Langenhöffel, die reproduzierenden Schabkünstler J. G. Huck
und J. J. Freidhof und der Radierer und Stecher Ernst Heß sind da vor
allem zu nennen. Das IV. Kapitel ist den Graphikern der Schadow-
Schule gewidmet. Peter Cornelius, Alfred Rethel, Wilhelm v. Schadow,
J. W. Schirmer, Kaspar Scheuren, K. Fr. Lessing, Ed. Bendemann und als
eigentliche Graphiker einerseits der liebenswürdige und gemütvolle
Zeichner auf Stein und Holz Theodor Hosemann, andrerseits der
erfindungsreiche Originalradierer Adolf SchrÖdter, dessen lustiges Zeichen
der Pfropfen zieher ist, sind hier die Künstler mit Namen von hellem Klang.
In der »frühen Buchillustration« spielen hauptsächlich Robert Reinicks
»Lieder eines Malers mit Randzeichnungen seiner Freunde« eine Rolle.
19
Altai- ,
KS*'
a5blic^
Lagunenufer des Lido von 5. Nicola di Lido bis Sla. Marin Elisabctta
zerlegte der Künstler in sieben einzelne Abschnitte. Von dem Panorama
sind die mit 5, 6 und 7 bezifferten Abschnitte in den zwei genannten
Blättern erhalten, Vorzeiehnungen in Bleistift, die dann mit der Feder
ausgezogen wurden. Sie geben S. Nicola wieder mit dem Einblick in den
Porto di Lido durch den Brückenbogen »E«. Über die anschließenden
Teile der Komposition vermag eine Radierung Rechenschaft zu geben:
»Lo Sposalizio dcl marc HCl gionto dcll' Asccnsione \ Antonio Canal
pinxit I Brustolon sculp.« Die Übereinstimmung der linken Hälfte des
radierten Blattes mit den drei erhaltenen Abschnitten der Zeichnung läßt
auch die nächste Verwandtschaft mit den verschollenen Abschnitten 3
und 4 vermuten. Sofern die Zeichaungen der Radierung zur Vorlage
dienten, wären sie heranzuziehen zur Entscheidung des Verfassers über
die Eigenhändigkeit der vier Zeichnungen im Britischen Museum, die zum
gleichen Radierungszyklus gehören.
Das Werk weniger Künstler, ohne Ausnahme selbst derer von
weit größerem Format, ist in gleicher Vollständigkeit durch zeitgenössische
Radierungen vervielfältigt worden wie die Gemälde Canals. Aber nur von
den Venetiaruni Urhis Prospectns Celebriorcs Tabulis XL, quae exlant in
aedibus Joscphi Smith Angli ab Antonio Canal depicti et ab Ant. Visen-
Uni acre incisi \ Venezia 1742, ist die auftragmäßige Vorarbeit Canals
durch die 44 Zeichnungen im Museo Civico Correr verbürgt. Man hatte
gern die Meinung des Verfassers über den Zeichnungssatz gehört.
Die Zeichnung 7496 in Windsor, reproduziert Tafel 33, steht in auf-
fälligem Widerspruch zur gewohnten Strichführung Canals. Sie ist hier
schwächlich und durch die Homogeneität der Strichstärken eher mit der
Handschrift Beiottos verwandt, besonders im Baumschlag. (Die Kenntnis
von Beiottos wertvollem Nachlaß von 47 Zeichnungen im Besitz der
Towarzysitva Opieki nad Zabyfkami Przesziosci w Warszawte stand
Verfasser zu Vergleichszwecken nicht zur Verfügung.)
Nur für einige Blätter sei die nähere Bestimmung der dargestellten
Örtlichkeit nachgetragen. Windsor 7476 ist richtig als Nordwest-Ende
des CanalGrandc angesprochen, der hier im rechten Winkel abbiegt. Von
dem Knie an heißt er Canal di S. Chiara. Blatt 74S9, benannt Gebäude
an einem Kanal, gibt aber dieselbe Örtlichkeit wieder (vergl. Tafel 10 und 11),
nur einige Schritt näher zur Krümmung. Vom Pondamenla della Crocc
aus gesehen, taucht am linken Bildrand die inzwischen abgetragene
Kirche S. Crocc auf, mit dem Haus des Konsuls Smith, dem Sitz der
britischen Gesandtschaft im XVIII. Jahrhundert (vergl. auch 7458 und
den größeren Ausschnitt in Beiottos Gemälde 507 derWallace Collection,
London). Für die Phantasie-Veduten 7462 und 7463 (Tafeln 27 und 38)
lassen sich die Leitmotive nachweisen. Die rechten Bildhälften sind wört-
liche Entlehnungen aus dem Motiv an der Mündung des Canal Grande
und der Salute links (7464 und 7465), die Seitenansichten eines lombar-
dischen Renaissancepalastes, Sitz der Acadcmia di pittura e di Scultura
seit ihrer Gründung bis 1807, deren Mitglied Canal war. Der Zugang
führte durch den in den Blättern wiedergegebenen Sottoportico davor, der
den Rio della Luna überbrückt. Der antike Portalbau links kehrt ebenfalls
im Motivschatz des Künstlers wieder, in 7508, reproduziert Tafel 36,
dort frontal gesehen. Für Motiv am Ufer der Lagune ßr. Ms., Ldn.
1895-9-15-863 schlage ich den Titel Schleusentor und Turmruine der
KüstenfesteMalghcra vor. Bereits deVesme kommentierte die vonCicogna
rührende Angabe La torrc di Malghcra (Catalogue de Vesme, Peintres-
graveurs Italiens), der in Radierung 2 von einer anderen Seite gegeben ist:
». . zwischen Venedig und Mestre . .«. Malghera war die strategische
Rückendeckung Venedigs, das auf der Zeichnung am Horizont erscheint.
Beiottos Kopie in Darmstadt AE 2235 trägt in der Faksimile-Publikation
>Stift und Feder«, Frankfurt 1928, Lieferung I, Tafel 17, den Titel: Küste
bei Venedig. Ebenso ließen sich fast alle Motive in Padua nach Festungs-
toren, Kirchen usw. topographisch eindeutig benennen. Aber trotz allem:
Außer den inventarisierenden Notizen ruhen in dem Oeuvre-Katalog
latente Werte. So z. B. stellt Verf. einige Verbindungen von den Zeich-
nungen Canals zu den Darmstädter Kopien Beiottos und seinen Radie-
rungen wieder her. Auch sind Beziehungen zwischen Ölgemälden und
Radierungen von fremder Hand geknüpft. Wenn auch nur gelegentlich,
so bringen sie doch wichtige Klärung in die Fülle des unübersehbaren
Materials. Aufgabe einer Besprechung kann allerdings nicht das undank-
bare Geschäft einer Nachlese sein. Ergänzend seien daher nur noch zwei
unstreitig eigenhändige Zeichnungen genannt: Der Markusplatz von der
Piazzelta di S. Basso im Museum in Chantüly und die Veduta ideata
in der Dyce-Collection des Victoria and Albert Museums in London
(Blatt 259).
Das Buch Hadelns hat grundlegende Bedeutung für die Ordnung
der noch unübersehbaren Produktion venezianischer Vedutenmalerei.
H. A. Fritzsche.
Franz Martin Haberditzl und Heinrich
Schwarz: Carl Schindler (1821 — 1842). Sein Leben
und sein Werk. Herausgegeben vom Bundesministerium
für Unterricht. Mit 1 Farbenlichtdruck und 212 Abbildungen.
Wien (1929), Druck und Verlag der Österreichischen
Staatsdruckerei.
Eine vortreffliche, eine mustergültige Veröffentlichung. Nicht nur,
weil sie einem der allerbesten Künstler des Wiener Vormärz gilt, jenem
wunderbaren jungen Menschen, der zwanzigjährig verschied und doch
ein Werk hinterließ, das köstlich frisch und merkwürdig reif und voller
Anregungen nach allen Seiten hin ist, sondern auch darum, weil man
sich ein Carl Schindler gesetztes kunstgeschichtliches Denkmal wirklich
kaum würdiger und besser denken könnte. Die Darstellung ist vor-
bildlich knapp, sachlich und anschaulich und wird durch ein sorgfältiges
Verzeichnis der Werke und durch vorzügliche Abbildungen ergänzt.
Das Schindlerbuch erfreut auch darum, weil es eine zwar, dem
Ernst der Zeit entsprechend, etwas weniger kostspielig als vor dem
Krieg ausgestattete, aber sonst in jeder Hinsicht vollwertige Fortsetzung
der vom Unterrichtsministerium herausgegebenen Monographien über
österreichische Künstler ist. Jede folgende, die gleich gelungen wie die
vorliegende sein wird, sei im vorhinein aufs herzlichste begrüßt. Die
österreichische Kunst bedarf dringend auch dieser staatlichen Hilfe,
weil ihre Kenntnis selbst im deutschen Bruderland noch immer trostlos
im Argen liegt. A. W.
Paul Horn, Düsseldorfer Graphik in alter und
neuer Zeit. Düsseldorf 1928, Verlag des Kunstvereins für
die Rheinlande und Westfalen. Bd. II der Schriften des
Städtischen Kunstmuseums Düsseldorf.
Eine etwas trockene, allzu breite und ein bißchen unkritische
Veröffentlichung, gleichwohl verdienstlich und zu begrüßen, weil sie im
Ganzen sorgfältig gearbeitet zu sein scheint und weil derlei Übersichten
über die Leistungen eines bestimmten Kunstzweiges an einem so wich-
tigen Kunstzentrum, wie es Düsseldorf immerhin zweimal im XIX. Jahr-
hundert für Deutschland gewesen ist, stets brauchbar sind. Ein lokal-
patriotischer, aber begreiflicher und sympathischer Anlaß zu dem Buche
ist auch die Abwehr der ungebührlichen Geringschätzung, die von der
Jahrhundertwende ab der deutschen Genremalerei, mit der nun einmal die
Düsseldorfer Malerei gleichgesetzt zu werden pflegt, entgegengebracht
wurde; insbesondere die Düsseldorfer Graphik wurde sowohl von Elfried
Bock in seiner »Deutschen Graphik« als auch von Kurt Glaser in seiner
»Graphik der Neuzeit« offensichtlich ungerecht behandelt.
Das II. Kapitel, das einiges über die Technik der Graphik bringt,
erscheint, aufrichtig gesprochen, als etwas überflüssig. Das III. Kapitel
befaßt sich mit den ältesten Düsseldorfer Kupferstichen. Von einer eigenen
Düsseldorfer Kunst kann erst seit derGründung der Düsseldorfer Akademie
durch Lambert Krähe im Jahr 1773 die Rede sein. Der Stecher in Kreide-
manier J. J. Langenhöffel, die reproduzierenden Schabkünstler J. G. Huck
und J. J. Freidhof und der Radierer und Stecher Ernst Heß sind da vor
allem zu nennen. Das IV. Kapitel ist den Graphikern der Schadow-
Schule gewidmet. Peter Cornelius, Alfred Rethel, Wilhelm v. Schadow,
J. W. Schirmer, Kaspar Scheuren, K. Fr. Lessing, Ed. Bendemann und als
eigentliche Graphiker einerseits der liebenswürdige und gemütvolle
Zeichner auf Stein und Holz Theodor Hosemann, andrerseits der
erfindungsreiche Originalradierer Adolf SchrÖdter, dessen lustiges Zeichen
der Pfropfen zieher ist, sind hier die Künstler mit Namen von hellem Klang.
In der »frühen Buchillustration« spielen hauptsächlich Robert Reinicks
»Lieder eines Malers mit Randzeichnungen seiner Freunde« eine Rolle.
19