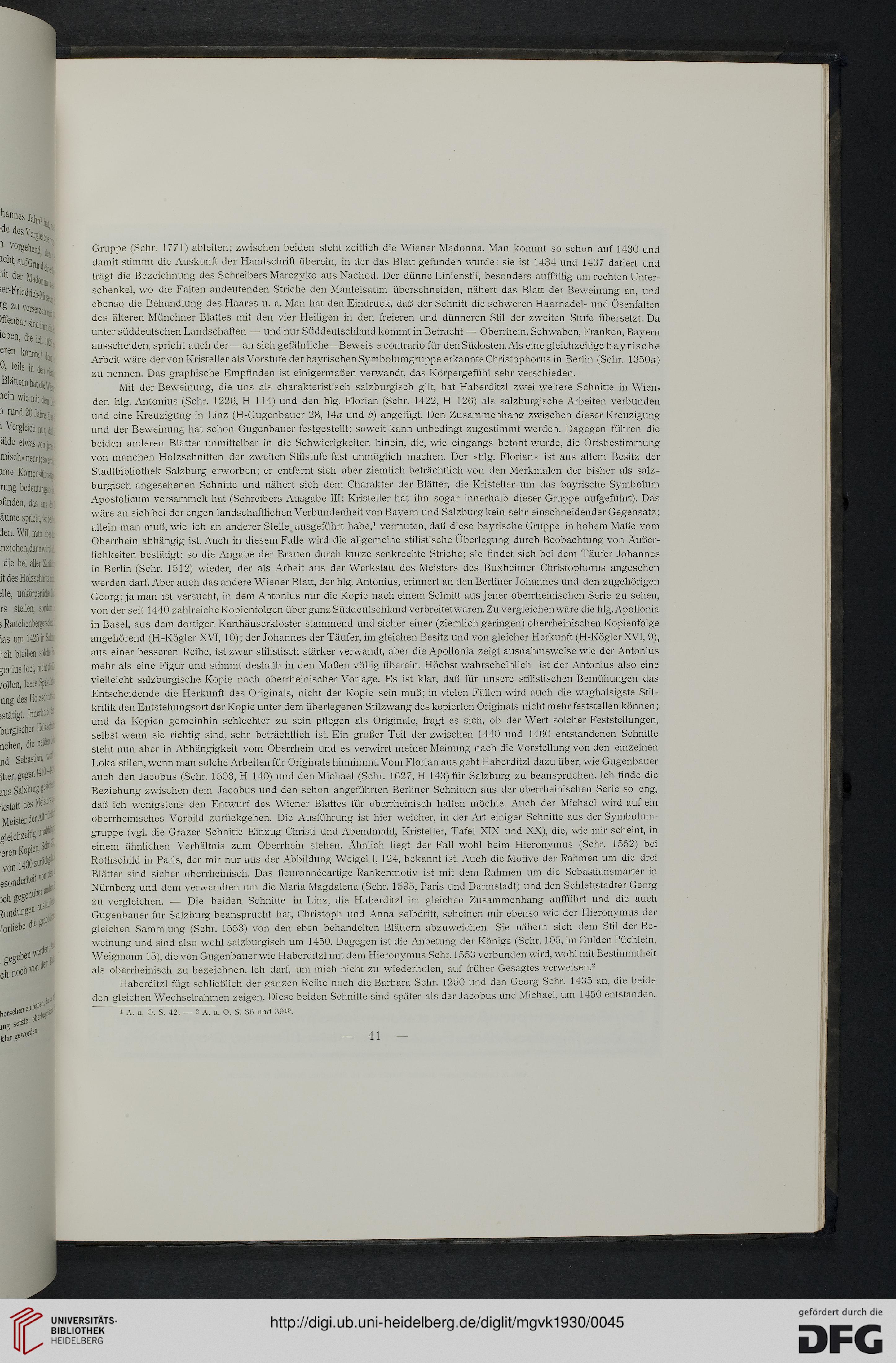1 1425 ilfc
; des Holste
, lnnerbslb i
r Holst
lUS SÄ S^'
■kstatt des M«
Meistertet
■eren Kopien, ^
von 1430»»
esonderheitvon •
setzte, o-
„eivor*1
Gruppe (Sehr. 1771) ableiten; zwischen beiden steht zeitlich die Wiener Madonna. Man kommt so schon auf 1430 und
damit stimmt die Auskunft der Handschrift überein, in der das Blatt gefunden wurde: sie ist 1434 und 1437 datiert und
trägt die Bezeichnung des Schreibers Marczyko aus Nachod. Der dünne Linienstil, besonders auffällig am rechten Unter-
schenkel, wo die Falten andeutenden Striche den Mantelsaum überschneiden, nähert das Blatt der Beweinung an, und
ebenso die Behandlung des Haares u. a. Man hat den Eindruck, daß der Schnitt die schweren Haarnadel- und Ösenfalten
des älteren Münchner Blattes mit den vier Heiligen in den freieren und dünneren Stil der zweiten Stufe übersetzt. Da
unter süddeutschen Landschaften — und nur Süddeutschland kommt in Betracht — Oberrhein, Schwaben, Franken, Bayern
ausscheiden, spricht auch der—an sich gefährliche—Beweis e contrario für denSüdosten.Als eine gleichzeitige bayrische
Arbeit wäre der von Kristeller als Vorstufe der bayrischen Symbolumgruppe erkannte Christophorus in Berlin (Sehr. 1350a)
zu nennen. Das graphische Empfinden ist einigermaßen verwandt, das Körpergefühl sehr verschieden.
Mit der Beweinung, die uns als charakteristisch salzburgisch gilt, hat Haberditzl zwei weitere Schnitte in Wien,
den hlg. Antonius (Sehr. 1226, H 114) und den Mg. Florian (Sehr. 1422, H 126) als salzburgische Arbeiten verbunden
und eine Kreuzigung in Linz (H-Gugenbauer 28, 14a und b) angefügt. Den Zusammenhang zwischen dieser Kreuzigung
und der Beweinung hat schon Gugenbauer festgestellt; soweit kann unbedingt zugestimmt werden. Dagegen führen die
beiden anderen Blätter unmittelbar in die Schwierigkeiten hinein, die, wie eingangs betont wurde, die Ortsbestimmung
von manchen Holzschnitten der zweiten Stilstufe fast unmöglich machen. Der »hlg. Florian« ist aus altem Besitz der
Stadtbibliothek Salzburg erworben; er entfernt sich aber ziemlich beträchtlich von den Merkmalen der bisher als salz-
burgisch angesehenen Schnitte und nähert sich dem Charakter der Blätter, die Kristeller um das bayrische Symbolum
Apostolicum versammelt hat (Schreibers Ausgabe III; Kristeller hat ihn sogar innerhalb dieser Gruppe aufgeführt). Das
wäre an sich bei der engen landschaftlichen Verbundenheit von Bayern und Salzburg kein sehr einschneidender Gegensatz;
allein man muß, wie ich an anderer Stelle, ausgeführt habe,1 vermuten, daß diese bayrische Gruppe in hohem Maße vom
Oberrhein abhängig ist. Auch in diesem Falle wird die allgemeine stilistische Überlegung durch Beobachtung von Äußer-
lichkeiten bestätigt: so die Angabe der Brauen durch kurze senkrechte Striche; sie findet sich bei dem Täufer Johannes
in Berlin (Sehr. 1512) wieder, der als Arbeit aus der Werkstatt des Meisters des Buxheimer Christophorus angesehen
werden darf. Aber auch das andere Wiener Blatt, der hlg. Antonius, erinnert an den Berliner Johannes und den zugehörigen
Georg; ja man ist versucht, in dem Antonius nur die Kopie nach einem Schnitt aus jener oberrheinischen Serie zu sehen,
von der seit 1440 zahlreiche Kopienfolgen über ganz Süddeutschland Verbreitet waren. Zu vergleichen wäre die hlg. Apollonia
in Basel, aus dem dortigen Karthäuserkloster stammend und sicher einer (ziemlich geringen) oberrheinischen Kopienfolge
angehörend (H-Kögler XVI, 10); der Johannes der Täufer, im gleichen Besitz und von gleicher Herkunft (H-Kögler XVI, 9),
aus einer besseren Reihe, ist zwar stilistisch stärker verwandt, aber die Apollonia zeigt ausnahmsweise wie der Antonius
mehr als eine Figur und stimmt deshalb in den Maßen völlig überein. Höchst wahrscheinlich ist der Antonius also eine
vielleicht salzburgische Kopie nach oberrheinischer Vorlage. Es ist klar, daß für unsere stilistischen Bemühungen das
Entscheidende die Herkunft des Originals, nicht der Kopie sein muß; in vielen Fällen wird auch die waghalsigste Stil-
kritik den Entstehungsort der Kopie unter dem überlegenen Stilzwang des kopierten Originals nicht mehr feststellen können;
und da Kopien gemeinhin schlechter zu sein pflegen als Originale, fragt es sich, ob der Wert solcher Feststellungen,
selbst wenn sie richtig sind, sehr beträchtlich ist. Ein großer Teil der zwischen 1440 und 1460 entstandenen Schnitte
steht nun aber in Abhängigkeit vom Oberrhein und es verwirrt meiner Meinung nach die Vorstellung von den einzelnen
Lokalstilen, wenn man solche Arbeiten für Originale hinnimmt. Vom Florian aus geht Haberditzl dazu über, wie Gugenbauer
auch den Jacobus (Sehr. 1503, H 140) und den Michael (Sehr. 1627, H 143) für Salzburg zu beanspruchen. Ich finde die
Beziehung zwischen dem Jacobus und den schon angeführten Berliner Schnitten aus der oberrheinischen Serie so eng,
daß ich wenigstens den Entwurf des Wiener Blattes für oberrheinisch halten möchte. Auch der Michael wird auf ein
oberrheinisches Vorbild zurückgehen. Die Ausführung ist hier weicher, in der Art einiger Schnitte aus der Symbolum-
gruppe (vgl. die Grazer Schnitte Einzug Christi und Abendmahl, Kristeller, Tafel XIX und XX), die, wie mir scheint, in
einem ähnlichen Verhältnis zum Oberrhein stehen. Ähnlich liegt der Fall wohl beim Hieronymus (Sehr. 1552) bei
Rothschild in Paris, der mir nur aus der Abbildung Weigel I, 124, bekannt ist. Auch die Motive der Rahmen um die drei
Blätter sind sicher oberrheinisch. Das fleuronneeartige Rankenmotiv ist mit dem Rahmen um die Sebastiansmarter in
Nürnberg und dem verwandten um die Maria Magdalena (Sehr. 1595, Paris und Darmstadt) und den Schlettstadter Georg
zu vergleichen. — Die beiden Schnitte in Linz, die Haberditzl im gleichen Zusammenhang aufführt und die auch
Gugenbauer für Salzburg beansprucht hat, Christoph und Anna selbdritt, scheinen mir ebenso wie der Hieronymus der
gleichen Sammlung (Sehr. 1553) von den eben behandelten Blättern abzuweichen. Sie nähern sich dem Stil der Be-
weinung und sind also wohl salzburgisch um 1450. Dagegen ist die Anbetung der Könige (Sehr. 105, im Gulden Püchlein,
Weigmann 15), die von Gugenbauer wie Haberditzl mit dem Hieronymus Sehr. 1553 verbunden wird, wohl mit Bestimmtheit
als oberrheinisch zu bezeichnen. Ich darf, um mich nicht zu wiederholen, auf früher Gesagtes verweisen.2
Haberditzl fügt schließlich der ganzen Reihe noch die Barbara Sehr. 1250 und den Georg Sehr. 1435 an, die beide
den gleichen Wechselrahmen zeigen. Diese beiden Schnitte sind später als der Jacobus und Michael, um 1450 entstanden.
1 A. a. O. S. 42. — 2 A. a. O. S. 36 und 391».
— 41 —
; des Holste
, lnnerbslb i
r Holst
lUS SÄ S^'
■kstatt des M«
Meistertet
■eren Kopien, ^
von 1430»»
esonderheitvon •
setzte, o-
„eivor*1
Gruppe (Sehr. 1771) ableiten; zwischen beiden steht zeitlich die Wiener Madonna. Man kommt so schon auf 1430 und
damit stimmt die Auskunft der Handschrift überein, in der das Blatt gefunden wurde: sie ist 1434 und 1437 datiert und
trägt die Bezeichnung des Schreibers Marczyko aus Nachod. Der dünne Linienstil, besonders auffällig am rechten Unter-
schenkel, wo die Falten andeutenden Striche den Mantelsaum überschneiden, nähert das Blatt der Beweinung an, und
ebenso die Behandlung des Haares u. a. Man hat den Eindruck, daß der Schnitt die schweren Haarnadel- und Ösenfalten
des älteren Münchner Blattes mit den vier Heiligen in den freieren und dünneren Stil der zweiten Stufe übersetzt. Da
unter süddeutschen Landschaften — und nur Süddeutschland kommt in Betracht — Oberrhein, Schwaben, Franken, Bayern
ausscheiden, spricht auch der—an sich gefährliche—Beweis e contrario für denSüdosten.Als eine gleichzeitige bayrische
Arbeit wäre der von Kristeller als Vorstufe der bayrischen Symbolumgruppe erkannte Christophorus in Berlin (Sehr. 1350a)
zu nennen. Das graphische Empfinden ist einigermaßen verwandt, das Körpergefühl sehr verschieden.
Mit der Beweinung, die uns als charakteristisch salzburgisch gilt, hat Haberditzl zwei weitere Schnitte in Wien,
den hlg. Antonius (Sehr. 1226, H 114) und den Mg. Florian (Sehr. 1422, H 126) als salzburgische Arbeiten verbunden
und eine Kreuzigung in Linz (H-Gugenbauer 28, 14a und b) angefügt. Den Zusammenhang zwischen dieser Kreuzigung
und der Beweinung hat schon Gugenbauer festgestellt; soweit kann unbedingt zugestimmt werden. Dagegen führen die
beiden anderen Blätter unmittelbar in die Schwierigkeiten hinein, die, wie eingangs betont wurde, die Ortsbestimmung
von manchen Holzschnitten der zweiten Stilstufe fast unmöglich machen. Der »hlg. Florian« ist aus altem Besitz der
Stadtbibliothek Salzburg erworben; er entfernt sich aber ziemlich beträchtlich von den Merkmalen der bisher als salz-
burgisch angesehenen Schnitte und nähert sich dem Charakter der Blätter, die Kristeller um das bayrische Symbolum
Apostolicum versammelt hat (Schreibers Ausgabe III; Kristeller hat ihn sogar innerhalb dieser Gruppe aufgeführt). Das
wäre an sich bei der engen landschaftlichen Verbundenheit von Bayern und Salzburg kein sehr einschneidender Gegensatz;
allein man muß, wie ich an anderer Stelle, ausgeführt habe,1 vermuten, daß diese bayrische Gruppe in hohem Maße vom
Oberrhein abhängig ist. Auch in diesem Falle wird die allgemeine stilistische Überlegung durch Beobachtung von Äußer-
lichkeiten bestätigt: so die Angabe der Brauen durch kurze senkrechte Striche; sie findet sich bei dem Täufer Johannes
in Berlin (Sehr. 1512) wieder, der als Arbeit aus der Werkstatt des Meisters des Buxheimer Christophorus angesehen
werden darf. Aber auch das andere Wiener Blatt, der hlg. Antonius, erinnert an den Berliner Johannes und den zugehörigen
Georg; ja man ist versucht, in dem Antonius nur die Kopie nach einem Schnitt aus jener oberrheinischen Serie zu sehen,
von der seit 1440 zahlreiche Kopienfolgen über ganz Süddeutschland Verbreitet waren. Zu vergleichen wäre die hlg. Apollonia
in Basel, aus dem dortigen Karthäuserkloster stammend und sicher einer (ziemlich geringen) oberrheinischen Kopienfolge
angehörend (H-Kögler XVI, 10); der Johannes der Täufer, im gleichen Besitz und von gleicher Herkunft (H-Kögler XVI, 9),
aus einer besseren Reihe, ist zwar stilistisch stärker verwandt, aber die Apollonia zeigt ausnahmsweise wie der Antonius
mehr als eine Figur und stimmt deshalb in den Maßen völlig überein. Höchst wahrscheinlich ist der Antonius also eine
vielleicht salzburgische Kopie nach oberrheinischer Vorlage. Es ist klar, daß für unsere stilistischen Bemühungen das
Entscheidende die Herkunft des Originals, nicht der Kopie sein muß; in vielen Fällen wird auch die waghalsigste Stil-
kritik den Entstehungsort der Kopie unter dem überlegenen Stilzwang des kopierten Originals nicht mehr feststellen können;
und da Kopien gemeinhin schlechter zu sein pflegen als Originale, fragt es sich, ob der Wert solcher Feststellungen,
selbst wenn sie richtig sind, sehr beträchtlich ist. Ein großer Teil der zwischen 1440 und 1460 entstandenen Schnitte
steht nun aber in Abhängigkeit vom Oberrhein und es verwirrt meiner Meinung nach die Vorstellung von den einzelnen
Lokalstilen, wenn man solche Arbeiten für Originale hinnimmt. Vom Florian aus geht Haberditzl dazu über, wie Gugenbauer
auch den Jacobus (Sehr. 1503, H 140) und den Michael (Sehr. 1627, H 143) für Salzburg zu beanspruchen. Ich finde die
Beziehung zwischen dem Jacobus und den schon angeführten Berliner Schnitten aus der oberrheinischen Serie so eng,
daß ich wenigstens den Entwurf des Wiener Blattes für oberrheinisch halten möchte. Auch der Michael wird auf ein
oberrheinisches Vorbild zurückgehen. Die Ausführung ist hier weicher, in der Art einiger Schnitte aus der Symbolum-
gruppe (vgl. die Grazer Schnitte Einzug Christi und Abendmahl, Kristeller, Tafel XIX und XX), die, wie mir scheint, in
einem ähnlichen Verhältnis zum Oberrhein stehen. Ähnlich liegt der Fall wohl beim Hieronymus (Sehr. 1552) bei
Rothschild in Paris, der mir nur aus der Abbildung Weigel I, 124, bekannt ist. Auch die Motive der Rahmen um die drei
Blätter sind sicher oberrheinisch. Das fleuronneeartige Rankenmotiv ist mit dem Rahmen um die Sebastiansmarter in
Nürnberg und dem verwandten um die Maria Magdalena (Sehr. 1595, Paris und Darmstadt) und den Schlettstadter Georg
zu vergleichen. — Die beiden Schnitte in Linz, die Haberditzl im gleichen Zusammenhang aufführt und die auch
Gugenbauer für Salzburg beansprucht hat, Christoph und Anna selbdritt, scheinen mir ebenso wie der Hieronymus der
gleichen Sammlung (Sehr. 1553) von den eben behandelten Blättern abzuweichen. Sie nähern sich dem Stil der Be-
weinung und sind also wohl salzburgisch um 1450. Dagegen ist die Anbetung der Könige (Sehr. 105, im Gulden Püchlein,
Weigmann 15), die von Gugenbauer wie Haberditzl mit dem Hieronymus Sehr. 1553 verbunden wird, wohl mit Bestimmtheit
als oberrheinisch zu bezeichnen. Ich darf, um mich nicht zu wiederholen, auf früher Gesagtes verweisen.2
Haberditzl fügt schließlich der ganzen Reihe noch die Barbara Sehr. 1250 und den Georg Sehr. 1435 an, die beide
den gleichen Wechselrahmen zeigen. Diese beiden Schnitte sind später als der Jacobus und Michael, um 1450 entstanden.
1 A. a. O. S. 42. — 2 A. a. O. S. 36 und 391».
— 41 —