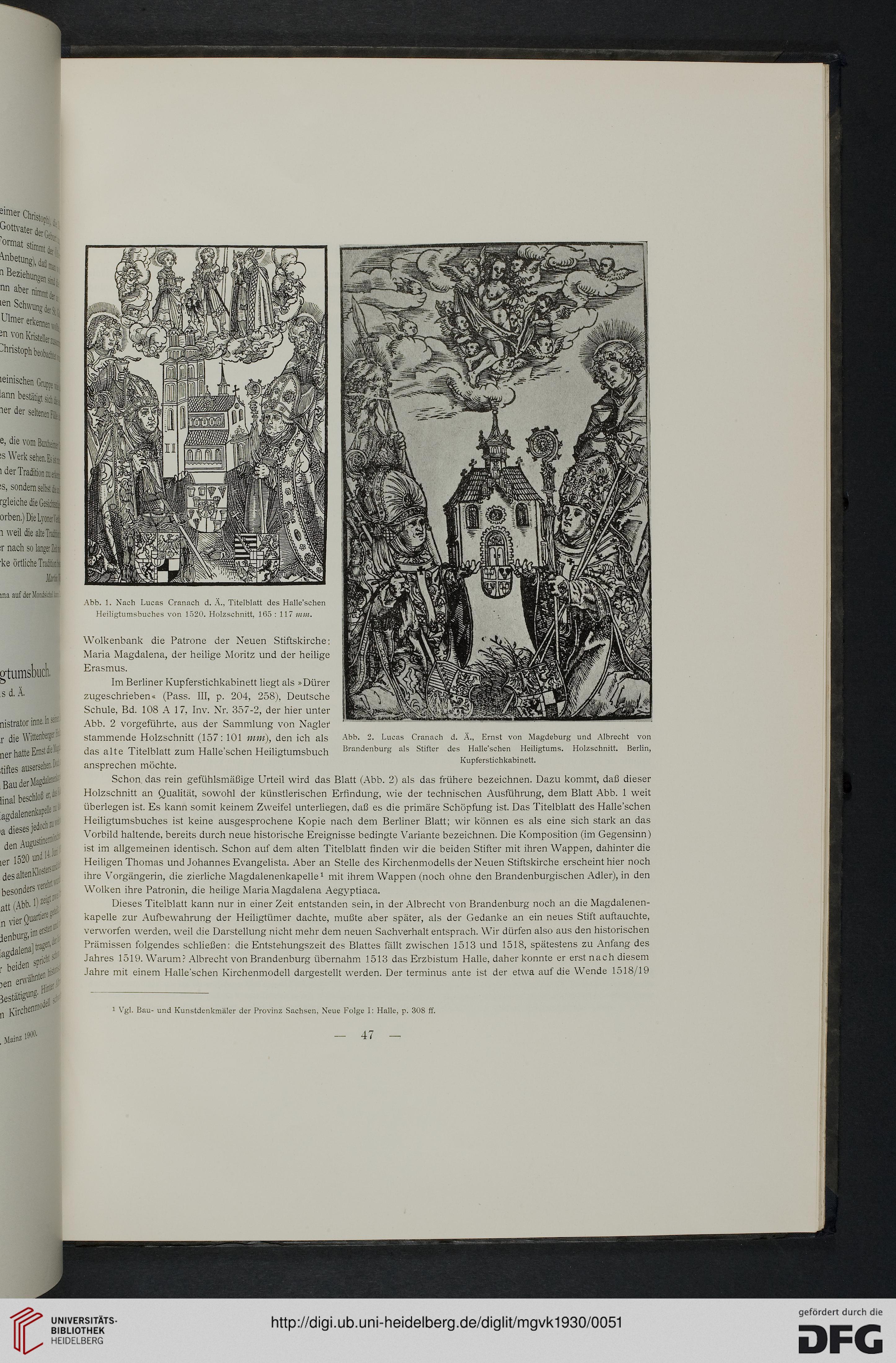reltf«-'
Abb. 2. Lucas Cranacli d. Ä., Ernst von Magdeburg und Albrecht von
Brandenburg als Stifter des Halle'schen Heiligtums. Holzschnitt. Berlin,
Kupferstichkabinett.
Abb. 1. Nach Lucas Cranach d. Ä., Titelblatt des Halle'schen
Heiligtumsbuches von 1520. Holzschnitt, 165 : 117 mm.
Wolkenbank die Patrone der Neuen Stiftskirche:
Maria Magdalena, der heilige Moritz und der heilige
Erasmus.
Im Berliner Kupferstichkabinett liegt als »Dürer
zugeschrieben« (Pass. III, p. 204, 258), Deutsche
Schule, Bd. 108 A 17, Inv. Nr. 357-2, der hier unter
Abb. 2 vorgeführte, aus der Sammlung von Nagler
stammende Holzschnitt (157: 101 mm), den ich als
das alte Titelblatt zum Halle'schen Heiligtumsbuch
ansprechen möchte.
Schon, das rein gefühlsmäßige Urteil wird das Blatt (Abb. 2) als das frühere bezeichnen. Dazu kommt, daß dieser
Holzschnitt an Qualität, sowohl der künstlerischen Erfindung, wie der technischen Ausführung, dem Blatt Abb. 1 weit
überlegen ist. Es kann somit keinem Zweifel unterliegen, daß es die primäre Schöpfung ist. Das Titelblatt des Halle'schen
Heiligtumsbuches ist keine ausgesprochene Kopie nach dem Berliner Blatt; wir können es als eine sich stark an das
Vorbild haltende, bereits durch neue historische Ereignisse bedingte Variante bezeichnen. Die Komposition (im Gegensinn)
ist im allgemeinen identisch. Schon auf dem alten Titelblatt finden wir die beiden Stifter mit ihren Wappen, dahinter die
Heiligen Thomas und Johannes Evangelista. Aber an Stelle des Kirchenmodells der Neuen Stiftskirche erscheint hier noch
ihre Vorgängerin, die zierliche Magdalenenkapelle1 mit ihrem Wappen (noch ohne den Brandenburgischen Adler), in den
Wolken ihre Patronin, die heilige Maria Magdalena Aegyptiaca.
Dieses Titelblatt kann nur in einer Zeit entstanden sein, in der Albrecht von Brandenburg noch an die Magdalenen-
kapelle zur Aufbewahrung der Heiligtümer dachte, mußte aber später, als der Gedanke an ein neues Stift auftauchte,
verworfen werden, weil die Darstellung nicht mehr dem neuen Sachverhalt entsprach. Wir dürfen also aus den historischen
Prämissen folgendes schließen: die Entstehungszeit des Blattes fällt zwischen 1513 und 1518, spätestens zu Anfang des
Jahres 1519. Warum? Albrecht von Brandenburg übernahm 1513 das Erzbistum Halle, daher konnte er erst nach diesem
Jahre mit einem Halle'schen Kirchenmodell dargestellt werden. Der terminus ante ist der etwa auf die Wende 1518/19
1 Vgl. Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen, Neue Folge I: Halle, p. 308 ff.
— 47 —
Abb. 2. Lucas Cranacli d. Ä., Ernst von Magdeburg und Albrecht von
Brandenburg als Stifter des Halle'schen Heiligtums. Holzschnitt. Berlin,
Kupferstichkabinett.
Abb. 1. Nach Lucas Cranach d. Ä., Titelblatt des Halle'schen
Heiligtumsbuches von 1520. Holzschnitt, 165 : 117 mm.
Wolkenbank die Patrone der Neuen Stiftskirche:
Maria Magdalena, der heilige Moritz und der heilige
Erasmus.
Im Berliner Kupferstichkabinett liegt als »Dürer
zugeschrieben« (Pass. III, p. 204, 258), Deutsche
Schule, Bd. 108 A 17, Inv. Nr. 357-2, der hier unter
Abb. 2 vorgeführte, aus der Sammlung von Nagler
stammende Holzschnitt (157: 101 mm), den ich als
das alte Titelblatt zum Halle'schen Heiligtumsbuch
ansprechen möchte.
Schon, das rein gefühlsmäßige Urteil wird das Blatt (Abb. 2) als das frühere bezeichnen. Dazu kommt, daß dieser
Holzschnitt an Qualität, sowohl der künstlerischen Erfindung, wie der technischen Ausführung, dem Blatt Abb. 1 weit
überlegen ist. Es kann somit keinem Zweifel unterliegen, daß es die primäre Schöpfung ist. Das Titelblatt des Halle'schen
Heiligtumsbuches ist keine ausgesprochene Kopie nach dem Berliner Blatt; wir können es als eine sich stark an das
Vorbild haltende, bereits durch neue historische Ereignisse bedingte Variante bezeichnen. Die Komposition (im Gegensinn)
ist im allgemeinen identisch. Schon auf dem alten Titelblatt finden wir die beiden Stifter mit ihren Wappen, dahinter die
Heiligen Thomas und Johannes Evangelista. Aber an Stelle des Kirchenmodells der Neuen Stiftskirche erscheint hier noch
ihre Vorgängerin, die zierliche Magdalenenkapelle1 mit ihrem Wappen (noch ohne den Brandenburgischen Adler), in den
Wolken ihre Patronin, die heilige Maria Magdalena Aegyptiaca.
Dieses Titelblatt kann nur in einer Zeit entstanden sein, in der Albrecht von Brandenburg noch an die Magdalenen-
kapelle zur Aufbewahrung der Heiligtümer dachte, mußte aber später, als der Gedanke an ein neues Stift auftauchte,
verworfen werden, weil die Darstellung nicht mehr dem neuen Sachverhalt entsprach. Wir dürfen also aus den historischen
Prämissen folgendes schließen: die Entstehungszeit des Blattes fällt zwischen 1513 und 1518, spätestens zu Anfang des
Jahres 1519. Warum? Albrecht von Brandenburg übernahm 1513 das Erzbistum Halle, daher konnte er erst nach diesem
Jahre mit einem Halle'schen Kirchenmodell dargestellt werden. Der terminus ante ist der etwa auf die Wende 1518/19
1 Vgl. Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen, Neue Folge I: Halle, p. 308 ff.
— 47 —