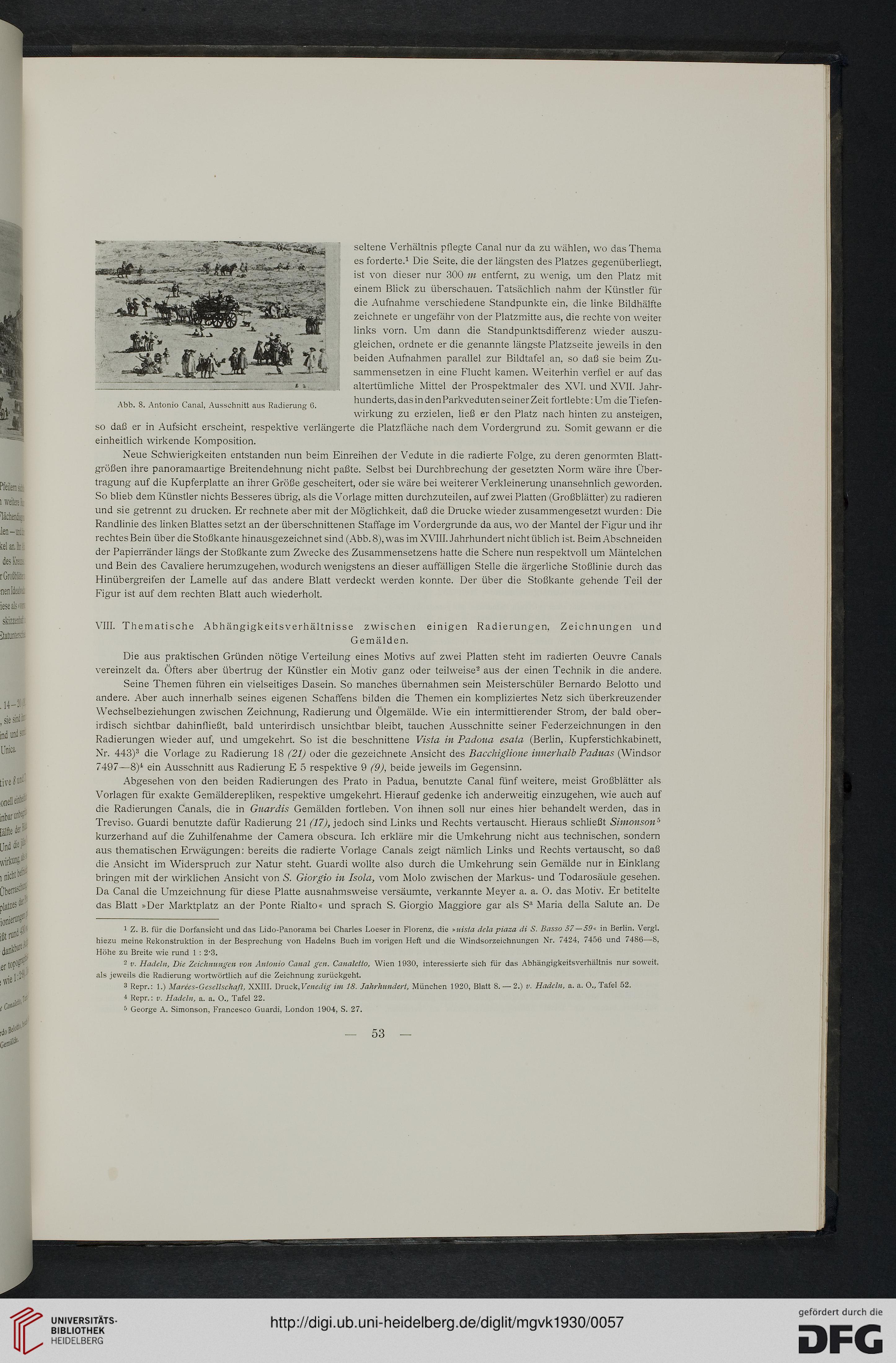seltene Verhältnis pflegte Canal nur da zu wählen, wo das Thema
es forderte.1 Die Seite, die der längsten des Platzes gegenüberliegt,
ist von dieser nur 300 m entfernt, zu wenig, um den Platz mit
einem Blick zu überschauen. Tatsächlich nahm der Künstler für
die Aufnahme verschiedene Standpunkte ein, die linke Bildhälfte
zeichnete er ungefähr von der Platzmitte aus, die rechte von weiter
links vorn. Um dann die Standpunktsdifferenz wieder auszu-
gleichen, ordnete er die genannte längste Platzseite jeweils in den
beiden Aufnahmen parallel zur Bildtafel an, so daß sie beim Zu-
sammensetzen in eine Flucht kamen. Weiterhin verfiel er auf das
altertümliche Mittel der Prospektmaler des XVI. und XVII. Jahr-
hunderts, das in denParkveduten seiner Zeit fortlebte: Um die Tiefen-
wirkung zu erzielen, ließ er den Platz nach hinten zu ansteigen,
so daß er in Aufsicht erscheint, respektive verlängerte die Platzfläche nach dem Vordergrund zu. Somit gewann er die
einheitlich wirkende Komposition.
Neue Schwierigkeiten entstanden nun beim Einreihen der Vedute in die radierte Folge, zu deren genormten Blatt-
größen ihre panoramaartige Breitendehnung nicht paßte. Selbst bei Durchbrechung der gesetzten Norm wäre ihre Über-
tragung auf die Kupferplatte an ihrer Größe gescheitert, oder sie wäre bei weiterer Verkleinerung unansehnlich geworden.
So blieb dem Künstler nichts Besseres übrig, als die Vorlage mitten durchzuteilen, auf zwei Platten (Großblätter) zu radieren
und sie getrennt zu drucken. Er rechnete aber mit der Möglichkeit, daß die Drucke wieder zusammengesetzt wurden: Die
Randlinie des linken Blattes setzt an der überschnittenen Staffage im Vordergrunde da aus, wo der Mantel der Figur und ihr
rechtes Bein über die Stoßkante hinausgezeichnet sind (Abb. 8), was im XVIII. Jahrhundert nicht üblich ist. Beim Abschneiden
der Papierränder längs der Stoßkante zum Zwecke des Zusammensetzens hatte die Schere nun respektvoll um Mäntelchen
und Bein des Cavaliere herumzugehen, wodurch wenigstens an dieser auffälligen Stelle die ärgerliche Stoßlinie durch das
Hinübergreifen der Lamelle auf das andere Blatt verdeckt werden konnte. Der über die Stoßkante gehende Teil der
Figur ist auf dem rechten Blatt auch wiederholt.
VIII. Thematische Abhängigkeitsverhältnisse zwischen einigen Radierungen, Zeichnungen und
Gemälden.
Die aus praktischen Gründen nötige Verteilung eines Motivs auf zwei Platten steht im radierten Oeuvre Canals
vereinzelt da. Öfters aber übertrug der Künstler ein Motiv ganz oder teilweise2 aus der einen Technik in die andere.
Seine Themen führen ein vielseitiges Dasein. So manches übernahmen sein Meisterschüler Bernardo Beiotto und
andere. Aber auch innerhalb seines eigenen Schaffens bilden die Themen ein kompliziertes Netz sich überkreuzender
Wechselbeziehungen zwischen Zeichnung, Radierung und Ölgemälde. Wie ein intermittierender Strom, der bald ober-
irdisch sichtbar dahinfließt, bald unterirdisch unsichtbar bleibt, tauchen Ausschnitte seiner Federzeichnungen in den
Radierungen wieder auf, und umgekehrt. So ist die beschnittene Vista in Padoua esata (Berlin,. Kupferstichkabinett,
Nr. 443)3 die Vorlage zu Radierung 18 (21) oder die gezeichnete Ansicht des Bacchiglione innerhalb Paduas (Windsor
7497—8)* ein Ausschnitt aus Radierung E 5 respektive 9 (9), beide jeweils im Gegensinn.
Abgesehen von den beiden Radierungen des Prato in Padua, benutzte Canal fünf weitere, meist Großblätter als
Vorlagen für exakte Gemälderepliken, respektive umgekehrt. Hierauf gedenke ich anderweitig einzugehen, wie auch auf
die Radierungen Canals, die in Guardis Gemälden fortleben. Von ihnen soll nur eines hier behandelt werden, das in
Treviso. Guardi benutzte dafür Radierung 21 (17), jedoch sind Links und Rechts vertauscht. Hieraus schließt Simonson'"
kurzerhand auf die Zuhilfenahme der Camera obscura. Ich erkläre mir die Umkehrung nicht aus technischen, sondern
aus thematischen Erwägungen: bereits die radierte Vorlage Canals zeigt nämlich Links und Rechts vertauscht, so daß
die Ansicht im Widerspruch zur Natur steht. Guardi wollte also durch die Umkehrung sein Gemälde nur in Einklang
bringen mit der wirklichen Ansicht von S. Giorgio in Isola, vom Molo zwischen der Markus- und Todarosäule gesehen.
Da Canal die Umzeichnung für diese Platte ausnahmsweise versäumte, verkannte Meyer a. a. 0. das Motiv. Er betitelte
das Blatt »Der Marktplatz an der Ponte Rialto« und sprach S. Giorgio Maggiore gar als Sa Maria della Salute an. De
1 Z. B. für die Dorfansicht und das Lido-Panorama bei Charles Loeser in Florenz, die »uisla delapiaza di S. Basso 57—59* in Berlin. Vergl.
hiezu meine Rekonstruktion in der Besprechung von Hadelns Buch im vorigen Heft und die Windsorzeichnungen Nr. 7424, 7456 und 7486—8,
Höhe zu Breite wie rund 1 : 2-3.
2 v. Hadeln, Die Zeichnungen von Antonio Canal gen. Canaletto, Wien 1930, interessierte sich für das Abhängigkeitsverhältnis nur soweit,
als jeweils die Radierung wortwörtlich auf die Zeichnung zurückgeht.
3 Repr.: 1.) Marees-Gesellschaft, XXIII. Druck, Venedig im 18. Jahrhundert, München 1920, Blatt 8.-2.) v. Hadeln, a. a. 0., Tafel 52.
4 Repr.: v. Hadeln, a. a. O., Tafel 22.
5 George A. Simonson, Francesco Guardi, London 1904, S. 27.
Abb. 8. Antonio Canal, Ausschnitt aus Radierung 6.
— 53 —
es forderte.1 Die Seite, die der längsten des Platzes gegenüberliegt,
ist von dieser nur 300 m entfernt, zu wenig, um den Platz mit
einem Blick zu überschauen. Tatsächlich nahm der Künstler für
die Aufnahme verschiedene Standpunkte ein, die linke Bildhälfte
zeichnete er ungefähr von der Platzmitte aus, die rechte von weiter
links vorn. Um dann die Standpunktsdifferenz wieder auszu-
gleichen, ordnete er die genannte längste Platzseite jeweils in den
beiden Aufnahmen parallel zur Bildtafel an, so daß sie beim Zu-
sammensetzen in eine Flucht kamen. Weiterhin verfiel er auf das
altertümliche Mittel der Prospektmaler des XVI. und XVII. Jahr-
hunderts, das in denParkveduten seiner Zeit fortlebte: Um die Tiefen-
wirkung zu erzielen, ließ er den Platz nach hinten zu ansteigen,
so daß er in Aufsicht erscheint, respektive verlängerte die Platzfläche nach dem Vordergrund zu. Somit gewann er die
einheitlich wirkende Komposition.
Neue Schwierigkeiten entstanden nun beim Einreihen der Vedute in die radierte Folge, zu deren genormten Blatt-
größen ihre panoramaartige Breitendehnung nicht paßte. Selbst bei Durchbrechung der gesetzten Norm wäre ihre Über-
tragung auf die Kupferplatte an ihrer Größe gescheitert, oder sie wäre bei weiterer Verkleinerung unansehnlich geworden.
So blieb dem Künstler nichts Besseres übrig, als die Vorlage mitten durchzuteilen, auf zwei Platten (Großblätter) zu radieren
und sie getrennt zu drucken. Er rechnete aber mit der Möglichkeit, daß die Drucke wieder zusammengesetzt wurden: Die
Randlinie des linken Blattes setzt an der überschnittenen Staffage im Vordergrunde da aus, wo der Mantel der Figur und ihr
rechtes Bein über die Stoßkante hinausgezeichnet sind (Abb. 8), was im XVIII. Jahrhundert nicht üblich ist. Beim Abschneiden
der Papierränder längs der Stoßkante zum Zwecke des Zusammensetzens hatte die Schere nun respektvoll um Mäntelchen
und Bein des Cavaliere herumzugehen, wodurch wenigstens an dieser auffälligen Stelle die ärgerliche Stoßlinie durch das
Hinübergreifen der Lamelle auf das andere Blatt verdeckt werden konnte. Der über die Stoßkante gehende Teil der
Figur ist auf dem rechten Blatt auch wiederholt.
VIII. Thematische Abhängigkeitsverhältnisse zwischen einigen Radierungen, Zeichnungen und
Gemälden.
Die aus praktischen Gründen nötige Verteilung eines Motivs auf zwei Platten steht im radierten Oeuvre Canals
vereinzelt da. Öfters aber übertrug der Künstler ein Motiv ganz oder teilweise2 aus der einen Technik in die andere.
Seine Themen führen ein vielseitiges Dasein. So manches übernahmen sein Meisterschüler Bernardo Beiotto und
andere. Aber auch innerhalb seines eigenen Schaffens bilden die Themen ein kompliziertes Netz sich überkreuzender
Wechselbeziehungen zwischen Zeichnung, Radierung und Ölgemälde. Wie ein intermittierender Strom, der bald ober-
irdisch sichtbar dahinfließt, bald unterirdisch unsichtbar bleibt, tauchen Ausschnitte seiner Federzeichnungen in den
Radierungen wieder auf, und umgekehrt. So ist die beschnittene Vista in Padoua esata (Berlin,. Kupferstichkabinett,
Nr. 443)3 die Vorlage zu Radierung 18 (21) oder die gezeichnete Ansicht des Bacchiglione innerhalb Paduas (Windsor
7497—8)* ein Ausschnitt aus Radierung E 5 respektive 9 (9), beide jeweils im Gegensinn.
Abgesehen von den beiden Radierungen des Prato in Padua, benutzte Canal fünf weitere, meist Großblätter als
Vorlagen für exakte Gemälderepliken, respektive umgekehrt. Hierauf gedenke ich anderweitig einzugehen, wie auch auf
die Radierungen Canals, die in Guardis Gemälden fortleben. Von ihnen soll nur eines hier behandelt werden, das in
Treviso. Guardi benutzte dafür Radierung 21 (17), jedoch sind Links und Rechts vertauscht. Hieraus schließt Simonson'"
kurzerhand auf die Zuhilfenahme der Camera obscura. Ich erkläre mir die Umkehrung nicht aus technischen, sondern
aus thematischen Erwägungen: bereits die radierte Vorlage Canals zeigt nämlich Links und Rechts vertauscht, so daß
die Ansicht im Widerspruch zur Natur steht. Guardi wollte also durch die Umkehrung sein Gemälde nur in Einklang
bringen mit der wirklichen Ansicht von S. Giorgio in Isola, vom Molo zwischen der Markus- und Todarosäule gesehen.
Da Canal die Umzeichnung für diese Platte ausnahmsweise versäumte, verkannte Meyer a. a. 0. das Motiv. Er betitelte
das Blatt »Der Marktplatz an der Ponte Rialto« und sprach S. Giorgio Maggiore gar als Sa Maria della Salute an. De
1 Z. B. für die Dorfansicht und das Lido-Panorama bei Charles Loeser in Florenz, die »uisla delapiaza di S. Basso 57—59* in Berlin. Vergl.
hiezu meine Rekonstruktion in der Besprechung von Hadelns Buch im vorigen Heft und die Windsorzeichnungen Nr. 7424, 7456 und 7486—8,
Höhe zu Breite wie rund 1 : 2-3.
2 v. Hadeln, Die Zeichnungen von Antonio Canal gen. Canaletto, Wien 1930, interessierte sich für das Abhängigkeitsverhältnis nur soweit,
als jeweils die Radierung wortwörtlich auf die Zeichnung zurückgeht.
3 Repr.: 1.) Marees-Gesellschaft, XXIII. Druck, Venedig im 18. Jahrhundert, München 1920, Blatt 8.-2.) v. Hadeln, a. a. 0., Tafel 52.
4 Repr.: v. Hadeln, a. a. O., Tafel 22.
5 George A. Simonson, Francesco Guardi, London 1904, S. 27.
Abb. 8. Antonio Canal, Ausschnitt aus Radierung 6.
— 53 —