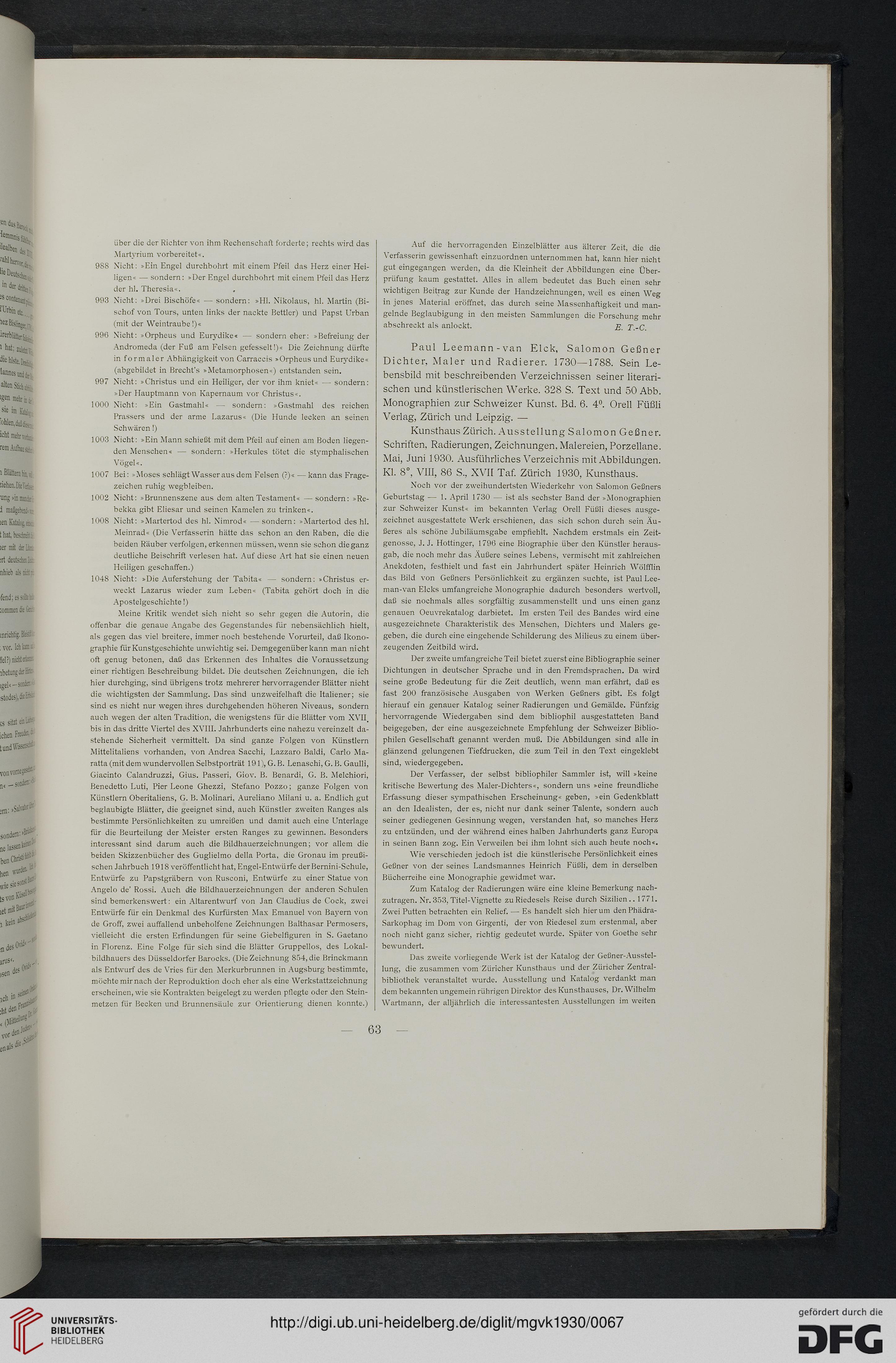über die der Richter von ihm Rechenschaft forderte; rechts wird das
Martyrium vorbereitet«.
9SS Nicht: »Ein Engel durchbohrt mit einem Pfeil das Herz einer Hei-
ligen« — sondern: »Der Engel durchbohrt mit einem Pfeil das Herz
der hl. Theresia«.
993 Nicht: »Drei Bischöfe« — sondern: >H1. Nikolaus, hl. Martin (Bi-
schof von Tours, unten links der nackte Bettler) und Papst Urban
(mit der Weintraube!)«
996 Nicht: »Orpheus und Eurydike« — sondern eher: »Befreiung der
Andromeda (der Fuß am Felsen gefesselt!)« Die Zeichnung dürfte
in formaler Abhängigkeit von Carraccis »Orpheusund Eurydike«
(abgebildet in Brecht's »Metamorphosen«) entstanden sein.
997 Nicht: »Christus und ein Heiliger, der vor ihm kniet« — sondern:
»Der Hauptmann von Kapernaum vor Christus«.
1000 Nicht: »Ein Gastmahl« — sondern: »Gastmahl des reichen
Prassers und der arme Lazarus« (Die Hunde lecken an seinen
Schwären!)
1003 Nicht: »Ein Mann schießt mit dem Pfeil auf einen am Boden liegen-
den Menschen« — sondern: »Herkules tötet die stympbalischen
Vögel«.
1007 Bei: »Moses schlägt Wasser aus dem Felsen (?)« — kann das Frage-
zeichen ruhig wegbleiben.
1002 Nicht: »Brunnenszene aus dem alten Testament« — sondern: »Re-
bekka gibt Eliesar und seinen Kamelen zu trinken«.
1008 Nicht: »Martertod des hl. Nimrod« — sondern: »Martertod des hl.
Meinrad« (Die Verfasserin hätte das schon an den Raben, die die
beiden Räuber verfolgen, erkennen müssen, wenn sie schon die ganz
deutliche Beischrift verlesen hat. Auf diese Art hat sie einen neuen
Heiligen geschaffen.)
1048 Nicht: »Die Auferstehung der Tabita« — sondern: »Christus er-
weckt Lazarus wieder zum Leben« (Tabita gehört doch in die
Apostelgeschichte!)
Meine Kritik wendet sich nicht so sehr gegen die Autorin, die
offenbar die genaue Angabe des Gegenstandes für nebensächlich hielt,
als gegen das viel breitere, immer noch bestehende Vorurteil, daß Ikono-
graphie für Kunstgeschichte unwichtig sei. Demgegenüber kann man nicht
oft genug betonen, daß das Erkennen des Inhaltes die Voraussetzung
einer richtigen Beschreibung bildet. Die deutschen Zeichnungen, die ich
hier durchging, sind übrigens trotz mehrerer hervorragender Blätter nicht
die wichtigsten der Sammlung. Das sind unzweifelhaft die Italiener; sie
sind es nicht nur wegen ihres durchgehenden höheren Niveaus, sondern
auch wegen der alten Tradition, die wenigstens für die Blätter vom XVII.
bis in das dritte Viertel des XVIII. Jahrhunderts eine nahezu vereinzelt da-
stehende Sicherheit vermittelt. Da sind ganze Folgen von Künstlern
Mittelitaliens vorhanden, von Andrea Sacchi, Lazzaro Baldi, Carlo Ma-
ratta (mit dem wundervollen Selbstporträt 191), G. B. Lenaschi, G. B. Gaulli,
Giacinto Calandruzzi, Gius. Passeri, Giov. B. Benardi, G. B. Melchiori,
Benedetto Luti, Pier Leone Ghezzi, Stefano Pozzo; ganze Folgen von
Künstlern Oberitaliens, G. B. Molinari, Aureliano Milani u. a. Endlich gut
beglaubigte Blätter, die geeignet sind, auch Künstler zweiten Ranges als
bestimmte Persönlichkeiten zu umreißen und damit auch eine Unterlage
für die Beurteilung der Meister ersten Ranges zu gewinnen. Besonders
interessant sind darum auch die Bildhauerzeichnungen; vor allem die
beiden Skizzenbücher des Guglielmo della Porta, die Gronau im preußi-
schen Jahrbuch 1918 veröffentlicht hat, Engel-Entwürfe der Bernini-Schule,
Entwürfe zu Papstgräbern von Rusconi, Entwürfe zu einer Statue von
Angelo de' Rossi. Auch die Bildhauerzeichnungen der anderen Schulen
sind bemerkenswert: ein Altarentwurf von Jan Claudius de Cock, zwei
Entwürfe für ein Denkmal des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern von
de Groff, zwei auffallend unbeholfene Zeichnungen Balthasar Permosers,
vielleicht die ersten Erfindungen für seine Giebelfiguren in S. Gaetano
in Florenz. Eine Folge für sich sind die Blätter Gruppellos, des Lokal-
bildhauers des Düsseldorfer Barocks. (Die Zeichnung 854, die Brinckmann
als Entwurf des de Vries für den Merkurbrunnen in Augsburg bestimmte,
möchte mir nach der Reproduktion doch eher als eine Werkstattzeichnung
erscheinen, wie sie Kontrakten beigelegt zu werden pflegte oder den Stein-
metzen für Becken und Brunnensäule zur Orientierung dienen konnte.)
Auf die hervorragenden Einzelblätter aus älterer Zeit, die die
Verfasserin gewissenhaft einzuordnen unternommen hat, kann hier nicht
gut eingegangen werden, da die Kleinheit der Abbildungen eine Über-
prüfung kaum gestattet. Alles in allem bedeutet das Buch einen sehr
wichtigen Beitrag zur Kunde der Handzeichnungen, weil es einen Weg
in jenes Material eröffnet, das durch seine Massenhaftigkeit und man-
gelnde Beglaubigung in den meisten Sammlungen die Forschung mehr
abschreckt als anlockt. T.-C
Paul Leemann-van Eick, Salomon Geßner
Dichter, Maler und Radierer. 1730—1788. Sein Le-
bensbild mit beschreibenden Verzeichnissen seiner literari-
schen und künstlerischen Werke. 328 S. Text und 50 Abb.
Monographien zur Schweizer Kunst. Bd. 6. 4°. Orell Füßli
Verlag, Zürich und Leipzig. —
Kunsthaus Zürich. Ausstellung Salomon Geßner.
Schriften, Radierungen, Zeichnungen, Malereien, Porzellane.
Mai, Juni 1930. Ausführliches Verzeichnis mit Abbildungen.
Kl. 8°, VHI, 86 S., XVII Taf. Zürich 1930, Kunsthaus.
Noch vor der zweihundertsten Wiederkehr von Salomon Geßners
Geburtstag — 1. April 1730 — ist als sechster Band der »Monographien
zur Schweizer Kunst« im bekannten Verlag Orell Füßli dieses ausge-
zeichnet ausgestattete Werk erschienen, das sich schon durch sein Äu-
ßeres als schöne Jubiläumsgabe empfiehlt. Nachdem erstmals ein Zeit-
genosse, J. J. Hottinger, 1796 eine Biographie über den Künstler heraus-
gab, die noch mehr das Äußere seines Lebens, vermischt mit zahlreichen
Anekdoten, festhielt und fast ein Jahrhundert später Heinrich Wölfflin
das Bild von Geßners Persönlichkeit zu ergänzen suchte, ist Paul Lee-
man-van Eicks umfangreiche Monographie dadurch besonders wertvoll,
daß sie nochmals alles sorgfältig zusammenstellt und uns einen ganz
genauen Oeuvrekatalog darbietet. Im ersten Teil des Bandes wird eine
ausgezeichnete Charakteristik des Menschen, Dichters und Malers ge-
geben, die durch eine eingehende Schilderung des Milieus zu einem über-
zeugenden Zeitbild wird.
Der zweite umfangreiche Teil bietet zuerst eine Bibliographie seiner
Dichtungen in deutscher Sprache und in den Fremdsprachen. Da wird
seine große Bedeutung für die Zeit deutlich, wenn man erfährt, daß es
fast 200 französische Ausgaben von Werken Geßners gibt. Es folgt
hierauf ein genauer Katalog seiner Radierungen und Gemälde. Fünfzig
hervorragende Wiedergaben sind dem bibliophil ausgestatteten Band
beigegeben, der eine ausgezeichnete Empfehlung der Schweizer Biblio-
philen Gesellschaft genannt werden muß. Die Abbildungen sind alle in
glänzend gelungenen Tiefdrucken, die zum Teil in den Text eingeklebt
sind, wiedergegeben.
Der Verfasser, der selbst bibliophiler Sammler ist, will »keine
kritische Bewertung des Maler-Dichters«, sondern uns »eine freundliche
Erfassung dieser sympathischen Erscheinung« geben, »ein Gedenkblatt
an den Idealisten, der es, nicht nur dank seiner Talente, sondern auch
seiner gediegenen Gesinnung wegen, verstanden hat, so manches Herz
zu entzünden, und der während eines halben Jahrhunderts ganz Europa
in seinen Bann zog. Ein Verweilen bei ihm lohnt sich auch heute noch«.
Wie verschieden jedoch ist die künstlerische Persönlichkeit eines
Geßner von der seines Landsmannes Heinrich Füßli, dem in derselben
Bücherreihe eine Monographie gewidmet war.
Zum Katalog der Radierungen wäre eine kleine Bemerkung nach-
zutragen. Nr. 353. Titel-Vignette zu Riedesels Reise durch Sizilien.. 1771.
Zwei Putten betrachten ein Relief. — Es handelt sich hierum den Phädra-
Sarkophag im Dom von Girgenti, der von Riedesel zum erstenmal, aber
noch nicht ganz sicher, richtig gedeutet wurde. Später von Goethe sehr
bewundert.
Das zweite vorliegende Werk ist der Katalog der Geßner-Ausstel-
Iung, die zusammen vom Züricher Kunsthaus und der Züricher Zentral-
bibliothek veranstaltet wurde. Ausstellung und Katalog verdankt man
dem bekannten ungemein rührigen Direktor des Kunsthauses, Dr. Wilhelm
Wartmann, der alljährlich die interessantesten Ausstellungen im weiten
Martyrium vorbereitet«.
9SS Nicht: »Ein Engel durchbohrt mit einem Pfeil das Herz einer Hei-
ligen« — sondern: »Der Engel durchbohrt mit einem Pfeil das Herz
der hl. Theresia«.
993 Nicht: »Drei Bischöfe« — sondern: >H1. Nikolaus, hl. Martin (Bi-
schof von Tours, unten links der nackte Bettler) und Papst Urban
(mit der Weintraube!)«
996 Nicht: »Orpheus und Eurydike« — sondern eher: »Befreiung der
Andromeda (der Fuß am Felsen gefesselt!)« Die Zeichnung dürfte
in formaler Abhängigkeit von Carraccis »Orpheusund Eurydike«
(abgebildet in Brecht's »Metamorphosen«) entstanden sein.
997 Nicht: »Christus und ein Heiliger, der vor ihm kniet« — sondern:
»Der Hauptmann von Kapernaum vor Christus«.
1000 Nicht: »Ein Gastmahl« — sondern: »Gastmahl des reichen
Prassers und der arme Lazarus« (Die Hunde lecken an seinen
Schwären!)
1003 Nicht: »Ein Mann schießt mit dem Pfeil auf einen am Boden liegen-
den Menschen« — sondern: »Herkules tötet die stympbalischen
Vögel«.
1007 Bei: »Moses schlägt Wasser aus dem Felsen (?)« — kann das Frage-
zeichen ruhig wegbleiben.
1002 Nicht: »Brunnenszene aus dem alten Testament« — sondern: »Re-
bekka gibt Eliesar und seinen Kamelen zu trinken«.
1008 Nicht: »Martertod des hl. Nimrod« — sondern: »Martertod des hl.
Meinrad« (Die Verfasserin hätte das schon an den Raben, die die
beiden Räuber verfolgen, erkennen müssen, wenn sie schon die ganz
deutliche Beischrift verlesen hat. Auf diese Art hat sie einen neuen
Heiligen geschaffen.)
1048 Nicht: »Die Auferstehung der Tabita« — sondern: »Christus er-
weckt Lazarus wieder zum Leben« (Tabita gehört doch in die
Apostelgeschichte!)
Meine Kritik wendet sich nicht so sehr gegen die Autorin, die
offenbar die genaue Angabe des Gegenstandes für nebensächlich hielt,
als gegen das viel breitere, immer noch bestehende Vorurteil, daß Ikono-
graphie für Kunstgeschichte unwichtig sei. Demgegenüber kann man nicht
oft genug betonen, daß das Erkennen des Inhaltes die Voraussetzung
einer richtigen Beschreibung bildet. Die deutschen Zeichnungen, die ich
hier durchging, sind übrigens trotz mehrerer hervorragender Blätter nicht
die wichtigsten der Sammlung. Das sind unzweifelhaft die Italiener; sie
sind es nicht nur wegen ihres durchgehenden höheren Niveaus, sondern
auch wegen der alten Tradition, die wenigstens für die Blätter vom XVII.
bis in das dritte Viertel des XVIII. Jahrhunderts eine nahezu vereinzelt da-
stehende Sicherheit vermittelt. Da sind ganze Folgen von Künstlern
Mittelitaliens vorhanden, von Andrea Sacchi, Lazzaro Baldi, Carlo Ma-
ratta (mit dem wundervollen Selbstporträt 191), G. B. Lenaschi, G. B. Gaulli,
Giacinto Calandruzzi, Gius. Passeri, Giov. B. Benardi, G. B. Melchiori,
Benedetto Luti, Pier Leone Ghezzi, Stefano Pozzo; ganze Folgen von
Künstlern Oberitaliens, G. B. Molinari, Aureliano Milani u. a. Endlich gut
beglaubigte Blätter, die geeignet sind, auch Künstler zweiten Ranges als
bestimmte Persönlichkeiten zu umreißen und damit auch eine Unterlage
für die Beurteilung der Meister ersten Ranges zu gewinnen. Besonders
interessant sind darum auch die Bildhauerzeichnungen; vor allem die
beiden Skizzenbücher des Guglielmo della Porta, die Gronau im preußi-
schen Jahrbuch 1918 veröffentlicht hat, Engel-Entwürfe der Bernini-Schule,
Entwürfe zu Papstgräbern von Rusconi, Entwürfe zu einer Statue von
Angelo de' Rossi. Auch die Bildhauerzeichnungen der anderen Schulen
sind bemerkenswert: ein Altarentwurf von Jan Claudius de Cock, zwei
Entwürfe für ein Denkmal des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern von
de Groff, zwei auffallend unbeholfene Zeichnungen Balthasar Permosers,
vielleicht die ersten Erfindungen für seine Giebelfiguren in S. Gaetano
in Florenz. Eine Folge für sich sind die Blätter Gruppellos, des Lokal-
bildhauers des Düsseldorfer Barocks. (Die Zeichnung 854, die Brinckmann
als Entwurf des de Vries für den Merkurbrunnen in Augsburg bestimmte,
möchte mir nach der Reproduktion doch eher als eine Werkstattzeichnung
erscheinen, wie sie Kontrakten beigelegt zu werden pflegte oder den Stein-
metzen für Becken und Brunnensäule zur Orientierung dienen konnte.)
Auf die hervorragenden Einzelblätter aus älterer Zeit, die die
Verfasserin gewissenhaft einzuordnen unternommen hat, kann hier nicht
gut eingegangen werden, da die Kleinheit der Abbildungen eine Über-
prüfung kaum gestattet. Alles in allem bedeutet das Buch einen sehr
wichtigen Beitrag zur Kunde der Handzeichnungen, weil es einen Weg
in jenes Material eröffnet, das durch seine Massenhaftigkeit und man-
gelnde Beglaubigung in den meisten Sammlungen die Forschung mehr
abschreckt als anlockt. T.-C
Paul Leemann-van Eick, Salomon Geßner
Dichter, Maler und Radierer. 1730—1788. Sein Le-
bensbild mit beschreibenden Verzeichnissen seiner literari-
schen und künstlerischen Werke. 328 S. Text und 50 Abb.
Monographien zur Schweizer Kunst. Bd. 6. 4°. Orell Füßli
Verlag, Zürich und Leipzig. —
Kunsthaus Zürich. Ausstellung Salomon Geßner.
Schriften, Radierungen, Zeichnungen, Malereien, Porzellane.
Mai, Juni 1930. Ausführliches Verzeichnis mit Abbildungen.
Kl. 8°, VHI, 86 S., XVII Taf. Zürich 1930, Kunsthaus.
Noch vor der zweihundertsten Wiederkehr von Salomon Geßners
Geburtstag — 1. April 1730 — ist als sechster Band der »Monographien
zur Schweizer Kunst« im bekannten Verlag Orell Füßli dieses ausge-
zeichnet ausgestattete Werk erschienen, das sich schon durch sein Äu-
ßeres als schöne Jubiläumsgabe empfiehlt. Nachdem erstmals ein Zeit-
genosse, J. J. Hottinger, 1796 eine Biographie über den Künstler heraus-
gab, die noch mehr das Äußere seines Lebens, vermischt mit zahlreichen
Anekdoten, festhielt und fast ein Jahrhundert später Heinrich Wölfflin
das Bild von Geßners Persönlichkeit zu ergänzen suchte, ist Paul Lee-
man-van Eicks umfangreiche Monographie dadurch besonders wertvoll,
daß sie nochmals alles sorgfältig zusammenstellt und uns einen ganz
genauen Oeuvrekatalog darbietet. Im ersten Teil des Bandes wird eine
ausgezeichnete Charakteristik des Menschen, Dichters und Malers ge-
geben, die durch eine eingehende Schilderung des Milieus zu einem über-
zeugenden Zeitbild wird.
Der zweite umfangreiche Teil bietet zuerst eine Bibliographie seiner
Dichtungen in deutscher Sprache und in den Fremdsprachen. Da wird
seine große Bedeutung für die Zeit deutlich, wenn man erfährt, daß es
fast 200 französische Ausgaben von Werken Geßners gibt. Es folgt
hierauf ein genauer Katalog seiner Radierungen und Gemälde. Fünfzig
hervorragende Wiedergaben sind dem bibliophil ausgestatteten Band
beigegeben, der eine ausgezeichnete Empfehlung der Schweizer Biblio-
philen Gesellschaft genannt werden muß. Die Abbildungen sind alle in
glänzend gelungenen Tiefdrucken, die zum Teil in den Text eingeklebt
sind, wiedergegeben.
Der Verfasser, der selbst bibliophiler Sammler ist, will »keine
kritische Bewertung des Maler-Dichters«, sondern uns »eine freundliche
Erfassung dieser sympathischen Erscheinung« geben, »ein Gedenkblatt
an den Idealisten, der es, nicht nur dank seiner Talente, sondern auch
seiner gediegenen Gesinnung wegen, verstanden hat, so manches Herz
zu entzünden, und der während eines halben Jahrhunderts ganz Europa
in seinen Bann zog. Ein Verweilen bei ihm lohnt sich auch heute noch«.
Wie verschieden jedoch ist die künstlerische Persönlichkeit eines
Geßner von der seines Landsmannes Heinrich Füßli, dem in derselben
Bücherreihe eine Monographie gewidmet war.
Zum Katalog der Radierungen wäre eine kleine Bemerkung nach-
zutragen. Nr. 353. Titel-Vignette zu Riedesels Reise durch Sizilien.. 1771.
Zwei Putten betrachten ein Relief. — Es handelt sich hierum den Phädra-
Sarkophag im Dom von Girgenti, der von Riedesel zum erstenmal, aber
noch nicht ganz sicher, richtig gedeutet wurde. Später von Goethe sehr
bewundert.
Das zweite vorliegende Werk ist der Katalog der Geßner-Ausstel-
Iung, die zusammen vom Züricher Kunsthaus und der Züricher Zentral-
bibliothek veranstaltet wurde. Ausstellung und Katalog verdankt man
dem bekannten ungemein rührigen Direktor des Kunsthauses, Dr. Wilhelm
Wartmann, der alljährlich die interessantesten Ausstellungen im weiten