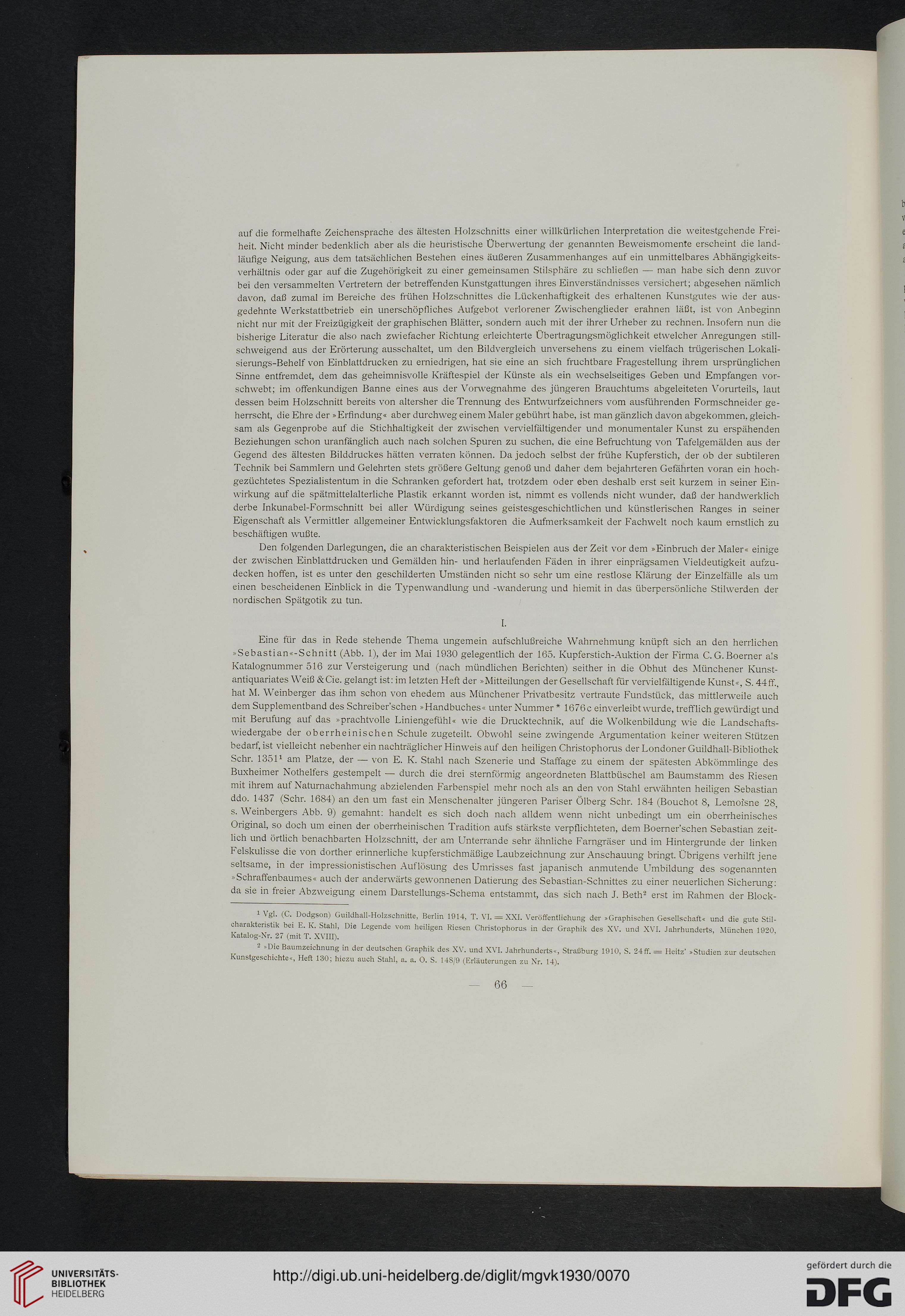auf die formelhafte Zeichensprache des ältesten Holzschnitts einer willkürlichen Interpretation die weitestgehende Frei-
heit. Nicht minder bedenklich aber als die heuristische Überwertung der genannten Beweismomente erscheint die land-
läufige Neigung, aus dem tatsächlichen Bestehen eines äußeren Zusammenhanges auf ein unmittelbares Abhängigkeits-
verhältnis oder gar auf die Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Stilsphäre zu schließen — man habe sich denn zuvor
bei den versammelten Vertretern der betreffenden Kunstgattungen ihres Einverständnisses versichert; abgesehen nämlich
davon, daß zumal im Bereiche des frühen Holzschnittes die Lückenhaftigkeit des erhaltenen Kunstgutes wie der aus-
gedehnte Werkstattbetrieb ein unerschöpfliches Aufgebot verlorener Zwischenglieder erahnen läßt, ist von Anbeginn
nicht nur mit der Freizügigkeit der graphischen Blätter, sondern auch mit der ihrer Urheber zu rechnen. Insofern nun die
bisherige Literatur die also nach zwiefacher Richtung erleichterte Übertragungsmöglichkeit etwelcher Anregungen still-
schweigend aus der Erörterung ausschaltet, um den Bildvergleich unversehens zu einem vielfach trügerischen Lokali-
sierungs-Behelf von Einblattdrucken zu erniedrigen, hat sie eine an sich fruchtbare Fragestellung ihrem ursprünglichen
Sinne entfremdet, dem das geheimnisvolle Kräftespiel der Künste als ein wechselseitiges Geben und Empfangen vor-
schwebt; im offenkundigen Banne eines aus der Vorwegnahme des jüngeren Brauchtums abgeleiteten Vorurteils, laut
dessen beim Holzschnitt bereits von altersher die Trennung des Entwurfzeichners vom ausführenden Formschneider ge-
herrscht, die Ehre der »Erfindung« aber durchweg einem Maler gebührt habe, ist man gänzlich davon abgekommen, gleich-
sam als Gegenprobe auf die Stichhaltigkeit der zwischen vervielfältigender und monumentaler Kunst zu erspähenden
Beziehungen schon uranfänglich auch nach solchen Spuren zu suchen, die eine Befruchtung von Tafelgemälden aus der
Gegend des ältesten Bilddruckes hätten verraten können. Da jedoch selbst der frühe Kupferstich, der ob der subtileren
Technik bei Sammlern und Gelehrten stets größere Geltung genoß und daher dem bejahrteren Gefährten voran ein hoch-
gezüchtetes Spezialistentum in die Schranken gefordert hat, trotzdem oder eben deshalb erst seit kurzem in seiner Ein-
wirkung auf die spätmittelalterliche Plastik erkannt worden ist, nimmt es vollends nicht wunder, daß der handwerklich
derbe Inkunabel-Formschnitt bei aller Würdigung seines geistesgeschichtlichen und künstlerischen Ranges in seiner
Eigenschaft als Vermittler allgemeiner Entwicklungsfaktoren die Aufmerksamkeit der Fachwelt noch kaum ernstlich zu
beschäftigen wußte.
Den folgenden Darlegungen, die an charakteristischen Beispielen aus der Zeit vor dem »Einbruch der Maler« einige
der zwischen Einblattdrucken und Gemälden hin- und herlaufenden Fäden in ihrer einprägsamen Vieldeutigkeit aufzu-
decken hoffen, ist es unter den geschilderten Umständen nicht so sehr um eine restlose Klärung der Einzelfälle als um
einen bescheidenen Einblick in die Typenwandlung und -Wanderung und hiemit in das überpersönliche Stilwerden der
nordischen Spätgotik zu tun.
I.
Eine für das in Rede stehende Thema ungemein aufschlußreiche Wahrnehmung knüpft sich an den herrlichen
»Sebastian«-Schnitt (Abb. 1), der im Mai 1930 gelegentlich der 165. Kupferstich-Auktion der Firma C. G. Boerner als
Katalognummer 516 zur Versteigerung und (nach mündlichen Berichten) seither in die Obhut des Münchener Kunst-
antiquariates Weiß &Cie. gelangt ist: im letzten Heft der »Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst«, S. 44 ff.,
hat M. Weinberger das ihm schon von ehedem aus Münchener Privatbesitz vertraute Fundstück, das mittlerweile auch
dem Supplementband des Schreiber'schen »Handbuches« unter Nummer * 1676c einverleibt wurde, trefflich gewürdigt und
mit Berufung auf das »prachtvolle Liniengefühl« wie die Drucktechnik, auf die Wolkenbildung wie die Landschafts-
wiedergabe der oberrheinischen Schule zugeteilt. Obwohl seine zwingende Argumentation keiner weiteren Stützen
bedarf, ist vielleicht nebenher ein nachträglicher Hinweis auf den heiligen Christopherus der Londoner Guildhall-Bibliothek
Sehr. 13511 am Platze, der — von E. K. Stahl nach Szenerie und Staffage zu einem der spätesten Abkömmlinge des
Buxheimer Nothelfers gestempelt — durch die drei sternförmig angeordneten Blattbüschel am Baumstamm des Riesen
mit ihrem auf Naturnachahmung abzielenden Farbenspiel mehr noch als an den von Stahl erwähnten heiligen Sebastian
ddo. 1437 (Sehr. 1684) an den um fast ein Menschenalter jüngeren Pariser Ölberg Sehr. 184 (Bouchot 8, Lemoisne 28,
s. Weinbergers Abb. 9) gemahnt: handelt es sich doch nach alldem wenn nicht unbedingt um ein oberrheinisches
Original, so doch um einen der oberrheinischen Tradition aufs stärkste verpflichteten, dem Boerner'schen Sebastian zeit-
lich und örtlich benachbarten Holzschnitt, der am Unterrande sehr ähnliche Farngräser und im Hintergrunde der linken
Felskulisse die von dorther erinnerliche kupferstichmäßige Laubzeichnung zur Anschauung bringt. Übrigens verhilft jene
seltsame, in der impressionistischen Auflösung des Umrisses fast japanisch anmutende Umbildung des sogenannten
»Schraffenbaumes« auch der anderwärts gewonnenen Datierung des Sebastian-Schnittes zu einer neuerlichen Sicherung:
da sie in freier Abzweigung einem Darstellungs-Schema entstammt, das sich nach J. Beth2 erst im Rahmen der Block-
1 Vgl. (C. Dodgson) Guildhall-Holzschnitte. Berlin 1014, T. VI. = XXI. Veröffentlichung der »Graphischen Gesellschaft« und die gute Stil-
charakteristik bei E. K. Stahl, Die Legende vom heiligen Riesen Christophorus in der Graphik des XV. und XVI. Jahrhunderts, München 1020
Katalog-Nr. 27 (mit T. XVIII).
2 »Die Baumzeichnung in der deutschen Graphik des XV. und XVI. Jahrhunderts«, Straßburg 1910, S. 24ff. = Heitz' »Studien zur deutschen
Kunstgeschichte«, Heft 130; hiezu auch Stahl, a. a. 0. S. 14S/9 (Erläuterungen zu Nr. 14).
66 —
heit. Nicht minder bedenklich aber als die heuristische Überwertung der genannten Beweismomente erscheint die land-
läufige Neigung, aus dem tatsächlichen Bestehen eines äußeren Zusammenhanges auf ein unmittelbares Abhängigkeits-
verhältnis oder gar auf die Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Stilsphäre zu schließen — man habe sich denn zuvor
bei den versammelten Vertretern der betreffenden Kunstgattungen ihres Einverständnisses versichert; abgesehen nämlich
davon, daß zumal im Bereiche des frühen Holzschnittes die Lückenhaftigkeit des erhaltenen Kunstgutes wie der aus-
gedehnte Werkstattbetrieb ein unerschöpfliches Aufgebot verlorener Zwischenglieder erahnen läßt, ist von Anbeginn
nicht nur mit der Freizügigkeit der graphischen Blätter, sondern auch mit der ihrer Urheber zu rechnen. Insofern nun die
bisherige Literatur die also nach zwiefacher Richtung erleichterte Übertragungsmöglichkeit etwelcher Anregungen still-
schweigend aus der Erörterung ausschaltet, um den Bildvergleich unversehens zu einem vielfach trügerischen Lokali-
sierungs-Behelf von Einblattdrucken zu erniedrigen, hat sie eine an sich fruchtbare Fragestellung ihrem ursprünglichen
Sinne entfremdet, dem das geheimnisvolle Kräftespiel der Künste als ein wechselseitiges Geben und Empfangen vor-
schwebt; im offenkundigen Banne eines aus der Vorwegnahme des jüngeren Brauchtums abgeleiteten Vorurteils, laut
dessen beim Holzschnitt bereits von altersher die Trennung des Entwurfzeichners vom ausführenden Formschneider ge-
herrscht, die Ehre der »Erfindung« aber durchweg einem Maler gebührt habe, ist man gänzlich davon abgekommen, gleich-
sam als Gegenprobe auf die Stichhaltigkeit der zwischen vervielfältigender und monumentaler Kunst zu erspähenden
Beziehungen schon uranfänglich auch nach solchen Spuren zu suchen, die eine Befruchtung von Tafelgemälden aus der
Gegend des ältesten Bilddruckes hätten verraten können. Da jedoch selbst der frühe Kupferstich, der ob der subtileren
Technik bei Sammlern und Gelehrten stets größere Geltung genoß und daher dem bejahrteren Gefährten voran ein hoch-
gezüchtetes Spezialistentum in die Schranken gefordert hat, trotzdem oder eben deshalb erst seit kurzem in seiner Ein-
wirkung auf die spätmittelalterliche Plastik erkannt worden ist, nimmt es vollends nicht wunder, daß der handwerklich
derbe Inkunabel-Formschnitt bei aller Würdigung seines geistesgeschichtlichen und künstlerischen Ranges in seiner
Eigenschaft als Vermittler allgemeiner Entwicklungsfaktoren die Aufmerksamkeit der Fachwelt noch kaum ernstlich zu
beschäftigen wußte.
Den folgenden Darlegungen, die an charakteristischen Beispielen aus der Zeit vor dem »Einbruch der Maler« einige
der zwischen Einblattdrucken und Gemälden hin- und herlaufenden Fäden in ihrer einprägsamen Vieldeutigkeit aufzu-
decken hoffen, ist es unter den geschilderten Umständen nicht so sehr um eine restlose Klärung der Einzelfälle als um
einen bescheidenen Einblick in die Typenwandlung und -Wanderung und hiemit in das überpersönliche Stilwerden der
nordischen Spätgotik zu tun.
I.
Eine für das in Rede stehende Thema ungemein aufschlußreiche Wahrnehmung knüpft sich an den herrlichen
»Sebastian«-Schnitt (Abb. 1), der im Mai 1930 gelegentlich der 165. Kupferstich-Auktion der Firma C. G. Boerner als
Katalognummer 516 zur Versteigerung und (nach mündlichen Berichten) seither in die Obhut des Münchener Kunst-
antiquariates Weiß &Cie. gelangt ist: im letzten Heft der »Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst«, S. 44 ff.,
hat M. Weinberger das ihm schon von ehedem aus Münchener Privatbesitz vertraute Fundstück, das mittlerweile auch
dem Supplementband des Schreiber'schen »Handbuches« unter Nummer * 1676c einverleibt wurde, trefflich gewürdigt und
mit Berufung auf das »prachtvolle Liniengefühl« wie die Drucktechnik, auf die Wolkenbildung wie die Landschafts-
wiedergabe der oberrheinischen Schule zugeteilt. Obwohl seine zwingende Argumentation keiner weiteren Stützen
bedarf, ist vielleicht nebenher ein nachträglicher Hinweis auf den heiligen Christopherus der Londoner Guildhall-Bibliothek
Sehr. 13511 am Platze, der — von E. K. Stahl nach Szenerie und Staffage zu einem der spätesten Abkömmlinge des
Buxheimer Nothelfers gestempelt — durch die drei sternförmig angeordneten Blattbüschel am Baumstamm des Riesen
mit ihrem auf Naturnachahmung abzielenden Farbenspiel mehr noch als an den von Stahl erwähnten heiligen Sebastian
ddo. 1437 (Sehr. 1684) an den um fast ein Menschenalter jüngeren Pariser Ölberg Sehr. 184 (Bouchot 8, Lemoisne 28,
s. Weinbergers Abb. 9) gemahnt: handelt es sich doch nach alldem wenn nicht unbedingt um ein oberrheinisches
Original, so doch um einen der oberrheinischen Tradition aufs stärkste verpflichteten, dem Boerner'schen Sebastian zeit-
lich und örtlich benachbarten Holzschnitt, der am Unterrande sehr ähnliche Farngräser und im Hintergrunde der linken
Felskulisse die von dorther erinnerliche kupferstichmäßige Laubzeichnung zur Anschauung bringt. Übrigens verhilft jene
seltsame, in der impressionistischen Auflösung des Umrisses fast japanisch anmutende Umbildung des sogenannten
»Schraffenbaumes« auch der anderwärts gewonnenen Datierung des Sebastian-Schnittes zu einer neuerlichen Sicherung:
da sie in freier Abzweigung einem Darstellungs-Schema entstammt, das sich nach J. Beth2 erst im Rahmen der Block-
1 Vgl. (C. Dodgson) Guildhall-Holzschnitte. Berlin 1014, T. VI. = XXI. Veröffentlichung der »Graphischen Gesellschaft« und die gute Stil-
charakteristik bei E. K. Stahl, Die Legende vom heiligen Riesen Christophorus in der Graphik des XV. und XVI. Jahrhunderts, München 1020
Katalog-Nr. 27 (mit T. XVIII).
2 »Die Baumzeichnung in der deutschen Graphik des XV. und XVI. Jahrhunderts«, Straßburg 1910, S. 24ff. = Heitz' »Studien zur deutschen
Kunstgeschichte«, Heft 130; hiezu auch Stahl, a. a. 0. S. 14S/9 (Erläuterungen zu Nr. 14).
66 —