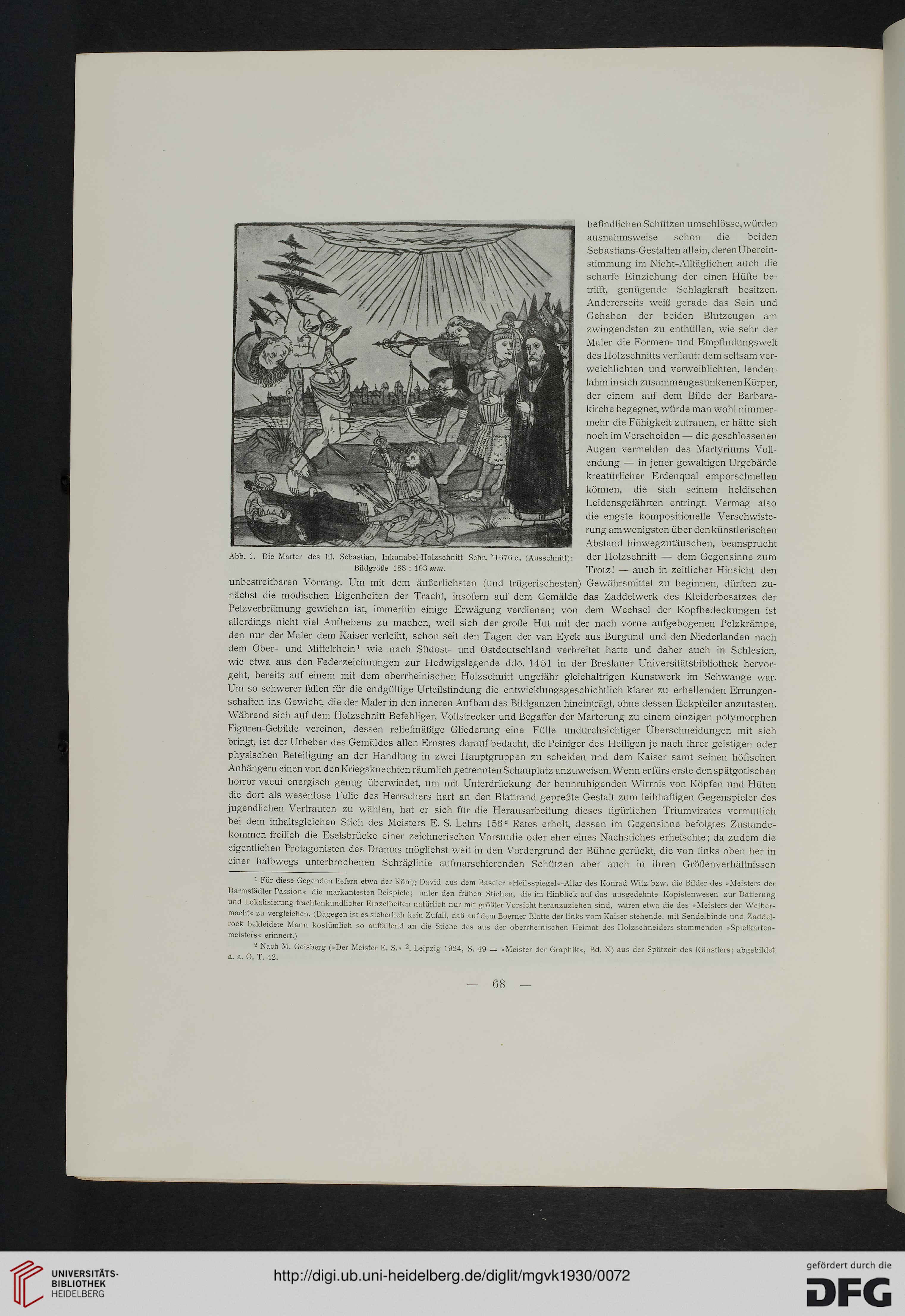befindlichen Schützen umschlösse, würden
ausnahmsweise schon die beiden
Sebastians-Gestalten allein, derenÜberein-
stimmung im Nicht-Alltäglichen auch die
scharfe Einziehung der einen Hüfte be-
trifft, genügende Schlagkraft besitzen.
Andererseits weiß gerade das Sein und
Gehaben der beiden Blutzeugen am
zwingendsten zu enthüllen, wie sehr der
Maler die Formen- und Empfindungswelt
des Holzschnitts verflaut: dem seltsam ver-
weichlichten und verweiblichten, lenden-
lahm insich zusammengesunkenen Körper,
der einem auf dem Bilde der Barbara-
kirche begegnet, würde man wohl nimmer-
mehr die Fähigkeit zutrauen, er hätte sich
noch im Verscheiden — die geschlossenen
Augen vermelden des Martyriums Voll-
endung — in jener gewaltigen Urgebärde
kreatürlicher Erdenqual emporschnellen
können, die sich seinem heldischen
Leidensgefährten entringt. Vermag also
die engste kompositioneile Verschwiste-
rung am wenigsten über den künstlerischen
Abstand hinwegzutäuschen, beansprucht
Abb. 1. Die Marter des hl. Sebastian, Inkunabel-Holzschnitt Sehr. *1676o. (Ausschnitt): der Holzschnitt — dem Gegensinne zum
Bildgröße 188 : 193««. Trotz! — auch in zeitlicher Hinsicht den
unbestreitbaren Vorrang. Um mit dem äußerlichsten (und trügerischesten) Gewährsmittel zu beginnen, dürften zu-
nächst die modischen Eigenheiten der Tracht, insofern auf dem Gemälde das Zaddelwerk des Kleiderbesatzes der
Pelzverbrämung gewichen ist, immerhin einige Erwägung verdienen; von dem Wechsel der Kopfbedeckungen ist
allerdings nicht viel Aufhebens zu machen, weil sich der große Hut mit der nach vorne aufgebogenen Pelzkrämpe,
den nur der Maler dem Kaiser verleiht, schon seit den Tagen der van Eyck aus Burgund und den Niederlanden nach
dem Ober- und Mittelrhein1 wie nach Südost- und Ostdeutschland verbreitet hatte und daher auch in Schlesien,
wie etwa aus den Federzeichnungen zur Hedwigslegende ddo. 1451 in der Breslauer Universitätsbibliothek hervor-
geht, bereits auf einem mit dem oberrheinischen Holzschnitt ungefähr gleichaltrigen Kunstwerk im Schwange war.
Um so schwerer fallen für die endgültige Urteilsfindung die entwicklungsgeschichtlich klarer zu erhellenden Errungen-
schaften ins Gewicht, die der Maler in den inneren Aufbau des Bildganzen hineinträgt, ohne dessen Eckpfeiler anzutasten.
Während sich auf dem Holzschnitt Befehliger, Vollstrecker und Begaffer der Marterung zu einem einzigen polymorphen
Figuren-Gebilde vereinen, dessen reliefmäßige Gliederung eine Fülle undurchsichtiger Überschneidungen mit sich
bringt, ist der Urheber des Gemäldes allen Ernstes darauf bedacht, die Peiniger des Heiligen je nach ihrer geistigen oder
physischen Beteiligung an der Handlung in zwei Hauptgruppen zu scheiden und dem Kaiser samt seinen höfischen
Anhängern einen von den Kriegsknechten räumlich getrennten Schauplatz anzuweisen. Wenn erfürs erste den spätgotischen
horror vacui energisch genug überwindet, um mit Unterdrückung der beunruhigenden Wirrnis von Köpfen und Hüten
die dort als wesenlose Folie des Herrschers hart an den Blattrand gepreßte Gestalt zum leibhaftigen Gegenspieler des
jugendlichen Vertrauten zu wählen, hat er sich für die Herausarbeitung dieses figürlichen Triumvirates vermutlich
bei dem inhaltsgleichen Stich des Meisters E. S. Lehrs 1562 Rates erholt, dessen im Gegensinne befolgtes Zustande-
kommen freilich die Eselsbrücke einer zeichnerischen Vorstudie oder eher eines Nachstiches erheischte; da zudem die
eigentlichen Protagonisten des Dramas möglichst weit in den Vordergrund der Bühne gerückt, die von links oben her in
einer halbwegs unterbrochenen Schräglinie aufmarschierenden Schützen aber auch in ihren Größenverhältnissen
1 Für diese Gegenden liefern etwa der König David aus dem Baseler »Heilsspiegel«-Altar des Konrad Witz bzw. die Bilder des »Meisters der
Darmstädter Passion« die markantesten Beispiele; unter den frühen Stichen, die im Hinblick auf das ausgedehnte Kopistenwesen zur Datierung
und Lokalisierung trachtenkundlicher Einzelheiten natürlich nur mit größter Vorsicht heranzuziehen sind, waren etwa die des «Meisters der Weiber-
macht« zu vergleichen. (Dagegen ist es sicherlich kein Zufall, daß auf dem Boerner-Blatte der links vom Kaiser stehende, mit Sendelbinde und Zaddel-
rock bekleidete Mann kostümlich so auffallend an die Stiche des aus der oberrheinischen Heimat des Holzschneiders stammenden »Spielkarten-
meisters« erinnert.)
2 Nach M. Geisberg (»Der Meister E. S.« 2, Leipzig 1024, S. 49 = »Meister der Graphik«, Bd. X) aus der Spätzeit des Künstlers; abgebildet
a. a. 0. T. 42.
— 68 —
ausnahmsweise schon die beiden
Sebastians-Gestalten allein, derenÜberein-
stimmung im Nicht-Alltäglichen auch die
scharfe Einziehung der einen Hüfte be-
trifft, genügende Schlagkraft besitzen.
Andererseits weiß gerade das Sein und
Gehaben der beiden Blutzeugen am
zwingendsten zu enthüllen, wie sehr der
Maler die Formen- und Empfindungswelt
des Holzschnitts verflaut: dem seltsam ver-
weichlichten und verweiblichten, lenden-
lahm insich zusammengesunkenen Körper,
der einem auf dem Bilde der Barbara-
kirche begegnet, würde man wohl nimmer-
mehr die Fähigkeit zutrauen, er hätte sich
noch im Verscheiden — die geschlossenen
Augen vermelden des Martyriums Voll-
endung — in jener gewaltigen Urgebärde
kreatürlicher Erdenqual emporschnellen
können, die sich seinem heldischen
Leidensgefährten entringt. Vermag also
die engste kompositioneile Verschwiste-
rung am wenigsten über den künstlerischen
Abstand hinwegzutäuschen, beansprucht
Abb. 1. Die Marter des hl. Sebastian, Inkunabel-Holzschnitt Sehr. *1676o. (Ausschnitt): der Holzschnitt — dem Gegensinne zum
Bildgröße 188 : 193««. Trotz! — auch in zeitlicher Hinsicht den
unbestreitbaren Vorrang. Um mit dem äußerlichsten (und trügerischesten) Gewährsmittel zu beginnen, dürften zu-
nächst die modischen Eigenheiten der Tracht, insofern auf dem Gemälde das Zaddelwerk des Kleiderbesatzes der
Pelzverbrämung gewichen ist, immerhin einige Erwägung verdienen; von dem Wechsel der Kopfbedeckungen ist
allerdings nicht viel Aufhebens zu machen, weil sich der große Hut mit der nach vorne aufgebogenen Pelzkrämpe,
den nur der Maler dem Kaiser verleiht, schon seit den Tagen der van Eyck aus Burgund und den Niederlanden nach
dem Ober- und Mittelrhein1 wie nach Südost- und Ostdeutschland verbreitet hatte und daher auch in Schlesien,
wie etwa aus den Federzeichnungen zur Hedwigslegende ddo. 1451 in der Breslauer Universitätsbibliothek hervor-
geht, bereits auf einem mit dem oberrheinischen Holzschnitt ungefähr gleichaltrigen Kunstwerk im Schwange war.
Um so schwerer fallen für die endgültige Urteilsfindung die entwicklungsgeschichtlich klarer zu erhellenden Errungen-
schaften ins Gewicht, die der Maler in den inneren Aufbau des Bildganzen hineinträgt, ohne dessen Eckpfeiler anzutasten.
Während sich auf dem Holzschnitt Befehliger, Vollstrecker und Begaffer der Marterung zu einem einzigen polymorphen
Figuren-Gebilde vereinen, dessen reliefmäßige Gliederung eine Fülle undurchsichtiger Überschneidungen mit sich
bringt, ist der Urheber des Gemäldes allen Ernstes darauf bedacht, die Peiniger des Heiligen je nach ihrer geistigen oder
physischen Beteiligung an der Handlung in zwei Hauptgruppen zu scheiden und dem Kaiser samt seinen höfischen
Anhängern einen von den Kriegsknechten räumlich getrennten Schauplatz anzuweisen. Wenn erfürs erste den spätgotischen
horror vacui energisch genug überwindet, um mit Unterdrückung der beunruhigenden Wirrnis von Köpfen und Hüten
die dort als wesenlose Folie des Herrschers hart an den Blattrand gepreßte Gestalt zum leibhaftigen Gegenspieler des
jugendlichen Vertrauten zu wählen, hat er sich für die Herausarbeitung dieses figürlichen Triumvirates vermutlich
bei dem inhaltsgleichen Stich des Meisters E. S. Lehrs 1562 Rates erholt, dessen im Gegensinne befolgtes Zustande-
kommen freilich die Eselsbrücke einer zeichnerischen Vorstudie oder eher eines Nachstiches erheischte; da zudem die
eigentlichen Protagonisten des Dramas möglichst weit in den Vordergrund der Bühne gerückt, die von links oben her in
einer halbwegs unterbrochenen Schräglinie aufmarschierenden Schützen aber auch in ihren Größenverhältnissen
1 Für diese Gegenden liefern etwa der König David aus dem Baseler »Heilsspiegel«-Altar des Konrad Witz bzw. die Bilder des »Meisters der
Darmstädter Passion« die markantesten Beispiele; unter den frühen Stichen, die im Hinblick auf das ausgedehnte Kopistenwesen zur Datierung
und Lokalisierung trachtenkundlicher Einzelheiten natürlich nur mit größter Vorsicht heranzuziehen sind, waren etwa die des «Meisters der Weiber-
macht« zu vergleichen. (Dagegen ist es sicherlich kein Zufall, daß auf dem Boerner-Blatte der links vom Kaiser stehende, mit Sendelbinde und Zaddel-
rock bekleidete Mann kostümlich so auffallend an die Stiche des aus der oberrheinischen Heimat des Holzschneiders stammenden »Spielkarten-
meisters« erinnert.)
2 Nach M. Geisberg (»Der Meister E. S.« 2, Leipzig 1024, S. 49 = »Meister der Graphik«, Bd. X) aus der Spätzeit des Künstlers; abgebildet
a. a. 0. T. 42.
— 68 —