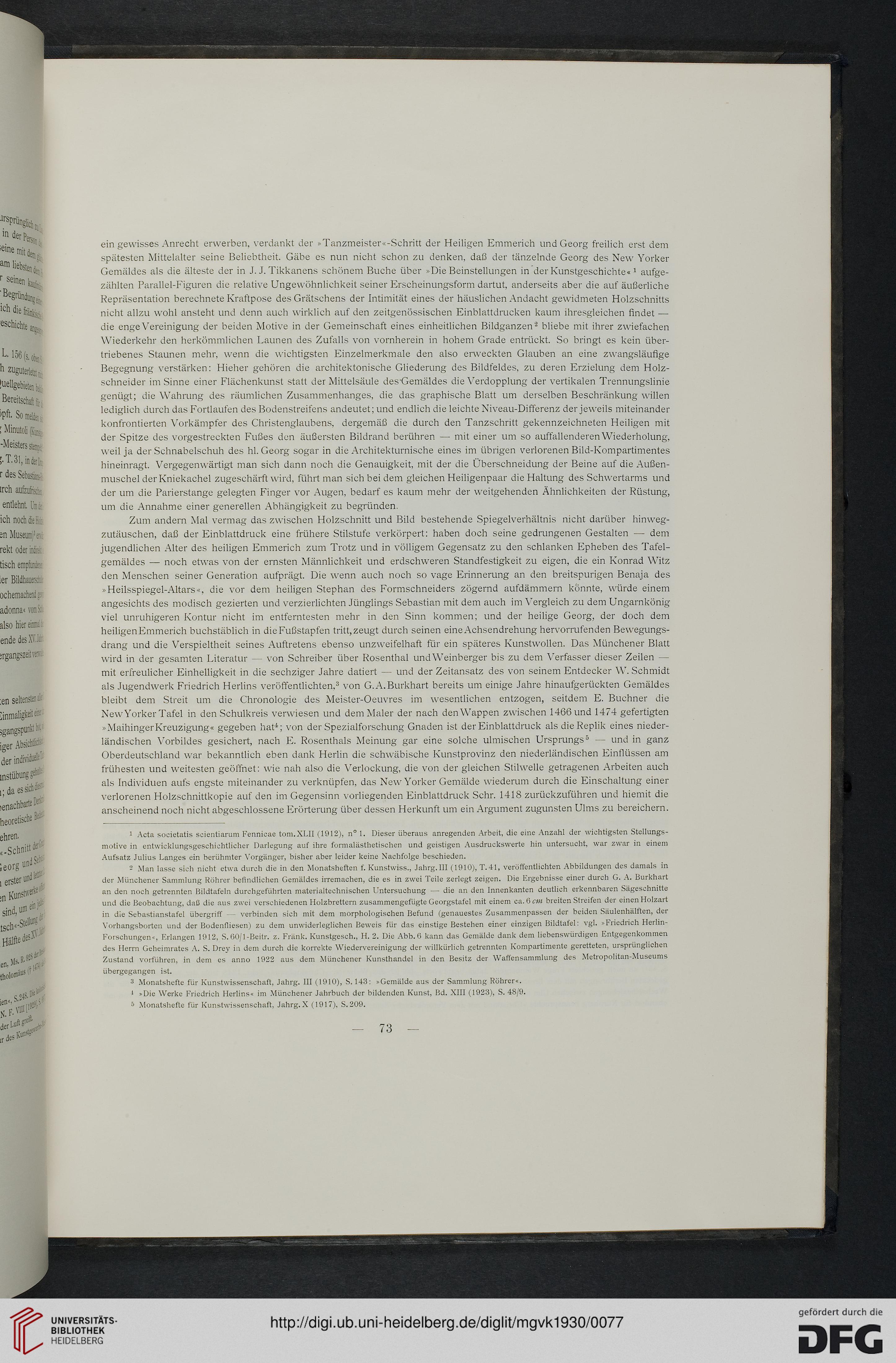ein gewisses Anrecht erwerben, verdankt der »Tanzmeister«-Schritt der Heiligen Emmerich und Georg freilich erst dem
spätesten Mittelalter seine Beliebtheit. Gäbe es nun nicht schon zu denken, daß der tänzelnde Georg des New Yorker
Gemäldes als die älteste der in J. J. Tikkanens schönem Buche über »Die Beinstellungen in der Kunstgeschichte« 1 aufge-
zählten Parallel-Figuren die relative Ungewöhnlichkeit seiner Erscheinungsform dartut, anderseits aber die auf äußerliche
Repräsentation berechnete Kraftpose des Grätschens der Intimität eines der häuslichen Andacht gewidmeten Holzschnitts
nicht allzu wohl ansteht und denn auch wirklich auf den zeitgenössischen Einblattdrucken kaum ihresgleichen findet_
die enge Vereinigung der beiden Motive in der Gemeinschaft eines einheitlichen Bildganzen2 bliebe mit ihrer zwiefachen
Wiederkehr den herkömmlichen Launen des Zufalls von vornherein in hohem Grade entrückt. So bringt es kein über-
triebenes Staunen mehr, wenn die wichtigsten Einzelmerkmale den also erweckten Glauben an eine zwangsläufige
Begegnung verstärken: Hieher gehören die architektonische Gliederung des Bildfeldes, zu deren Erzielung dem Holz-
schneider im Sinne einer Flächenkunst statt der Mittelsäule desGemäldes die Verdopplung der vertikalen Trennungslinie
genügt; die Wahrung des räumlichen Zusammenhanges, die das graphische Blatt um derselben Beschränkung willen
lediglich durch das Fortlaufen des Bodenstreifens andeutet; und endlich die leichte Niveau-Differenz der jeweils miteinander
konfrontierten Vorkämpfer des Christenglaubens, dergemäß die durch den Tanzschritt gekennzeichneten Heiligen mit
der Spitze des vorgestreckten Fußes den äußersten Bildrand berühren — mit einer um so auffallenderen Wiederholung,
weil ja der Schnabelschuh des hl. Georg sogar in die Architekturnische eines im übrigen verlorenen Bild-Kompartimentes
hineinragt. Vergegenwärtigt man sich dann noch die Genauigkeit, mit der die Überschneidung der Beine auf die Außen-
muschel der Kniekachel zugeschärft wird, führt man sich bei dem gleichen Heiligenpaar die Haltung des Schwertarms und
der um die Parierstange gelegten Finger vor Augen, bedarf es kaum mehr der weitgehenden Ähnlichkeiten der Rüstung,
um die Annahme einer generellen Abhängigkeit zu begründen.
Zum andern Mal vermag das zwischen Holzschnitt und Bild bestehende Spiegelverhältnis nicht darüber hinweg-
zutäuschen, daß der Einblattdruck eine frühere Stilstufe verkörpert: haben doch seine gedrungenen Gestalten — dem
jugendlichen Alter des heiligen Emmerich zum Trotz und in völligem Gegensatz zu den schlanken Epheben des Tafel-
gemäldes — noch etwas von der ernsten Männlichkeit und erdschweren Standfestigkeit zu eigen, die ein Konrad Witz
den Menschen seiner Generation aufprägt. Die wenn auch noch so vage Erinnerung an den breitspurigen Benaja des
»Heilsspiegel-Altars«, die vor dem heiligen Stephan des Formschneiders zögernd aufdämmern könnte, würde einem
angesichts des modisch gezierten und verzierlichten Jünglings Sebastian mit dem auch im Vergleich zu dem Ungarnkönig
viel unruhigeren Kontur nicht im entferntesten mehr in den Sinn kommen; und der heilige Georg, der doch dem
heiligenEmmerich buchstäblich in dieFußstapfen tritt, zeugt durch seinen eine Achsendrehung hervorrufenden Bewegungs-
drang und die Verspieltheit seines Auftretens ebenso unzweifelhaft für ein späteres Kunstwollen. Das Münchener Blatt
wird in der gesamten Literatur — von Schreiber über Rosenthal und Weinberger bis zu dem Verfasser dieser Zeilen —
mit erfreulicher Einhelligkeit in die sechziger Jahre datiert — und der Zeitansatz des von seinem Entdecker W. Schmidt
als Jugendwerk Friedrich Herlins veröffentlichten,3 von G.A.Burkhart bereits um einige Jahre hinaufgerückten Gemäldes
bleibt dem Streit um die Chronologie des Meister-Oeuvres im wesentlichen entzogen, seitdem E. Buchner die
New Yorker Tafel in den Schulkreis verwiesen und dem Maler der nach den Wappen zwischen 1466 und 1474 gefertigten
»MaihingerKreuzigung« gegeben hat4; von der Spezialforschung Gnaden ist der Einblattdruck als die Replik eines nieder-
ländischen Vorbildes gesichert, nach E. Rosenthals Meinung gar eine solche ulmischen Ursprungs5 — und in ganz
Oberdeutschland war bekanntlich eben dank Herlin die schwäbische Kunstprovinz den niederländischen Einflüssen am
frühesten und weitesten geöffnet: wie nah also die Verlockung, die von der gleichen Stilwelle getragenen Arbeiten auch
als Individuen aufs engste miteinander zu verknüpfen, das New Yorker Gemälde wiederum durch die Einschaltung einer
verlorenen Holzschnittkopie auf den im Gegensinn vorliegenden Einblattdruck Sehr. 1418 zurückzuführen und hiemit die
anscheinend noch nicht abgeschlossene Erörterung über dessen Herkunft um ein Argument zugunsten Ulms zu bereichern.
1 Acta societatis scientiarum Fennicae tom.XLII (1912), n° 1. Dieser überaus anregenden Arbeit, die eine Anzahl der wichtigsten Stellungs-
motive in entwicklungsgeschichtlicher Darlegung auf ihre formalästhetischen und geistigen Ausdruckswerte hin untersucht, war zwar in einem
Aufsatz Julius Langes ein berühmter Vorgänger, bisher aber leider keine Nachfolge beschieden.
- Man lasse sich nicht etwa durch die in den Monatsheften f. Kunstwiss., Jahrg.III (1910), T.41, veröffentlichten Abbildungen des damals in
der Münchener Sammlung Röhrer befindlichen Gemäldes irremachen, die es in zwei Teile zerlegt zeigen. Die Ergebnisse einer durch G. A. Burkhart
an den noch getrennten Bildtafeln durchgeführten materialtechnischen Untersuchung — die an den Innenkanten deutlich erkennbaren Sägeschnitte
und die Beobachtung, daß die aus zwei verschiedenen Holzbrettern zusammengefügte Georgstafel mit einem ca. Gern breiten Streifen der einen Holzart
in die Sebastianstafel übergriff verbinden sich mit dem morphologischen Befund (genauestes Zusammenpassen der beiden Säulenhälften, der
Vorhangsborten und der Bodenfliesen) zu dem unwiderleglichen Beweis für das einstige Bestehen einer einzigen Bildtafel: vgl. »Friedrich Herlin-
Forschungen., Erlangen 1912, S. 60/1-Beitr. z. Frank. Kunstgesch., H. 2. Die Abb.6 kann das Gemälde dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen
des Herrn Geheimrates A. S. Drey in dem durch die korrekte Wiedervereinigung der willkürlich getrennten Kompartimente geretteten, ursprünglichen
Zustand vorführen, in dem es anno 1922 aus dem Münchener Kunsthandel in den Besitz der Waffensammlung des Metropolitan-Museums
übergegangen ist.
3 Monatshefte für Kunstwissenschaft, Jahrg. III (1910), S. 143: »Gemälde aus der Sammlung Rührer«,
i »Die Werke Friedrich Herlins« im Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst, Bd. XIII (1923), S. 48/9.
5 Monatshefte für Kunstwissenschaft, Jahrg.X (1917), S.209.
spätesten Mittelalter seine Beliebtheit. Gäbe es nun nicht schon zu denken, daß der tänzelnde Georg des New Yorker
Gemäldes als die älteste der in J. J. Tikkanens schönem Buche über »Die Beinstellungen in der Kunstgeschichte« 1 aufge-
zählten Parallel-Figuren die relative Ungewöhnlichkeit seiner Erscheinungsform dartut, anderseits aber die auf äußerliche
Repräsentation berechnete Kraftpose des Grätschens der Intimität eines der häuslichen Andacht gewidmeten Holzschnitts
nicht allzu wohl ansteht und denn auch wirklich auf den zeitgenössischen Einblattdrucken kaum ihresgleichen findet_
die enge Vereinigung der beiden Motive in der Gemeinschaft eines einheitlichen Bildganzen2 bliebe mit ihrer zwiefachen
Wiederkehr den herkömmlichen Launen des Zufalls von vornherein in hohem Grade entrückt. So bringt es kein über-
triebenes Staunen mehr, wenn die wichtigsten Einzelmerkmale den also erweckten Glauben an eine zwangsläufige
Begegnung verstärken: Hieher gehören die architektonische Gliederung des Bildfeldes, zu deren Erzielung dem Holz-
schneider im Sinne einer Flächenkunst statt der Mittelsäule desGemäldes die Verdopplung der vertikalen Trennungslinie
genügt; die Wahrung des räumlichen Zusammenhanges, die das graphische Blatt um derselben Beschränkung willen
lediglich durch das Fortlaufen des Bodenstreifens andeutet; und endlich die leichte Niveau-Differenz der jeweils miteinander
konfrontierten Vorkämpfer des Christenglaubens, dergemäß die durch den Tanzschritt gekennzeichneten Heiligen mit
der Spitze des vorgestreckten Fußes den äußersten Bildrand berühren — mit einer um so auffallenderen Wiederholung,
weil ja der Schnabelschuh des hl. Georg sogar in die Architekturnische eines im übrigen verlorenen Bild-Kompartimentes
hineinragt. Vergegenwärtigt man sich dann noch die Genauigkeit, mit der die Überschneidung der Beine auf die Außen-
muschel der Kniekachel zugeschärft wird, führt man sich bei dem gleichen Heiligenpaar die Haltung des Schwertarms und
der um die Parierstange gelegten Finger vor Augen, bedarf es kaum mehr der weitgehenden Ähnlichkeiten der Rüstung,
um die Annahme einer generellen Abhängigkeit zu begründen.
Zum andern Mal vermag das zwischen Holzschnitt und Bild bestehende Spiegelverhältnis nicht darüber hinweg-
zutäuschen, daß der Einblattdruck eine frühere Stilstufe verkörpert: haben doch seine gedrungenen Gestalten — dem
jugendlichen Alter des heiligen Emmerich zum Trotz und in völligem Gegensatz zu den schlanken Epheben des Tafel-
gemäldes — noch etwas von der ernsten Männlichkeit und erdschweren Standfestigkeit zu eigen, die ein Konrad Witz
den Menschen seiner Generation aufprägt. Die wenn auch noch so vage Erinnerung an den breitspurigen Benaja des
»Heilsspiegel-Altars«, die vor dem heiligen Stephan des Formschneiders zögernd aufdämmern könnte, würde einem
angesichts des modisch gezierten und verzierlichten Jünglings Sebastian mit dem auch im Vergleich zu dem Ungarnkönig
viel unruhigeren Kontur nicht im entferntesten mehr in den Sinn kommen; und der heilige Georg, der doch dem
heiligenEmmerich buchstäblich in dieFußstapfen tritt, zeugt durch seinen eine Achsendrehung hervorrufenden Bewegungs-
drang und die Verspieltheit seines Auftretens ebenso unzweifelhaft für ein späteres Kunstwollen. Das Münchener Blatt
wird in der gesamten Literatur — von Schreiber über Rosenthal und Weinberger bis zu dem Verfasser dieser Zeilen —
mit erfreulicher Einhelligkeit in die sechziger Jahre datiert — und der Zeitansatz des von seinem Entdecker W. Schmidt
als Jugendwerk Friedrich Herlins veröffentlichten,3 von G.A.Burkhart bereits um einige Jahre hinaufgerückten Gemäldes
bleibt dem Streit um die Chronologie des Meister-Oeuvres im wesentlichen entzogen, seitdem E. Buchner die
New Yorker Tafel in den Schulkreis verwiesen und dem Maler der nach den Wappen zwischen 1466 und 1474 gefertigten
»MaihingerKreuzigung« gegeben hat4; von der Spezialforschung Gnaden ist der Einblattdruck als die Replik eines nieder-
ländischen Vorbildes gesichert, nach E. Rosenthals Meinung gar eine solche ulmischen Ursprungs5 — und in ganz
Oberdeutschland war bekanntlich eben dank Herlin die schwäbische Kunstprovinz den niederländischen Einflüssen am
frühesten und weitesten geöffnet: wie nah also die Verlockung, die von der gleichen Stilwelle getragenen Arbeiten auch
als Individuen aufs engste miteinander zu verknüpfen, das New Yorker Gemälde wiederum durch die Einschaltung einer
verlorenen Holzschnittkopie auf den im Gegensinn vorliegenden Einblattdruck Sehr. 1418 zurückzuführen und hiemit die
anscheinend noch nicht abgeschlossene Erörterung über dessen Herkunft um ein Argument zugunsten Ulms zu bereichern.
1 Acta societatis scientiarum Fennicae tom.XLII (1912), n° 1. Dieser überaus anregenden Arbeit, die eine Anzahl der wichtigsten Stellungs-
motive in entwicklungsgeschichtlicher Darlegung auf ihre formalästhetischen und geistigen Ausdruckswerte hin untersucht, war zwar in einem
Aufsatz Julius Langes ein berühmter Vorgänger, bisher aber leider keine Nachfolge beschieden.
- Man lasse sich nicht etwa durch die in den Monatsheften f. Kunstwiss., Jahrg.III (1910), T.41, veröffentlichten Abbildungen des damals in
der Münchener Sammlung Röhrer befindlichen Gemäldes irremachen, die es in zwei Teile zerlegt zeigen. Die Ergebnisse einer durch G. A. Burkhart
an den noch getrennten Bildtafeln durchgeführten materialtechnischen Untersuchung — die an den Innenkanten deutlich erkennbaren Sägeschnitte
und die Beobachtung, daß die aus zwei verschiedenen Holzbrettern zusammengefügte Georgstafel mit einem ca. Gern breiten Streifen der einen Holzart
in die Sebastianstafel übergriff verbinden sich mit dem morphologischen Befund (genauestes Zusammenpassen der beiden Säulenhälften, der
Vorhangsborten und der Bodenfliesen) zu dem unwiderleglichen Beweis für das einstige Bestehen einer einzigen Bildtafel: vgl. »Friedrich Herlin-
Forschungen., Erlangen 1912, S. 60/1-Beitr. z. Frank. Kunstgesch., H. 2. Die Abb.6 kann das Gemälde dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen
des Herrn Geheimrates A. S. Drey in dem durch die korrekte Wiedervereinigung der willkürlich getrennten Kompartimente geretteten, ursprünglichen
Zustand vorführen, in dem es anno 1922 aus dem Münchener Kunsthandel in den Besitz der Waffensammlung des Metropolitan-Museums
übergegangen ist.
3 Monatshefte für Kunstwissenschaft, Jahrg. III (1910), S. 143: »Gemälde aus der Sammlung Rührer«,
i »Die Werke Friedrich Herlins« im Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst, Bd. XIII (1923), S. 48/9.
5 Monatshefte für Kunstwissenschaft, Jahrg.X (1917), S.209.