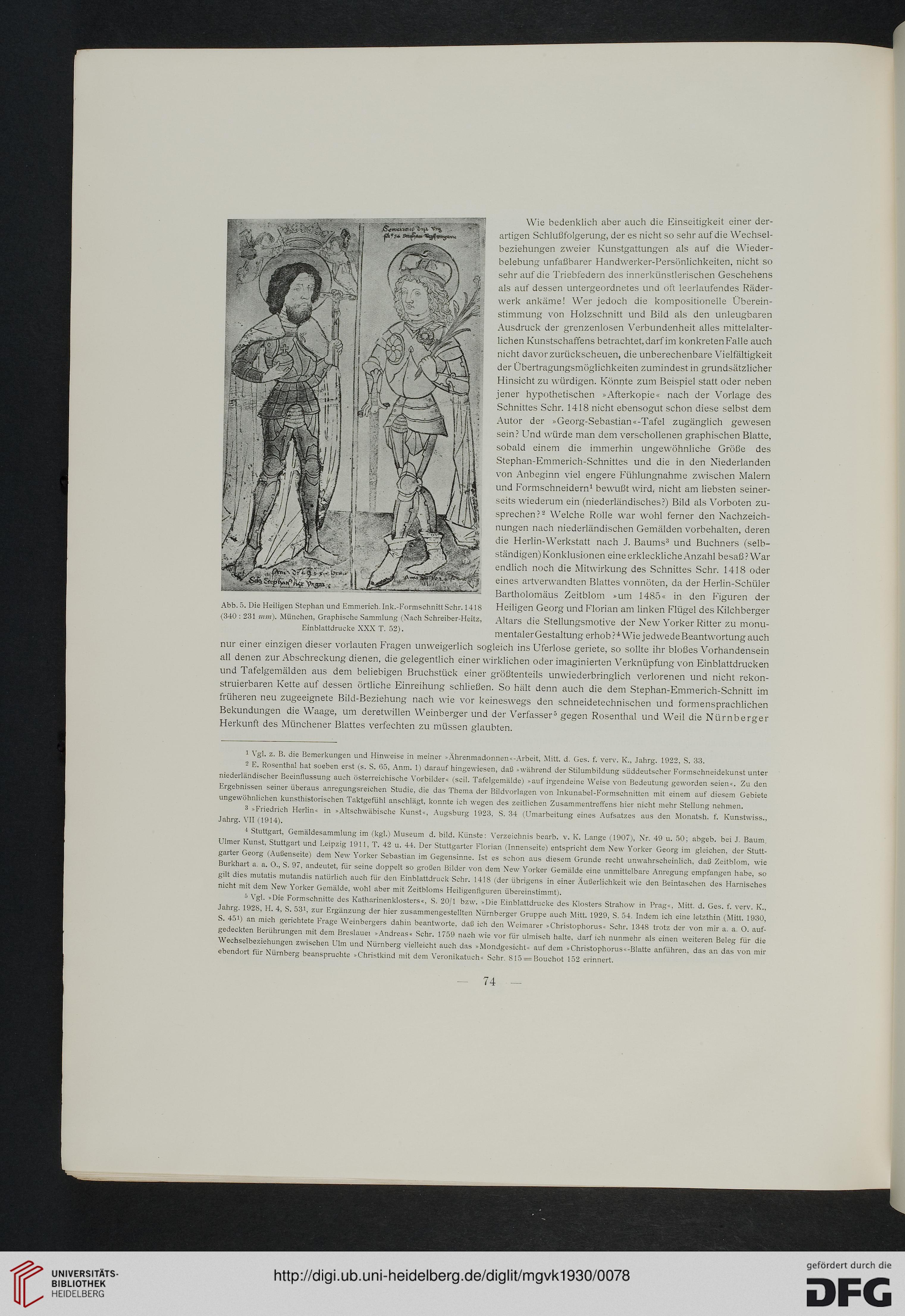Abb. 5. Die Heiligen Stephan und Emmerich. Ink.-Formschnitt Sehr. 141S
(340 : 231 mm). München, Graphische Sammlung (Nach Schreiber-Heitz.
Einblattdrucke XXX T. 52).
Wie bedenklich aber auch die Einseitigkeit einer der-
artigen Schlußfolgerung, der es nicht so sehr auf die Wechsel-
beziehungen zweier Kunstgattungen als auf die Wieder-
belebung unfaßbarer Handwerker-Persönlichkeiten, nicht so
sehr auf die Triebfedern des innerkünstlerischen Geschehens
als auf dessen untergeordnetes und oft leerlaufendes Räder-
werk ankäme! Wer jedoch die kompositionelle Überein-
stimmung von Holzschnitt und Bild als den unleugbaren
Ausdruck der grenzenlosen Verbundenheit alles mittelalter-
lichen Kunstschaffens betrachtet, darf im konkreten Falle auch
nicht davor zurückscheuen, die unberechenbare Vielfältigkeit
der Übertragungsmöglichkeiten zumindest in grundsätzlicher
Hinsicht zu würdigen. Könnte zum Beispiel statt oder neben
jener hypothetischen »Afterkopie« nach der Vorlage des
Schnittes Sehr. 1418 nicht ebensogut schon diese selbst dem
Autor der »Georg-Sebastian«-Tafel zugänglich gewesen
sein? Und würde man dem verschollenen graphischen Blatte,
sobald einem die immerhin ungewöhnliche Größe des
Stephan-Emmerich-Schnittes und die in den Niederlanden
von Anbeginn viel engere Fühlungnahme zwischen Malern
und Formschneidern1 bewußt wird, nicht am liebsten seiner-
seits wiederum ein (niederländisches?) Bild als Vorboten zu-
sprechen?- Welche Rolle war wohl ferner den Nachzeich-
nungen nach niederländischen Gemälden vorbehalten, deren
die Herlin-Werkstatt nach J. Baums3 und Buchners (selb-
ständigen) Konklusionen eine erkleckliche Anzahl besaß? War
endlich noch die Mitwirkung des Schnittes Sehr. 1418 oder
eines artverwandten Blattes vonnöten, da der Herlin-Schüler
Bartholomäus Zeitblom »um 1485« in den Figuren der
Heiligen Georg und Florian am linken Flügel des Kilchberger
Altars die Stellungsmotive der New Yorker Ritter zu monu-
mentaler Gestaltung erhob?4 Wie jedwede Beantwortung auch
nur einer einzigen dieser vorlauten Fragen unweigerlich sogleich ins Uferlose geriete, so sollte ihr bloßes Vorhandensein
all denen zur Abschreckung dienen, die gelegentlich einer wirklichen oder imaginierten Verknüpfung von Einblattdrucken
und Tafelgemälden aus dem beliebigen Bruchstück einer größtenteils unwiederbringlich verlorenen und nicht rekon-
struierbaren Kette auf dessen örtliche Einreihung schließen. So hält denn auch die dem Stephan-Emmerich-Schnitt im
früheren neu zugeeignete Bild-Beziehung nach wie vor keineswegs den schneidetechnischen und formensprachlichen
Bekundungen die Waage, um deretwillen Weinberger und der Verfasser3 gegen Rosenthal und Weil die Nürnberger
Herkunft des Münchener Blattes verfechten zu müssen glaubten.
1 Vgl. z. B. die Bemerkungen und Hinweise in meiner >Ährenmadonnen.-Arbeit, Mitt d. Ges. f. vew. K., Jahrg. 1922, S. 33.
- E. Rosenthal hat soeben erst (s. S. 65, Anm. 1) darauf hingewiesen, daß »während der Stilumbildung süddeutscher Formschneidekunst unter
niederländischer Beeinflussung auch österreichische Vorbilder, (seil. Tafelgemälde) -auf irgendeine Weise von Bedeutung geworden seien«. Zu den
Ergebnissen seiner überaus anregungsreichen Studie, die das Thema der Bildvorlagen von Inkunabel-Formschnitten mit einem auf diesem Gebiete
ungewöhnlichen kunsthistorischen Taktgefühl anschlägt, konnte ich wegen des zeitlichen Zusammentreffens hier nicht mehr Stellung nehmen.
3 .Friedrich Herlin. in »Altschwäbische Kunst., Augsburg 1923, S. 34 (Umarbeitung eines Aufsatzes aus den Monatsh. f. Kunstwiss..
Jahrg. VII (1914).
1 Stuttgart, Gemäldesammlung im (kgl.) Museum d. bild. Künste: Verzeichnis bearb. v. K. Lange (1907), Nr. 49 u. 50; abgeb. bei J. Baum,
Ulmer Kunst, Stuttgart und Leipzig 1911, T. 42 u. 44. Der Stuttgarter Florian (Innenseite) entspricht dem New Yorker Georg im gleichen, der Stutt-
garter Georg (Außenseite) dem New Yorker Sebastian im Gegensinne. Ist es schon aus diesem Grunde recht unwahrscheinlich, daß Zeitblom, wie
Burkhart a. a. O., S. 97, andeutet, für seine doppelt so großen Bilder von dem New Yorker Gemälde eine unmittelbare Anregung empfangen habe, so
gilt dies mutatis mutandis natürlich auch für den Einblattdruck Sehr. 1418 (der übrigens in einer Äußerlichkeit wie den Beintaschen des Harnisches
nicht mit dem New Yorker Gemälde, wohl aber mit Zeitbloms Heiligenfiguren übereinstimmt).
5 Vgl. »Die Formschnitte des Katharinenklosters«, S. 20/1 bzw. »Die Einblattdrucke des Klosters Strahow in Prag., Mitt. d. Ges. f. verv. K„
Jahrg. 1928, H. 4, S. 531, zur Ergänzung der hier zusammengestellten Nürnberger Gruppe auch Mitt. 1929, S. 54. Indem ich eine letzthin (Mitt. 1930,
S. 451) an mich gerichtete Frage Weinbergers dahin beantworte, daß ich den Weimarer »Christophorus. Sehr. 1348 trotz der von mir a. a. O. auf-
gedeckten Berührungen mit dem Breslauei »Andreas. Sehr. 1759 nach wie vor für ulmisch halte, darf ich nunmehr als einen weiteren Beleg für die
Wechselbeziehungen zwischen Ulm und Nürnberg vielleicht auch das »Mondgesicht, auf dem »Christophorus.-Blatte anführen, das an das von mir
ebendort für Nürnberg beanspruchte »Christkind mit dem Veronikatuch« Sehr. 815 = Bouchot 152 erinnert.
74 -
(340 : 231 mm). München, Graphische Sammlung (Nach Schreiber-Heitz.
Einblattdrucke XXX T. 52).
Wie bedenklich aber auch die Einseitigkeit einer der-
artigen Schlußfolgerung, der es nicht so sehr auf die Wechsel-
beziehungen zweier Kunstgattungen als auf die Wieder-
belebung unfaßbarer Handwerker-Persönlichkeiten, nicht so
sehr auf die Triebfedern des innerkünstlerischen Geschehens
als auf dessen untergeordnetes und oft leerlaufendes Räder-
werk ankäme! Wer jedoch die kompositionelle Überein-
stimmung von Holzschnitt und Bild als den unleugbaren
Ausdruck der grenzenlosen Verbundenheit alles mittelalter-
lichen Kunstschaffens betrachtet, darf im konkreten Falle auch
nicht davor zurückscheuen, die unberechenbare Vielfältigkeit
der Übertragungsmöglichkeiten zumindest in grundsätzlicher
Hinsicht zu würdigen. Könnte zum Beispiel statt oder neben
jener hypothetischen »Afterkopie« nach der Vorlage des
Schnittes Sehr. 1418 nicht ebensogut schon diese selbst dem
Autor der »Georg-Sebastian«-Tafel zugänglich gewesen
sein? Und würde man dem verschollenen graphischen Blatte,
sobald einem die immerhin ungewöhnliche Größe des
Stephan-Emmerich-Schnittes und die in den Niederlanden
von Anbeginn viel engere Fühlungnahme zwischen Malern
und Formschneidern1 bewußt wird, nicht am liebsten seiner-
seits wiederum ein (niederländisches?) Bild als Vorboten zu-
sprechen?- Welche Rolle war wohl ferner den Nachzeich-
nungen nach niederländischen Gemälden vorbehalten, deren
die Herlin-Werkstatt nach J. Baums3 und Buchners (selb-
ständigen) Konklusionen eine erkleckliche Anzahl besaß? War
endlich noch die Mitwirkung des Schnittes Sehr. 1418 oder
eines artverwandten Blattes vonnöten, da der Herlin-Schüler
Bartholomäus Zeitblom »um 1485« in den Figuren der
Heiligen Georg und Florian am linken Flügel des Kilchberger
Altars die Stellungsmotive der New Yorker Ritter zu monu-
mentaler Gestaltung erhob?4 Wie jedwede Beantwortung auch
nur einer einzigen dieser vorlauten Fragen unweigerlich sogleich ins Uferlose geriete, so sollte ihr bloßes Vorhandensein
all denen zur Abschreckung dienen, die gelegentlich einer wirklichen oder imaginierten Verknüpfung von Einblattdrucken
und Tafelgemälden aus dem beliebigen Bruchstück einer größtenteils unwiederbringlich verlorenen und nicht rekon-
struierbaren Kette auf dessen örtliche Einreihung schließen. So hält denn auch die dem Stephan-Emmerich-Schnitt im
früheren neu zugeeignete Bild-Beziehung nach wie vor keineswegs den schneidetechnischen und formensprachlichen
Bekundungen die Waage, um deretwillen Weinberger und der Verfasser3 gegen Rosenthal und Weil die Nürnberger
Herkunft des Münchener Blattes verfechten zu müssen glaubten.
1 Vgl. z. B. die Bemerkungen und Hinweise in meiner >Ährenmadonnen.-Arbeit, Mitt d. Ges. f. vew. K., Jahrg. 1922, S. 33.
- E. Rosenthal hat soeben erst (s. S. 65, Anm. 1) darauf hingewiesen, daß »während der Stilumbildung süddeutscher Formschneidekunst unter
niederländischer Beeinflussung auch österreichische Vorbilder, (seil. Tafelgemälde) -auf irgendeine Weise von Bedeutung geworden seien«. Zu den
Ergebnissen seiner überaus anregungsreichen Studie, die das Thema der Bildvorlagen von Inkunabel-Formschnitten mit einem auf diesem Gebiete
ungewöhnlichen kunsthistorischen Taktgefühl anschlägt, konnte ich wegen des zeitlichen Zusammentreffens hier nicht mehr Stellung nehmen.
3 .Friedrich Herlin. in »Altschwäbische Kunst., Augsburg 1923, S. 34 (Umarbeitung eines Aufsatzes aus den Monatsh. f. Kunstwiss..
Jahrg. VII (1914).
1 Stuttgart, Gemäldesammlung im (kgl.) Museum d. bild. Künste: Verzeichnis bearb. v. K. Lange (1907), Nr. 49 u. 50; abgeb. bei J. Baum,
Ulmer Kunst, Stuttgart und Leipzig 1911, T. 42 u. 44. Der Stuttgarter Florian (Innenseite) entspricht dem New Yorker Georg im gleichen, der Stutt-
garter Georg (Außenseite) dem New Yorker Sebastian im Gegensinne. Ist es schon aus diesem Grunde recht unwahrscheinlich, daß Zeitblom, wie
Burkhart a. a. O., S. 97, andeutet, für seine doppelt so großen Bilder von dem New Yorker Gemälde eine unmittelbare Anregung empfangen habe, so
gilt dies mutatis mutandis natürlich auch für den Einblattdruck Sehr. 1418 (der übrigens in einer Äußerlichkeit wie den Beintaschen des Harnisches
nicht mit dem New Yorker Gemälde, wohl aber mit Zeitbloms Heiligenfiguren übereinstimmt).
5 Vgl. »Die Formschnitte des Katharinenklosters«, S. 20/1 bzw. »Die Einblattdrucke des Klosters Strahow in Prag., Mitt. d. Ges. f. verv. K„
Jahrg. 1928, H. 4, S. 531, zur Ergänzung der hier zusammengestellten Nürnberger Gruppe auch Mitt. 1929, S. 54. Indem ich eine letzthin (Mitt. 1930,
S. 451) an mich gerichtete Frage Weinbergers dahin beantworte, daß ich den Weimarer »Christophorus. Sehr. 1348 trotz der von mir a. a. O. auf-
gedeckten Berührungen mit dem Breslauei »Andreas. Sehr. 1759 nach wie vor für ulmisch halte, darf ich nunmehr als einen weiteren Beleg für die
Wechselbeziehungen zwischen Ulm und Nürnberg vielleicht auch das »Mondgesicht, auf dem »Christophorus.-Blatte anführen, das an das von mir
ebendort für Nürnberg beanspruchte »Christkind mit dem Veronikatuch« Sehr. 815 = Bouchot 152 erinnert.
74 -