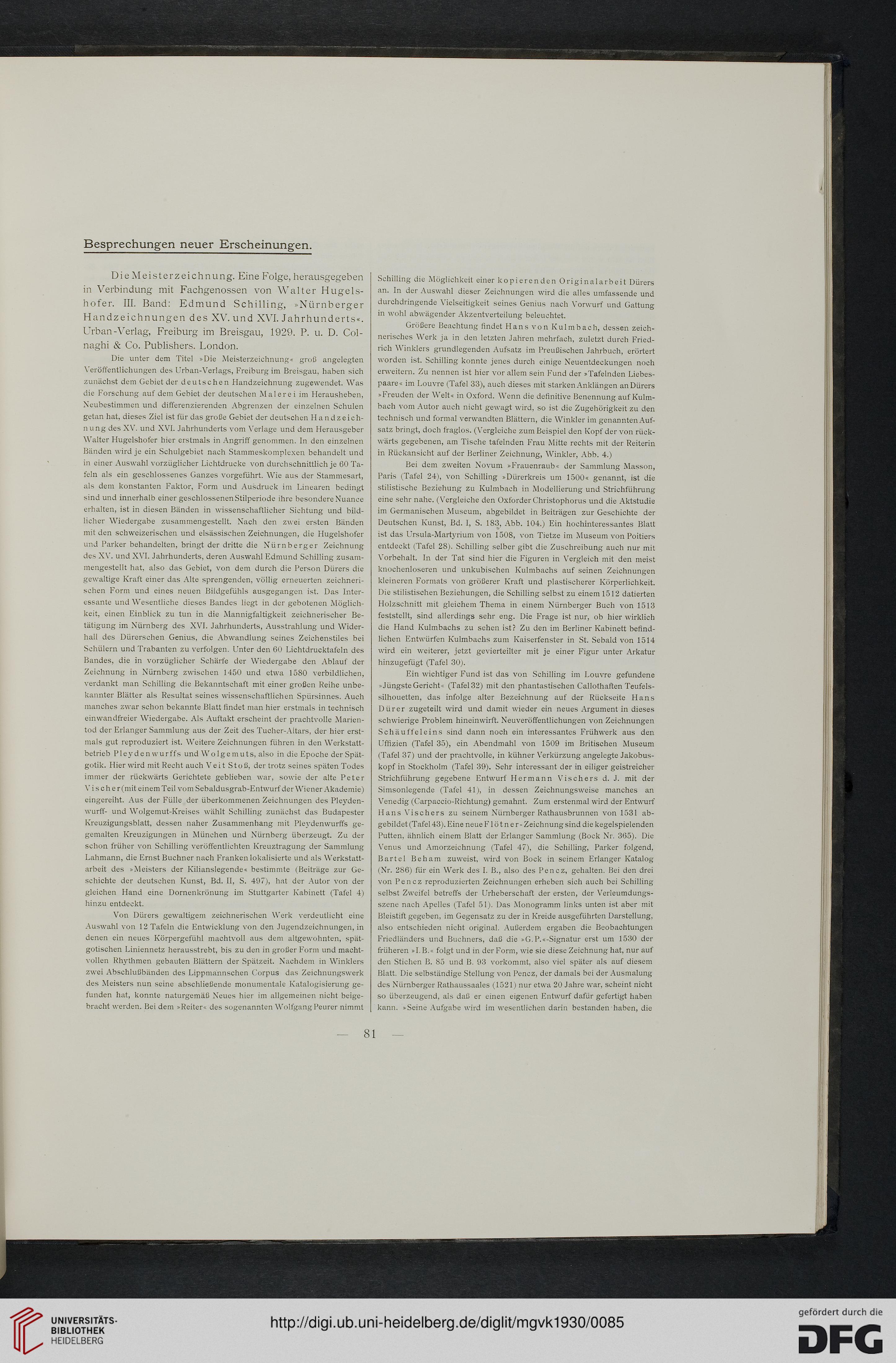Besprechungen neuer Erscheinungen.
Die Meisterzeichnung. Eine Folge, herausgegeben
in Verbindung mit Fachgenossen von Walter Hügels-
hofer. III. Band: Edmund Schilling, »Nürnberger
Handzeichnungen des XV. und XVI. Jahrhunderts«.
Urban-Verlag, Freiburg im Breisgau, 1929. P. u. D. Col-
naghi & Co. Publishers. London.
Die unter dem Titel »Die Meisterzeichnung« groß angelegten
Veröffentlichungen des Urban-Verlags, Freiburg im Breisgau. haben sich
zunächst dem Gebiet der deutschen Handzeichnung zugewendet. Was
die Forschung auf dem Gebiet der deutschen Malerei im Herausheben,
Neubestimmen und differenzierenden Abgrenzen der einzelnen Schulen
getan hat, dieses Ziel ist für das große Gebiet der deutschen Handzeich-
nung des XV. und XVI. Jahrhunderts vom Verlage und dem Herausgeber
Walter Hugelshofer hier erstmals in Angriff genommen. In den einzelnen
Bänden wird je ein Schulgebiet nach Stammeskomplexen behandelt und
in einer Auswahl vorzüglicher Lichtdrucke von durchschnittlich je 60 Ta-
feln als ein geschlossenes Ganzes vorgeführt. Wie aus der Stammesart,
als dem konstanten Faktor, Form und Ausdruck im Linearen bedingt
sind und innerhalb einer geschlossenen Stilperiode ihre besondere Nuance
erhalten, ist in diesen Banden in wissenschaftlicher Sichtung und bild-
licher Wiedergabe zusammengestellt. Nach den zwei ersten Bänden
mit den schweizerischen und elsässischen Zeichnungen, die Hugelshofer
und Parker behandelten, bringt der dritte die Nürnberger Zeichnung
des XV. und XVI. Jahrhunderts, deren Auswahl Edmund Schilling zusam-
mengestellt hat, also das Gebiet, von dem durch die Person Dürers die
gewaltige Kraft einer das Alte sprengenden, völlig erneuerten zeichneri-
schen Form und eines neuen Bildgefühls ausgegangen ist. Das Inter-
essante und Wesentliche dieses Bandes liegt in der gebotenen Möglich-
keit, einen Einblick zu tun in die Mannigfaltigkeit zeichnerischer Be-
tätigung im Nürnberg des XVI. Jahrhunderts, Ausstrahlung und Wider-
hall des Dürerschen Genius, die Abwandlung seines Zeichenstiles bei
Schülern und Trabanten zu verfolgen. Unter den 60 Lichtdrucktafeln des
Bandes, die in vorzüglicher Schärfe der Wiedergabe den Ablauf der
Zeichnung in Nürnberg zwischen 1450 und etwa 1580 verbildlichen,
verdankt man Schilling die Bekanntschaft mit einer großen Reihe unbe-
kannter Blätter als Resultat seines wissenschaftlichen Spürsinnes. Auch
manches zwar schon bekannte Blatt findet man hier erstmals in technisch
einwandfreier Wiedergabe. Als Auftakt erscheint der prachtvolle Marien-
tod der Erlanger Sammlung aus der Zeit des Tucher-Altars, der hier erst-
mals gut reproduziert ist. Weitere Zeichnungen führen in den Werkstatt-
betrieb Pley d e n wurffs und Wo Ige muts, also in die Epoche der Spät-
gotik. Hier wird mit Recht auch Veit Stoß, der trotz seines späten Todes
immer der rückwärts Gerichtete geblieben war, sowie der alte Peter
Vischer(mit einem Teil vom Sebaldusgrab-Entwurf der Wiener Akademie)
eingereiht. Aus der Fülle der überkommenen Zeichnungen des Pleyden-
wurff- und Wolgemut-Kreises wählt Schilling zunächst das Budapester
Kreuzigungsblatt, dessen naher Zusammenhang mit Pieydenwurffs ge-
gcmalten Kreuzigungen in München und Nürnberg überzeugt. Zu der
schon früher von Schilling veröffentlichten Kreuztragung der Sammlung
Lahmann, die Ernst Buchner nach Franken lokalisierte und als Werkstatt-
arbeit des »Meisters der Kilianslegende« bestimmte (Beiträge zur Ge-
schichte der deutschen Kunst, Bd. II, S. 497), hat der Autor von der
gleichen Hand eine Dornenkrönung im Stuttgarter Kabinett (Tafel 4)
hinzu entdeckt.
Von Dürers gewaltigem zeichnerischen Werk verdeutlicht eine
Auswahl von 12 Tafeln die Entwicklung von den Jugendzeichnungen, in
denen ein neues Körpergefühl machtvoll aus dem altgewohnten, spät-
gotischen Liniennetz herausstrebt, bis zu den in großer Form und macht-
vollen Rhythmen gebauten Blättern der Spätzeit. Nachdem in Winklers
zwei Abschlußbänden des Lippmannschen Corpus das Zeichnungswerk
des Meisters nun seine abschließende monumentale Katalogisierung ge-
funden hat, konnte naturgemäß Neues hier im allgemeinen nicht beige-
bracht werden. Bei dem »Reiter* des sogenannten Wolfgang Peurer nimmt
Schilling die Möglichkeit einer kopierenden Originalarbeit Dürers
an. In der Auswahl dieser Zeichnungen wird die alles umfassende und
durchdringende Vielseitigkeit seines Genius nach Vorwurf und Gattung
in wohl abwägender Akzentverteilung beleuchtet.
Größere Beachtung findet Hans von Kulmbach, dessen zeich-
nerisches Werk ja in den letzten Jahren mehrfach, zuletzt durch Fried-
rich Wmklers grundlegenden Aufsatz im Preußischen Jahrbuch, erörtert
worden ist. Schilling konnte jenes durch einige Neuentdeckungen noch
erweitern. Zu nennen ist hier vor allem sein Fund der »Tafelnden Liebes-
paare« im Louvre (Tafel 33), auch dieses mit starken Anklängen an Dürers
»Freuden der Welt« in Oxford. Wenn die definitive Benennung auf Kulm-
bach vom Autor auch nicht gewagt wird, so ist die Zugehörigkeit zu den
technisch und formal verwandten Blättern, die Winkler im genanntenAuf-
satz bringt, doch fraglos. (Vergleiche zum Beispiel den Kopf der von rück-
wärts gegebenen, am Tische tafelnden Frau Mitte rechts mit der Reiterin
in Rückansicht auf der Berliner Zeichnung, Winkler, Abb. 4.)
Bei dem zweiten Novum »Frauenraub« der Sammlung Masson,
Paris (Tafel 24), von Schilling »Dürerkreis um 1500« genannt, ist die
stilistische Beziehung zu Kuliubach in Modellierung und Strichführung
eine sehr nahe. (Vergleiche den Oxforder Christopherus und die Aktstudie
im Germanischen Museum, abgebildet in Beiträgen zur Geschichte der
Deutschen Kunst, Bd. I, S. 183, Abb. 104.) Ein hochinteressantes Blatt
ist das Ursula-Martyrium von 1508, von Tietze im Museum von Poitiers
entdeckt (Tafel 28). Schilling selber gibt die Zuschreibung auch nur mit
Vorbehalt. In der Tat sind hier die Figuren in Vergleich mit den meist
knochenloseren und unkubischen Kulmbachs auf seinen Zeichnungen
kleineren Formats von größerer Kraft und plastischerer Körperlichkeit.
Die stilistischen Beziehungen, die Schilling selbst zu einem 1512 datierten
Holzschnitt mit gleichem Thema in einem Nürnberger Buch von 1513
feststellt, sind allerdings sehr eng. Die Frage ist nur, ob hier wirklich
die Hand Kulmbachs zu sehen ist? Zu den im Berliner Kabinett befind-
lichen Entwürfen Kulmbachs zum Kaiserfenster in St. Sebald von 1514
wird ein weiterer, jetzt gevierteilter mit je einer Figur unter Arkatur
hinzugefügt (Tafel 30).
Ein wichtiger Fund ist das von Schilling im Louvre gefundene
»JüngsteGericht« (Tafel32) mit den phantastischen Callothaften Teufels-
silhouetten, das infolge alter Bezeichnung auf der Rückseite Hans
Dürer zugeteilt wird und damit wieder ein neues Argument in dieses
schwierige Problem hineinwirft. Neu Veröffentlichungen von Zeichnungen
Schäuffeleins sind dann noch ein interessantes Frühwerk aus den
Offizien (Tafel 35), ein Abendmahl von 1509 im Britischen Museum
(Tafel 37) und der prachtvolle, in kühner Verkürzung angelegte Jakobus-
kopf in Stockholm (Tafel 39). Sehr interessant der in eiliger geistreicher
Striehführung gegebene Entwurf Hermann Vischers d. J. mit der
Simsonlegende (Tafel 41;, in dessen Zeichnungsweise manches an
Venedig (Carpaccio-Richtung) gemahnt. Zum erstenmal wird der Entwurf
Hans Vischers zu seinem Nürnberger Rathausbrunnen von 1531 ab-
gebildet (Tafel 43). Eine neue F1 ö t n e r- Zeichnung sind die kegelspielenden
Putten, ähnlich einem Blatt der Erlanger Sammlung (Bock Nr. 365). Die
Venus und Amorzeichnung (Tafel 47), die Schilling, Parker folgend.
Bartel Beham zuweist, wird von Bock in seinem Erlanger Katalog
(Nr. 286) für ein Werk des I. ß., also des Pencz, gehalten. Bei den drei
von Pencz reproduzierten Zeichnungen erheben sich auch bei Schilling
selbst Zweifel betreffs der Urheberschaft der ersten, der Verleumdungs-
szene nach Apellcs (Tafel 51). Das Monogramm links unten ist aber mit
Bleistift gegeben, im Gegensatz zu der in Kreide ausgeführten Darstellung,
also entschieden nicht original. Außerdem ergaben die Beobachtungen
Friedländers und Buchners, daß die »G.P.«-Signatur erst um 1530 der
früheren »I.B.« folgt und in der Form, wie sie diese Zeichnung hat, nur auf
den Stichen B. 85 und B. 93 vorkommt, also viel später als auf diesem
Blatt. Die selbständige Stellung von Pencz, der damals bei der Ausmalung
des Nürnberger Rathaussaales (1521) nur etwa 20 Jahre war, scheint nicht
so überzeugend, als daß er einen eigenen Entwurf dafür gefertigt haben
kann. »Seine Aufgabe wird im wesentlichen darin bestanden haben, die
81
Die Meisterzeichnung. Eine Folge, herausgegeben
in Verbindung mit Fachgenossen von Walter Hügels-
hofer. III. Band: Edmund Schilling, »Nürnberger
Handzeichnungen des XV. und XVI. Jahrhunderts«.
Urban-Verlag, Freiburg im Breisgau, 1929. P. u. D. Col-
naghi & Co. Publishers. London.
Die unter dem Titel »Die Meisterzeichnung« groß angelegten
Veröffentlichungen des Urban-Verlags, Freiburg im Breisgau. haben sich
zunächst dem Gebiet der deutschen Handzeichnung zugewendet. Was
die Forschung auf dem Gebiet der deutschen Malerei im Herausheben,
Neubestimmen und differenzierenden Abgrenzen der einzelnen Schulen
getan hat, dieses Ziel ist für das große Gebiet der deutschen Handzeich-
nung des XV. und XVI. Jahrhunderts vom Verlage und dem Herausgeber
Walter Hugelshofer hier erstmals in Angriff genommen. In den einzelnen
Bänden wird je ein Schulgebiet nach Stammeskomplexen behandelt und
in einer Auswahl vorzüglicher Lichtdrucke von durchschnittlich je 60 Ta-
feln als ein geschlossenes Ganzes vorgeführt. Wie aus der Stammesart,
als dem konstanten Faktor, Form und Ausdruck im Linearen bedingt
sind und innerhalb einer geschlossenen Stilperiode ihre besondere Nuance
erhalten, ist in diesen Banden in wissenschaftlicher Sichtung und bild-
licher Wiedergabe zusammengestellt. Nach den zwei ersten Bänden
mit den schweizerischen und elsässischen Zeichnungen, die Hugelshofer
und Parker behandelten, bringt der dritte die Nürnberger Zeichnung
des XV. und XVI. Jahrhunderts, deren Auswahl Edmund Schilling zusam-
mengestellt hat, also das Gebiet, von dem durch die Person Dürers die
gewaltige Kraft einer das Alte sprengenden, völlig erneuerten zeichneri-
schen Form und eines neuen Bildgefühls ausgegangen ist. Das Inter-
essante und Wesentliche dieses Bandes liegt in der gebotenen Möglich-
keit, einen Einblick zu tun in die Mannigfaltigkeit zeichnerischer Be-
tätigung im Nürnberg des XVI. Jahrhunderts, Ausstrahlung und Wider-
hall des Dürerschen Genius, die Abwandlung seines Zeichenstiles bei
Schülern und Trabanten zu verfolgen. Unter den 60 Lichtdrucktafeln des
Bandes, die in vorzüglicher Schärfe der Wiedergabe den Ablauf der
Zeichnung in Nürnberg zwischen 1450 und etwa 1580 verbildlichen,
verdankt man Schilling die Bekanntschaft mit einer großen Reihe unbe-
kannter Blätter als Resultat seines wissenschaftlichen Spürsinnes. Auch
manches zwar schon bekannte Blatt findet man hier erstmals in technisch
einwandfreier Wiedergabe. Als Auftakt erscheint der prachtvolle Marien-
tod der Erlanger Sammlung aus der Zeit des Tucher-Altars, der hier erst-
mals gut reproduziert ist. Weitere Zeichnungen führen in den Werkstatt-
betrieb Pley d e n wurffs und Wo Ige muts, also in die Epoche der Spät-
gotik. Hier wird mit Recht auch Veit Stoß, der trotz seines späten Todes
immer der rückwärts Gerichtete geblieben war, sowie der alte Peter
Vischer(mit einem Teil vom Sebaldusgrab-Entwurf der Wiener Akademie)
eingereiht. Aus der Fülle der überkommenen Zeichnungen des Pleyden-
wurff- und Wolgemut-Kreises wählt Schilling zunächst das Budapester
Kreuzigungsblatt, dessen naher Zusammenhang mit Pieydenwurffs ge-
gcmalten Kreuzigungen in München und Nürnberg überzeugt. Zu der
schon früher von Schilling veröffentlichten Kreuztragung der Sammlung
Lahmann, die Ernst Buchner nach Franken lokalisierte und als Werkstatt-
arbeit des »Meisters der Kilianslegende« bestimmte (Beiträge zur Ge-
schichte der deutschen Kunst, Bd. II, S. 497), hat der Autor von der
gleichen Hand eine Dornenkrönung im Stuttgarter Kabinett (Tafel 4)
hinzu entdeckt.
Von Dürers gewaltigem zeichnerischen Werk verdeutlicht eine
Auswahl von 12 Tafeln die Entwicklung von den Jugendzeichnungen, in
denen ein neues Körpergefühl machtvoll aus dem altgewohnten, spät-
gotischen Liniennetz herausstrebt, bis zu den in großer Form und macht-
vollen Rhythmen gebauten Blättern der Spätzeit. Nachdem in Winklers
zwei Abschlußbänden des Lippmannschen Corpus das Zeichnungswerk
des Meisters nun seine abschließende monumentale Katalogisierung ge-
funden hat, konnte naturgemäß Neues hier im allgemeinen nicht beige-
bracht werden. Bei dem »Reiter* des sogenannten Wolfgang Peurer nimmt
Schilling die Möglichkeit einer kopierenden Originalarbeit Dürers
an. In der Auswahl dieser Zeichnungen wird die alles umfassende und
durchdringende Vielseitigkeit seines Genius nach Vorwurf und Gattung
in wohl abwägender Akzentverteilung beleuchtet.
Größere Beachtung findet Hans von Kulmbach, dessen zeich-
nerisches Werk ja in den letzten Jahren mehrfach, zuletzt durch Fried-
rich Wmklers grundlegenden Aufsatz im Preußischen Jahrbuch, erörtert
worden ist. Schilling konnte jenes durch einige Neuentdeckungen noch
erweitern. Zu nennen ist hier vor allem sein Fund der »Tafelnden Liebes-
paare« im Louvre (Tafel 33), auch dieses mit starken Anklängen an Dürers
»Freuden der Welt« in Oxford. Wenn die definitive Benennung auf Kulm-
bach vom Autor auch nicht gewagt wird, so ist die Zugehörigkeit zu den
technisch und formal verwandten Blättern, die Winkler im genanntenAuf-
satz bringt, doch fraglos. (Vergleiche zum Beispiel den Kopf der von rück-
wärts gegebenen, am Tische tafelnden Frau Mitte rechts mit der Reiterin
in Rückansicht auf der Berliner Zeichnung, Winkler, Abb. 4.)
Bei dem zweiten Novum »Frauenraub« der Sammlung Masson,
Paris (Tafel 24), von Schilling »Dürerkreis um 1500« genannt, ist die
stilistische Beziehung zu Kuliubach in Modellierung und Strichführung
eine sehr nahe. (Vergleiche den Oxforder Christopherus und die Aktstudie
im Germanischen Museum, abgebildet in Beiträgen zur Geschichte der
Deutschen Kunst, Bd. I, S. 183, Abb. 104.) Ein hochinteressantes Blatt
ist das Ursula-Martyrium von 1508, von Tietze im Museum von Poitiers
entdeckt (Tafel 28). Schilling selber gibt die Zuschreibung auch nur mit
Vorbehalt. In der Tat sind hier die Figuren in Vergleich mit den meist
knochenloseren und unkubischen Kulmbachs auf seinen Zeichnungen
kleineren Formats von größerer Kraft und plastischerer Körperlichkeit.
Die stilistischen Beziehungen, die Schilling selbst zu einem 1512 datierten
Holzschnitt mit gleichem Thema in einem Nürnberger Buch von 1513
feststellt, sind allerdings sehr eng. Die Frage ist nur, ob hier wirklich
die Hand Kulmbachs zu sehen ist? Zu den im Berliner Kabinett befind-
lichen Entwürfen Kulmbachs zum Kaiserfenster in St. Sebald von 1514
wird ein weiterer, jetzt gevierteilter mit je einer Figur unter Arkatur
hinzugefügt (Tafel 30).
Ein wichtiger Fund ist das von Schilling im Louvre gefundene
»JüngsteGericht« (Tafel32) mit den phantastischen Callothaften Teufels-
silhouetten, das infolge alter Bezeichnung auf der Rückseite Hans
Dürer zugeteilt wird und damit wieder ein neues Argument in dieses
schwierige Problem hineinwirft. Neu Veröffentlichungen von Zeichnungen
Schäuffeleins sind dann noch ein interessantes Frühwerk aus den
Offizien (Tafel 35), ein Abendmahl von 1509 im Britischen Museum
(Tafel 37) und der prachtvolle, in kühner Verkürzung angelegte Jakobus-
kopf in Stockholm (Tafel 39). Sehr interessant der in eiliger geistreicher
Striehführung gegebene Entwurf Hermann Vischers d. J. mit der
Simsonlegende (Tafel 41;, in dessen Zeichnungsweise manches an
Venedig (Carpaccio-Richtung) gemahnt. Zum erstenmal wird der Entwurf
Hans Vischers zu seinem Nürnberger Rathausbrunnen von 1531 ab-
gebildet (Tafel 43). Eine neue F1 ö t n e r- Zeichnung sind die kegelspielenden
Putten, ähnlich einem Blatt der Erlanger Sammlung (Bock Nr. 365). Die
Venus und Amorzeichnung (Tafel 47), die Schilling, Parker folgend.
Bartel Beham zuweist, wird von Bock in seinem Erlanger Katalog
(Nr. 286) für ein Werk des I. ß., also des Pencz, gehalten. Bei den drei
von Pencz reproduzierten Zeichnungen erheben sich auch bei Schilling
selbst Zweifel betreffs der Urheberschaft der ersten, der Verleumdungs-
szene nach Apellcs (Tafel 51). Das Monogramm links unten ist aber mit
Bleistift gegeben, im Gegensatz zu der in Kreide ausgeführten Darstellung,
also entschieden nicht original. Außerdem ergaben die Beobachtungen
Friedländers und Buchners, daß die »G.P.«-Signatur erst um 1530 der
früheren »I.B.« folgt und in der Form, wie sie diese Zeichnung hat, nur auf
den Stichen B. 85 und B. 93 vorkommt, also viel später als auf diesem
Blatt. Die selbständige Stellung von Pencz, der damals bei der Ausmalung
des Nürnberger Rathaussaales (1521) nur etwa 20 Jahre war, scheint nicht
so überzeugend, als daß er einen eigenen Entwurf dafür gefertigt haben
kann. »Seine Aufgabe wird im wesentlichen darin bestanden haben, die
81