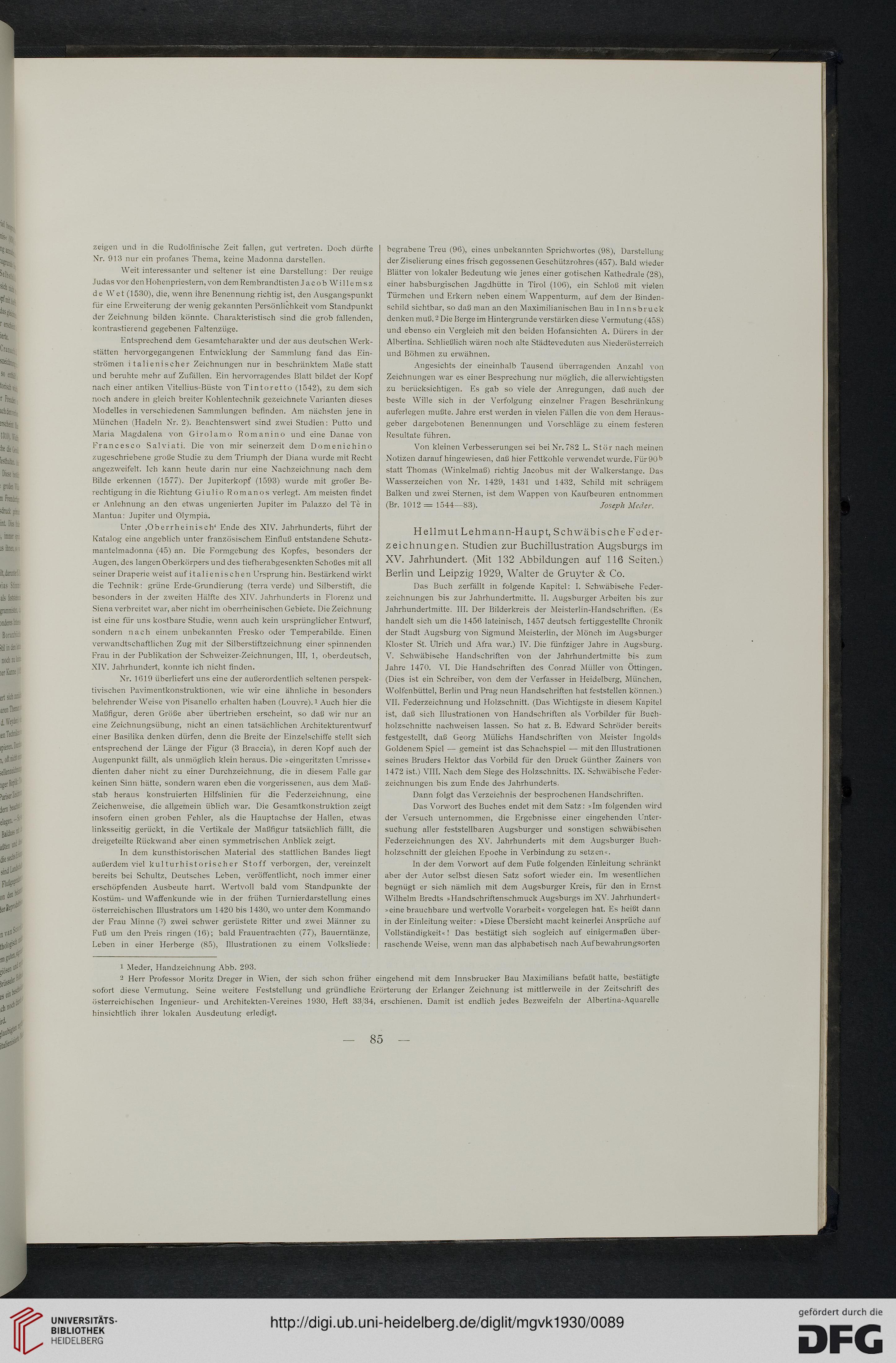zeigen und in die Rudolfinische Zeit fallen, gut vertreten. Doch dürfte
Nr. 913 nur ein profanes Thema, keine Madonna darstellen.
Weit interessanter und seltener ist eine Darstellung: Der reuige
Judas vor den Hohenpriestern, von demRembrandtisten Jacob Willemsz
de Wet (1530), die, wenn ihre Benennung richtig ist, den Ausgangspunkt
für eine Erweiterung der wenig gekannten Persönlichkeit vom Standpunkt
der Zeichnung bilden könnte. Charakteristisch sind die grob fallenden,
kontrastierend gegebenen Faltenzüge.
Entsprechend dem Gesamtcharakter und der aus deutschen Werk-
stätten hervorgegangenen Entwicklung der Sammlung fand das Ein-
strömen italienischer Zeichnungen nur in beschränktem Maße statt
und beruhte mehr auf Zufällen. Ein hervorragendes Blatt bildet der Kopf
nach einer antiken Yitellius-Büste von Tintoretto (1542), zu dem sich
noch andere in gleich breiter Kohlentechnik gezeichnete Varianten dieses
Modelles in verschiedenen Sammlungen befinden. Am nächsten jene in
München (Hadeln Nr. 2). Beachtenswert sind zwei Studien: Putto und
Maria Magdalena von Giro 1 amo Romanino und eine Danae von
Francesco Salviati. Die von mir seinerzeit dem Domenichino
zugeschriebene große Studie zu dem Triumph der Diana wurde mit Recht
angezweifelt. Ich kann heute darin nur eine Nachzeichnung nach dem
Bilde erkennen (1577). Der Jupiterkopf (1593) wurde mit großer Be-
rechtigung in die Richtung Giulio Romanos verlegt. Am meisten findet
er Anlehnung an den etwas ungenierten Jupiter im Palazzo del Te in
Mantua: Jupiter und Olympia.
Unter ^Oberrheinisch' Ende des XIV. Jahrhunderts, führt der
Katalog eine angeblich unter französischem Einfluß entstandene Schutz-
mantelmadonna (45) an. Die Formgebung des Kopfes, besonders der
Augen, des langen Oberkörpers und des tiefherabgesenkten Schoßes mit all
seiner Draperie weist auf italienischen Ursprung hin. Bestärkend wirkt
die Technik: grüne Erde-Grundierung (terra verde) und Silberstift, die
besonders in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts in Florenz und
Siena verbreitet war, aber nicht im oberrheinischen Gebiete. Die Zeichnung
ist eine für uns kostbare Studie, wenn auch kein ursprünglicher Entwurf,
sondern nach einem unbekannten Fresko oder Temperabilde. Einen
verwandtschaftlichen Zug mit der Silberstiftzeichnung einer spinnenden
Frau in der Publikation der Schweizer-Zeichnungen, III, 1, oberdeutsch,
XIV. Jahrhundert, konnte ich nicht finden.
Nr. 1 619 überliefert uns eine der außerordentlich seltenen perspek-
tivischen Pavimentkonstruktionen, wie wir eine ähnliche in besonders
belehrender Weise von Pisanello erhalten haben (Louvre).1 Auch hier die
Maßfigur, deren Größe aber übertrieben erscheint, so daß wir nur an
eine Zeichnungsübung, nicht an einen tatsächlichen Architekturentwurf
einer Basilika denken dürfen, denn die Breite der Einzelschiffe stellt sich
entsprechend der Lange der Figur (3 Braccia), in deren Kopf auch der
Augenpunkt fällt, als unmöglich klein heraus. Die »eingeritzten Umrisse«
dienten daher nicht zu einer Durchzeichnung, die in diesem Falle gar
keinen Sinn hätte, sondern waren eben die vorgerissenen, aus dem Maß-
stab heraus konstruierten Hilfslinien für die Federzeichnung, eine
Zeichenweise, die allgemein üblich war. Die Gesamtkonstruktion zeigt
insofern einen groben Fehler, als die Hauptachse der Hallen, etwas
linksseitig gerückt, in die Vertikale der Maßfigur tatsächlich fällt, die
dreigeteilte Rückwand aber einen symmetrischen Anblick zeigt.
In dem kunsthistorischen Material des stattlichen Bandes liegt
außerdem viel kulturhistorischer Stoff verborgen, der, vereinzelt
bereits bei Schultz, Deutsches Leben, veröffentlicht, noch immer einer
erschöpfenden Ausbeute harrt. Wertvoll bald vom Standpunkte der
Kostüm- und Waffenkunde wie in der frühen Turnierdarstellung eines
österreichischen Illustrators um 1420 bis 1430, wo unter dem Kommando
der Frau Minne (?) zwei schwer gerüstete Ritter und zwei Männer zu
Fuß um den Preis ringen (16); bald Frauentrachten (77), Bauerntänze,
Leben in einer Herberge (85), Illustrationen zu einem Volksliede:
begrabene Treu (96), eines unbekannten Sprichwortes (98), Darstellung
der Ziselierung eines frisch gegossenen Geschützrohres (457). Bald wieder
Blätter von lokaler Bedeutung wie jenes einer gotischen Kathedrale (28),
einer habsburgischen Jagdhütte in Tirol (106), ein Schloß mit vielen
Türmchen und Erkern neben einem Wappenturm, auf dem der Binden-
schild sichtbar, so daß man an den Maximilianischen Bau in Innsbruck
denken muß.2 Die Berge im Hintergrunde verstärken diese Vermutung (458)
und ebenso ein Vergleich mit den beiden Hofansichten A. Dürers in der
Albertina. Schließlich waren noch alte Städteveduten aus Niederösterreich
und Böhmen zu erwähnen.
Angesichts der eineinhalb Tausend überragenden Anzahl von
Zeichnungen war es einer Besprechung nur möglich, die allerwichtigsten
zu berücksichtigen. Es gab so viele der Anregungen, daß auch der
beste Wille sich in der Verfolgung einzelner Fragen Beschränkung
auferlegen mußte. Jahre erst werden in vielen Fällen die von dem Heraus-
geber dargebotenen Benennungen und Vorschläge zu einem festeren
Resultate führen.
Von kleinen Verbesserungen sei bei Nr.782 L. Stör nach meinen
Notizen daraufhingewiesen, daß hier Fettkohle verwendet wurde. Für90b
statt Thomas (Winkelmaß) richtig Jacobus mit der Walkerstange. Das
Wasserzeichen von Nr. 1429, 1431 und 1432, Schild mit schrägem
Balken und zwei Sternen, ist dem Wappen von Kaufbeuren entnommen
(Br. 1012 = 1544—83). Joseph Meder.
Hellmut Lehmann-Haupt, Schwäbische Feder-
zeichnungen. Studien zur Buchillustration Augsburgs im
XV. Jahrhundert. (Mit 132 Abbildungen auf 116 Seiten.)
Berlin und Leipzig 1929, Walter de Gruyter & Co.
Das Buch zerfällt in folgende Kapitel: I. Schwäbische Feder-
zeichnungen bis zur Jahrhundertmitte. II. Augsburger Arbeiten bis zur
Jahrhundertmitte. III. Der Bilderkreis der Meisterlin-Handschriften. (Es
handelt sich um die 1456 lateinisch, 1457 deutsch fertiggestellte Chronik
der Stadt Augsburg von Sigmund Meisterlin, der Mönch im Augsburger
Kloster St. Ulrich und Afra war.) IV. Die fünfziger Jahre in Augsburg.
V. Schwäbische Handschriften von der Jahrhundertmitte bis zum
Jahre 1470. VI. Die Handschriften des Conrad Müller von Öttingen.
(Dies ist ein Schreiber, von dem der Verfasser in Heidelberg, München.
Wolfenbüttel, Berlin und Prag neun Handschriften hat feststellen können.)
VII. Federzeichnung und Holzschnitt. (Das Wichtigste in diesem Kapitel
ist, daß sich Illustrationen von Handschriften als Vorbilder für Buch-
holzschnitte nachweisen lassen. So hat z. B. Edward Schröder bereits
festgestellt, daß Georg Mülichs Handschriften von Meister Ingolds
Goldenem Spiel — gemeint ist das Schachspiel — mit den Illustrationen
seines Bruders Hektor das Vorbild für den Druck Günther Zainers von
1472 ist.) VIII. Nach dem Siege des Holzschnitts. IX. Schwäbische Feder-
zeichnungen bis zum Ende des Jahrhunderts.
Dann folgt das Verzeichnis der besprochenen Handschriften.
Das Vorwort des Buches endet mit dem Satz: »Im folgenden wird
der Versuch unternommen, die Ergebnisse einer eingehenden Unter-
suchung aller feststellbaren Augsburger und sonstigen schwäbischen
Federzeichnungen des XV. Jahrhunderts mit dem Augsburger Buch-
holzschnitt der gleichen Epoche in Verbindung zu setzen«.
In der dem Vorwort auf dem Fuße folgenden Einleitung schränkt
aber der Autor selbst diesen Satz sofort wieder ein. Im wesentlichen
begnügt er sich nämlich mit dem Augsburger Kreis, für den in Ernst
Wilhelm Bredts »Handschriftenschmuck Augsburgs im XV. Jahrhundert«
»eine brauchbare und wertvolle Vorarbeit« vorgelegen hat. Es heißt dann
in der Einleitung weiter: »Diese Übersicht macht keinerlei Ansprüche auf
Vollständigkeit«! Das bestätigt sich sogleich auf einigermaßen über-
raschende Weise, wenn man das alphabetisch nach Aufbewahrungsorten
1 Meder, Handzeichnung Abb. 293.
2 Herr Professor Moritz Dreger in Wien, der sich schon früher eingehend mit dem Innsbrucker Bau Maximilians befaßt hatte, bestätigte
sofort diese Vermutung. Seine weitere Feststellung und gründliche Erörterung der Erlanger Zeichnung ist mittlerweile in der Zeitschrift des
österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereines 1930, Heft 33/34, erschienen. Damit ist endlich jedes Bezweifeln der Albertina-Aquarelle
hinsichtlich ihrer lokalen Ausdeutung erledigt.
— 85 —
Nr. 913 nur ein profanes Thema, keine Madonna darstellen.
Weit interessanter und seltener ist eine Darstellung: Der reuige
Judas vor den Hohenpriestern, von demRembrandtisten Jacob Willemsz
de Wet (1530), die, wenn ihre Benennung richtig ist, den Ausgangspunkt
für eine Erweiterung der wenig gekannten Persönlichkeit vom Standpunkt
der Zeichnung bilden könnte. Charakteristisch sind die grob fallenden,
kontrastierend gegebenen Faltenzüge.
Entsprechend dem Gesamtcharakter und der aus deutschen Werk-
stätten hervorgegangenen Entwicklung der Sammlung fand das Ein-
strömen italienischer Zeichnungen nur in beschränktem Maße statt
und beruhte mehr auf Zufällen. Ein hervorragendes Blatt bildet der Kopf
nach einer antiken Yitellius-Büste von Tintoretto (1542), zu dem sich
noch andere in gleich breiter Kohlentechnik gezeichnete Varianten dieses
Modelles in verschiedenen Sammlungen befinden. Am nächsten jene in
München (Hadeln Nr. 2). Beachtenswert sind zwei Studien: Putto und
Maria Magdalena von Giro 1 amo Romanino und eine Danae von
Francesco Salviati. Die von mir seinerzeit dem Domenichino
zugeschriebene große Studie zu dem Triumph der Diana wurde mit Recht
angezweifelt. Ich kann heute darin nur eine Nachzeichnung nach dem
Bilde erkennen (1577). Der Jupiterkopf (1593) wurde mit großer Be-
rechtigung in die Richtung Giulio Romanos verlegt. Am meisten findet
er Anlehnung an den etwas ungenierten Jupiter im Palazzo del Te in
Mantua: Jupiter und Olympia.
Unter ^Oberrheinisch' Ende des XIV. Jahrhunderts, führt der
Katalog eine angeblich unter französischem Einfluß entstandene Schutz-
mantelmadonna (45) an. Die Formgebung des Kopfes, besonders der
Augen, des langen Oberkörpers und des tiefherabgesenkten Schoßes mit all
seiner Draperie weist auf italienischen Ursprung hin. Bestärkend wirkt
die Technik: grüne Erde-Grundierung (terra verde) und Silberstift, die
besonders in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts in Florenz und
Siena verbreitet war, aber nicht im oberrheinischen Gebiete. Die Zeichnung
ist eine für uns kostbare Studie, wenn auch kein ursprünglicher Entwurf,
sondern nach einem unbekannten Fresko oder Temperabilde. Einen
verwandtschaftlichen Zug mit der Silberstiftzeichnung einer spinnenden
Frau in der Publikation der Schweizer-Zeichnungen, III, 1, oberdeutsch,
XIV. Jahrhundert, konnte ich nicht finden.
Nr. 1 619 überliefert uns eine der außerordentlich seltenen perspek-
tivischen Pavimentkonstruktionen, wie wir eine ähnliche in besonders
belehrender Weise von Pisanello erhalten haben (Louvre).1 Auch hier die
Maßfigur, deren Größe aber übertrieben erscheint, so daß wir nur an
eine Zeichnungsübung, nicht an einen tatsächlichen Architekturentwurf
einer Basilika denken dürfen, denn die Breite der Einzelschiffe stellt sich
entsprechend der Lange der Figur (3 Braccia), in deren Kopf auch der
Augenpunkt fällt, als unmöglich klein heraus. Die »eingeritzten Umrisse«
dienten daher nicht zu einer Durchzeichnung, die in diesem Falle gar
keinen Sinn hätte, sondern waren eben die vorgerissenen, aus dem Maß-
stab heraus konstruierten Hilfslinien für die Federzeichnung, eine
Zeichenweise, die allgemein üblich war. Die Gesamtkonstruktion zeigt
insofern einen groben Fehler, als die Hauptachse der Hallen, etwas
linksseitig gerückt, in die Vertikale der Maßfigur tatsächlich fällt, die
dreigeteilte Rückwand aber einen symmetrischen Anblick zeigt.
In dem kunsthistorischen Material des stattlichen Bandes liegt
außerdem viel kulturhistorischer Stoff verborgen, der, vereinzelt
bereits bei Schultz, Deutsches Leben, veröffentlicht, noch immer einer
erschöpfenden Ausbeute harrt. Wertvoll bald vom Standpunkte der
Kostüm- und Waffenkunde wie in der frühen Turnierdarstellung eines
österreichischen Illustrators um 1420 bis 1430, wo unter dem Kommando
der Frau Minne (?) zwei schwer gerüstete Ritter und zwei Männer zu
Fuß um den Preis ringen (16); bald Frauentrachten (77), Bauerntänze,
Leben in einer Herberge (85), Illustrationen zu einem Volksliede:
begrabene Treu (96), eines unbekannten Sprichwortes (98), Darstellung
der Ziselierung eines frisch gegossenen Geschützrohres (457). Bald wieder
Blätter von lokaler Bedeutung wie jenes einer gotischen Kathedrale (28),
einer habsburgischen Jagdhütte in Tirol (106), ein Schloß mit vielen
Türmchen und Erkern neben einem Wappenturm, auf dem der Binden-
schild sichtbar, so daß man an den Maximilianischen Bau in Innsbruck
denken muß.2 Die Berge im Hintergrunde verstärken diese Vermutung (458)
und ebenso ein Vergleich mit den beiden Hofansichten A. Dürers in der
Albertina. Schließlich waren noch alte Städteveduten aus Niederösterreich
und Böhmen zu erwähnen.
Angesichts der eineinhalb Tausend überragenden Anzahl von
Zeichnungen war es einer Besprechung nur möglich, die allerwichtigsten
zu berücksichtigen. Es gab so viele der Anregungen, daß auch der
beste Wille sich in der Verfolgung einzelner Fragen Beschränkung
auferlegen mußte. Jahre erst werden in vielen Fällen die von dem Heraus-
geber dargebotenen Benennungen und Vorschläge zu einem festeren
Resultate führen.
Von kleinen Verbesserungen sei bei Nr.782 L. Stör nach meinen
Notizen daraufhingewiesen, daß hier Fettkohle verwendet wurde. Für90b
statt Thomas (Winkelmaß) richtig Jacobus mit der Walkerstange. Das
Wasserzeichen von Nr. 1429, 1431 und 1432, Schild mit schrägem
Balken und zwei Sternen, ist dem Wappen von Kaufbeuren entnommen
(Br. 1012 = 1544—83). Joseph Meder.
Hellmut Lehmann-Haupt, Schwäbische Feder-
zeichnungen. Studien zur Buchillustration Augsburgs im
XV. Jahrhundert. (Mit 132 Abbildungen auf 116 Seiten.)
Berlin und Leipzig 1929, Walter de Gruyter & Co.
Das Buch zerfällt in folgende Kapitel: I. Schwäbische Feder-
zeichnungen bis zur Jahrhundertmitte. II. Augsburger Arbeiten bis zur
Jahrhundertmitte. III. Der Bilderkreis der Meisterlin-Handschriften. (Es
handelt sich um die 1456 lateinisch, 1457 deutsch fertiggestellte Chronik
der Stadt Augsburg von Sigmund Meisterlin, der Mönch im Augsburger
Kloster St. Ulrich und Afra war.) IV. Die fünfziger Jahre in Augsburg.
V. Schwäbische Handschriften von der Jahrhundertmitte bis zum
Jahre 1470. VI. Die Handschriften des Conrad Müller von Öttingen.
(Dies ist ein Schreiber, von dem der Verfasser in Heidelberg, München.
Wolfenbüttel, Berlin und Prag neun Handschriften hat feststellen können.)
VII. Federzeichnung und Holzschnitt. (Das Wichtigste in diesem Kapitel
ist, daß sich Illustrationen von Handschriften als Vorbilder für Buch-
holzschnitte nachweisen lassen. So hat z. B. Edward Schröder bereits
festgestellt, daß Georg Mülichs Handschriften von Meister Ingolds
Goldenem Spiel — gemeint ist das Schachspiel — mit den Illustrationen
seines Bruders Hektor das Vorbild für den Druck Günther Zainers von
1472 ist.) VIII. Nach dem Siege des Holzschnitts. IX. Schwäbische Feder-
zeichnungen bis zum Ende des Jahrhunderts.
Dann folgt das Verzeichnis der besprochenen Handschriften.
Das Vorwort des Buches endet mit dem Satz: »Im folgenden wird
der Versuch unternommen, die Ergebnisse einer eingehenden Unter-
suchung aller feststellbaren Augsburger und sonstigen schwäbischen
Federzeichnungen des XV. Jahrhunderts mit dem Augsburger Buch-
holzschnitt der gleichen Epoche in Verbindung zu setzen«.
In der dem Vorwort auf dem Fuße folgenden Einleitung schränkt
aber der Autor selbst diesen Satz sofort wieder ein. Im wesentlichen
begnügt er sich nämlich mit dem Augsburger Kreis, für den in Ernst
Wilhelm Bredts »Handschriftenschmuck Augsburgs im XV. Jahrhundert«
»eine brauchbare und wertvolle Vorarbeit« vorgelegen hat. Es heißt dann
in der Einleitung weiter: »Diese Übersicht macht keinerlei Ansprüche auf
Vollständigkeit«! Das bestätigt sich sogleich auf einigermaßen über-
raschende Weise, wenn man das alphabetisch nach Aufbewahrungsorten
1 Meder, Handzeichnung Abb. 293.
2 Herr Professor Moritz Dreger in Wien, der sich schon früher eingehend mit dem Innsbrucker Bau Maximilians befaßt hatte, bestätigte
sofort diese Vermutung. Seine weitere Feststellung und gründliche Erörterung der Erlanger Zeichnung ist mittlerweile in der Zeitschrift des
österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereines 1930, Heft 33/34, erschienen. Damit ist endlich jedes Bezweifeln der Albertina-Aquarelle
hinsichtlich ihrer lokalen Ausdeutung erledigt.
— 85 —