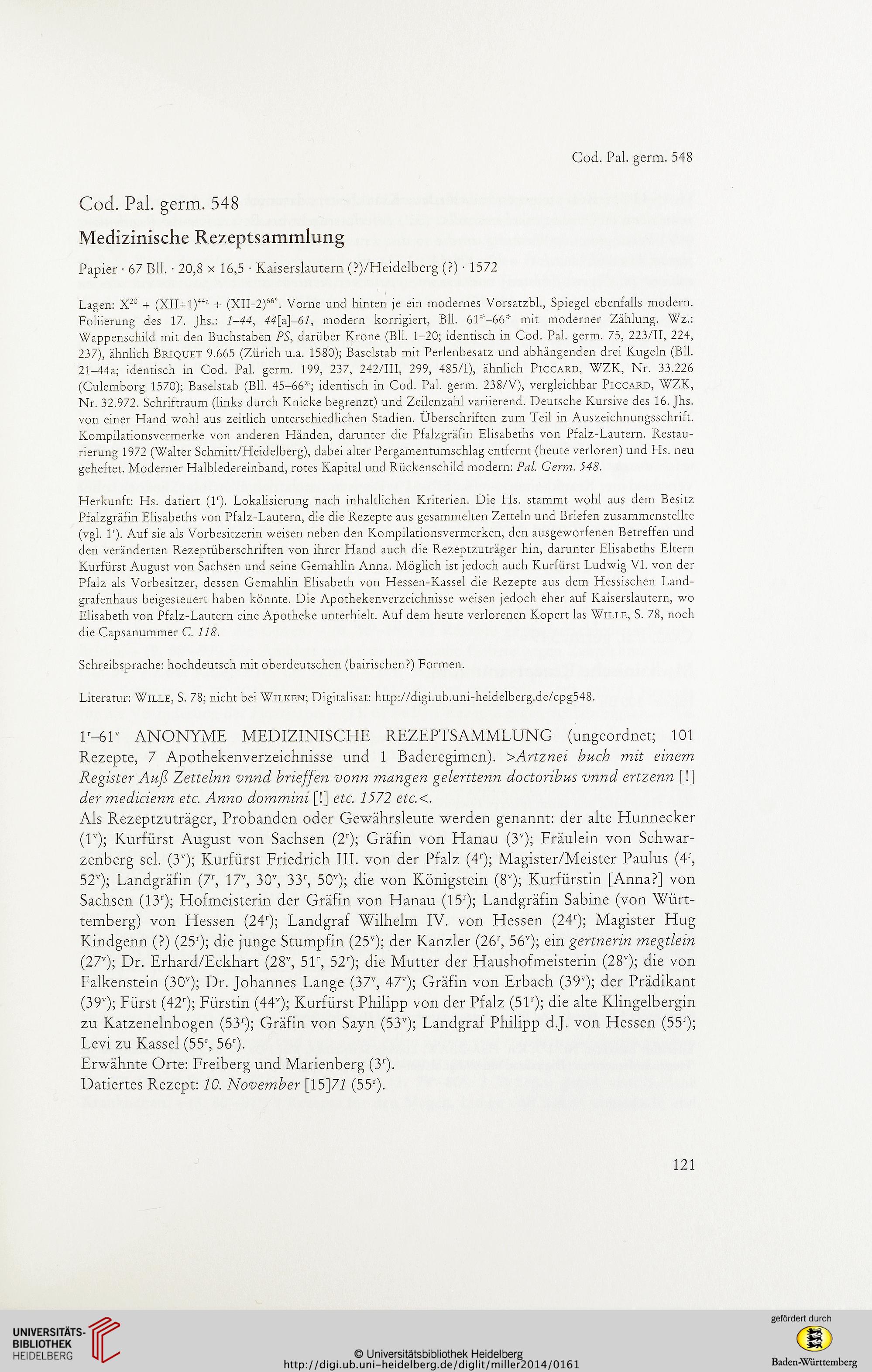Cod. Pal. germ. 548
Cod. Pal. germ. 548
Medizinische Rezeptsammlung
Papier • 67 Bll. • 20,8 x 16,5 • Kaiserslautern (?)/Heidelberg (?) • 1572
Lagen: X 20 + (XII+l) 44a + (XII-2) 66''. Vorne und hinten je ein modernes Vorsatzbl., Spiegel ebenfalls modern.
Foliierung des 17. Jhs.: 1-44, 44[a]-61, modern korrigiert, Bll. 61 ;:'-66 :;' mit moderner Zählung. Wz.:
Wappenschild mit den Buchstaben PS, darüber Krone (Bll. 1-20; ldentisch in Cod. Pal. germ. 75, 223/11, 224,
237), ähnlich Briquet 9.665 (Zürich u.a. 1580); Baselstab mit Perlenbesatz und abhängenden drei Kugeln (Bll.
21-44a; identisch in Cod. Pal. germ. 199, 237, 242/III, 299, 485/1), ähnlich Piccard, WZK, Nr. 33.226
(Culemborg 1570); Baselstab (Bll. 45-66 ::'; identisch in Cod. Pal. germ. 238/V), vergleichbar Piccard, WZK,
Nr. 32.972. Schriftraum (links durch Knicke begrenzt) und Zeilenzahl variierend. Deutsche Kursive des 16. Jhs.
von einer Hand wohl aus zeitlich unterschiedlichen Stadien. Uberschriften zum Teil in Auszeichnungsschrift.
Kompilationsvermerke von anderen Händen, darunter die Pfalzgräfin Elisabeths von Pfalz-Lautern. Restau-
rierung 1972 (Walter Schmitt/Heidelberg), dabei alter Pergamentumschlag entfernt (heute verloren) und Hs. neu
geheftet. Moderner Halbledereinband, rotes Kapital und Rückenschild modern: Pal. Germ. 548.
Herkunft: Hs. datiert (l r). Lokalisierung nach inhaltlichen Kriterien. Die Hs. stammt wohl aus dem Besitz
Pfalzgräfin Elisabeths von Pfalz-Lautern, die die Rezepte aus gesammelten Zetteln und Briefen zusammenstellte
(vgl. l r). Auf sie als Vorbesitzerin weisen neben den Kompilationsvermerken, den ausgeworfenen Betreffen und
den veränderten Rezeptüberschriften von ihrer Hand auch die Rezeptzuträger hin, darunter Elisabeths Eltern
Kurfürst August von Sachsen und seine Gemahlin Anna. Möglich ist jedoch auch Kurfürst Ludwig VI. von der
Pfalz als Vorbesitzer, dessen Gemahlin Elisabeth von Hessen-Kassel die Rezepte aus dem Hessischen Land-
grafenhaus beigesteuert haben könnte. Die Apothekenverzeichnisse weisen jedoch eher auf Kaiserslautern, wo
Elisabeth von Pfalz-Lautern eine Apotheke unterhielt. Auf dem heute verlorenen Kopert las Wille, S. 78, noch
die Capsanummer C. 118.
Schreibsprache: hochdeutsch mit oberdeutschen (bairischen?) Formen.
Literatur: Wille, S. 78; nicht bei Wilken; Digitalisat: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/cpg548.
1 r—61 v ANONYME MEDIZINISCHE REZEPTSAMMLUNG (ungeordnet; 101
Rezepte, 7 Apothekenverzeichnisse und 1 Baderegimen). >Artznei buch mit einem
Register Auß Zettelnn vnnd brieffen vonn mangen gelerttenn doctoribus vnnd ertzenn [!]
der medicienn etc. Anno dommini [!] etc. 1572 etc.<.
Als Rezeptzuträger, Probanden oder Gewährsleute werden genannt: der alte Hunnecker
(l v); Kurfürst August von Sachsen (2 r); Gräfin von Hanau (3 V); Fräulein von Schwar-
zenberg sel. (3 V); Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz (4 r); Magister/Meister Paulus (4 r,
52 v); Landgräfin (7 r, 17 v, 30 v, 33 r, 50 v); die von Königstein (8 V); Kurfürstin [Anna?] von
Sachsen (13 r); Hofmeisterin der Gräfin von Hanau (15 r); Landgräfin Sabine (von Würt-
temberg) von Hessen (24 r); Landgraf Wilhelm IV. von Hessen (24 r); Magister Hug
Kindgenn (?) (25 r); die junge Stumpfin (25 v); der Kanzler (26 r, 56 v); ein gertnenn megtlein
(27 v); Dr. Erhard/Eckhart (28 v, 51 r, 52 r); die Mutter der Haushofmeisterin (28 v); die von
Falkenstein (30 v); Dr. Johannes Lange (37 v, 47 v); Gräfin von Erbach (39 v); der Prädikant
(39 v); Fürst (42 r); Fürstin (44 v); Kurfürst Philipp von der Pfalz (51 r); die alte Klingelbergin
zu Katzenelnbogen (53 r); Gräfin von Sayn (53 v); Landgraf Philipp d.J. von Hessen (55 r);
Levi zu Kassel (55 r, 56 r).
Erwähnte Orte: Freiberg und Marienberg (3 r).
Datiertes Rezept: 10. November [15]77 (55 r).
121
Cod. Pal. germ. 548
Medizinische Rezeptsammlung
Papier • 67 Bll. • 20,8 x 16,5 • Kaiserslautern (?)/Heidelberg (?) • 1572
Lagen: X 20 + (XII+l) 44a + (XII-2) 66''. Vorne und hinten je ein modernes Vorsatzbl., Spiegel ebenfalls modern.
Foliierung des 17. Jhs.: 1-44, 44[a]-61, modern korrigiert, Bll. 61 ;:'-66 :;' mit moderner Zählung. Wz.:
Wappenschild mit den Buchstaben PS, darüber Krone (Bll. 1-20; ldentisch in Cod. Pal. germ. 75, 223/11, 224,
237), ähnlich Briquet 9.665 (Zürich u.a. 1580); Baselstab mit Perlenbesatz und abhängenden drei Kugeln (Bll.
21-44a; identisch in Cod. Pal. germ. 199, 237, 242/III, 299, 485/1), ähnlich Piccard, WZK, Nr. 33.226
(Culemborg 1570); Baselstab (Bll. 45-66 ::'; identisch in Cod. Pal. germ. 238/V), vergleichbar Piccard, WZK,
Nr. 32.972. Schriftraum (links durch Knicke begrenzt) und Zeilenzahl variierend. Deutsche Kursive des 16. Jhs.
von einer Hand wohl aus zeitlich unterschiedlichen Stadien. Uberschriften zum Teil in Auszeichnungsschrift.
Kompilationsvermerke von anderen Händen, darunter die Pfalzgräfin Elisabeths von Pfalz-Lautern. Restau-
rierung 1972 (Walter Schmitt/Heidelberg), dabei alter Pergamentumschlag entfernt (heute verloren) und Hs. neu
geheftet. Moderner Halbledereinband, rotes Kapital und Rückenschild modern: Pal. Germ. 548.
Herkunft: Hs. datiert (l r). Lokalisierung nach inhaltlichen Kriterien. Die Hs. stammt wohl aus dem Besitz
Pfalzgräfin Elisabeths von Pfalz-Lautern, die die Rezepte aus gesammelten Zetteln und Briefen zusammenstellte
(vgl. l r). Auf sie als Vorbesitzerin weisen neben den Kompilationsvermerken, den ausgeworfenen Betreffen und
den veränderten Rezeptüberschriften von ihrer Hand auch die Rezeptzuträger hin, darunter Elisabeths Eltern
Kurfürst August von Sachsen und seine Gemahlin Anna. Möglich ist jedoch auch Kurfürst Ludwig VI. von der
Pfalz als Vorbesitzer, dessen Gemahlin Elisabeth von Hessen-Kassel die Rezepte aus dem Hessischen Land-
grafenhaus beigesteuert haben könnte. Die Apothekenverzeichnisse weisen jedoch eher auf Kaiserslautern, wo
Elisabeth von Pfalz-Lautern eine Apotheke unterhielt. Auf dem heute verlorenen Kopert las Wille, S. 78, noch
die Capsanummer C. 118.
Schreibsprache: hochdeutsch mit oberdeutschen (bairischen?) Formen.
Literatur: Wille, S. 78; nicht bei Wilken; Digitalisat: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/cpg548.
1 r—61 v ANONYME MEDIZINISCHE REZEPTSAMMLUNG (ungeordnet; 101
Rezepte, 7 Apothekenverzeichnisse und 1 Baderegimen). >Artznei buch mit einem
Register Auß Zettelnn vnnd brieffen vonn mangen gelerttenn doctoribus vnnd ertzenn [!]
der medicienn etc. Anno dommini [!] etc. 1572 etc.<.
Als Rezeptzuträger, Probanden oder Gewährsleute werden genannt: der alte Hunnecker
(l v); Kurfürst August von Sachsen (2 r); Gräfin von Hanau (3 V); Fräulein von Schwar-
zenberg sel. (3 V); Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz (4 r); Magister/Meister Paulus (4 r,
52 v); Landgräfin (7 r, 17 v, 30 v, 33 r, 50 v); die von Königstein (8 V); Kurfürstin [Anna?] von
Sachsen (13 r); Hofmeisterin der Gräfin von Hanau (15 r); Landgräfin Sabine (von Würt-
temberg) von Hessen (24 r); Landgraf Wilhelm IV. von Hessen (24 r); Magister Hug
Kindgenn (?) (25 r); die junge Stumpfin (25 v); der Kanzler (26 r, 56 v); ein gertnenn megtlein
(27 v); Dr. Erhard/Eckhart (28 v, 51 r, 52 r); die Mutter der Haushofmeisterin (28 v); die von
Falkenstein (30 v); Dr. Johannes Lange (37 v, 47 v); Gräfin von Erbach (39 v); der Prädikant
(39 v); Fürst (42 r); Fürstin (44 v); Kurfürst Philipp von der Pfalz (51 r); die alte Klingelbergin
zu Katzenelnbogen (53 r); Gräfin von Sayn (53 v); Landgraf Philipp d.J. von Hessen (55 r);
Levi zu Kassel (55 r, 56 r).
Erwähnte Orte: Freiberg und Marienberg (3 r).
Datiertes Rezept: 10. November [15]77 (55 r).
121