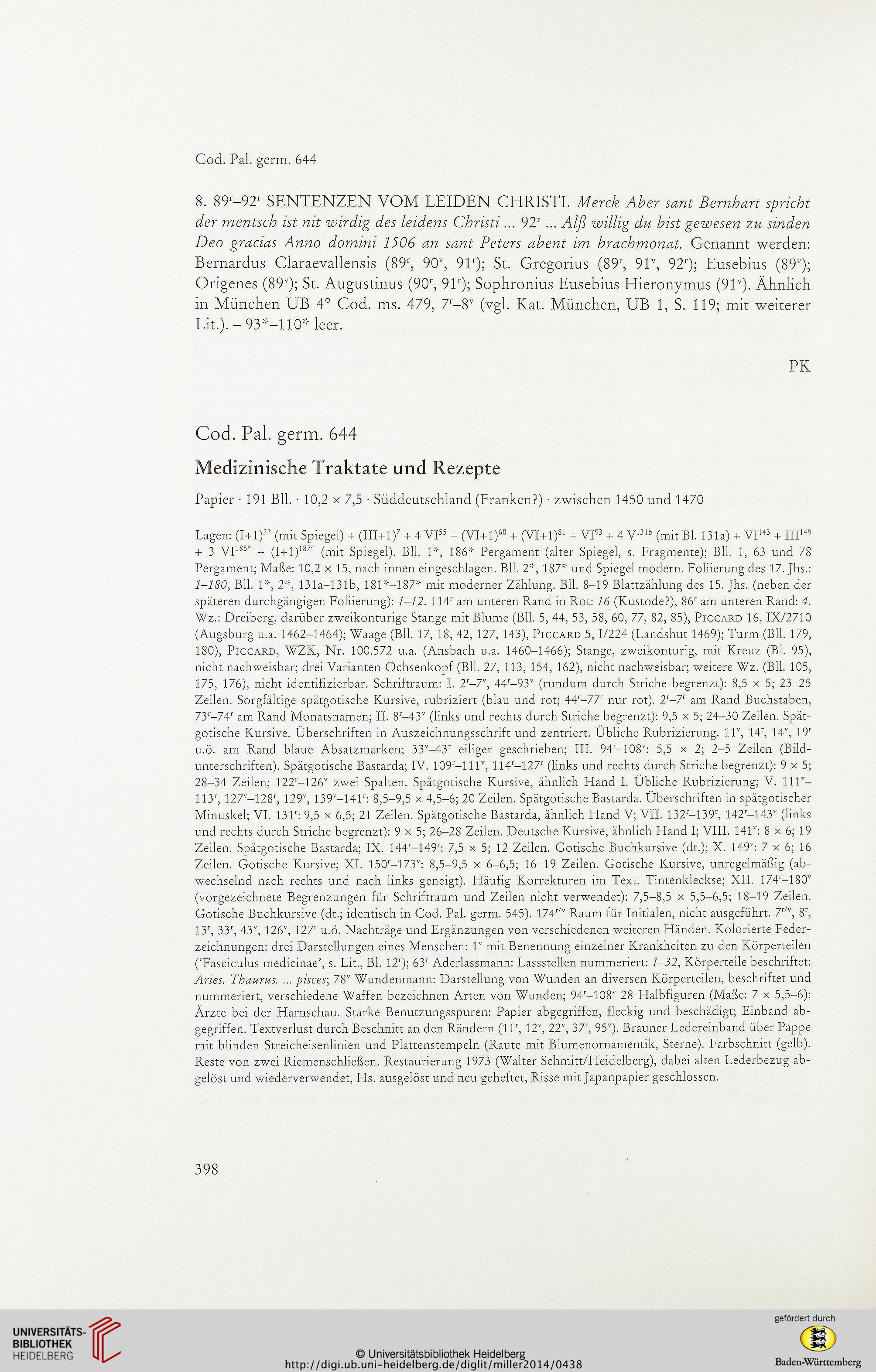Cod. Pal. eerm. 644
8. 89 r—92 1 SENTENZEN VOM LEIDEN CHRISTI. Merck Aber sant Bernhart spricht
der mentsch ist nit wirdig des leidens Christi... 92 r... Alfl willig du bist gewesen zu sinden
Deo gracias Anno domini 1506 an sant Peters abent im brachmonat. Genannt werden:
Bernardus Claraevallensis (89 r, 90 v, 91 r); St. Gregorius (89 r, 91 v, 92 r); Eusebius (89 v);
Origenes (89 v); St. Augustinus (90 r, 91 r); Sophronius Eusebius Hieronymus (91 v). Ähnlich
in München UB 4° Cod. ms. 479, 7 r-8 v (vgl. Kat. München, UB 1, S. 119; mit weiterer
Lit.). - 93' :'—110' :' leer.
PK
Cod. Pal. germ. 644
Medizinische Traktate und Rezepte
Papier • 191 Bll. • 10,2 x 7,5 ■ Süddeutschland (Franken?) ■ zwischen 1450 und 1470
Lagen: (I+l) 2" (mit Spiegel) + (III+l) 7 + 4 VI 55 + (VI+1) 68 + (VI+1) 81 + VI 93 + 4 V 131b (mit Bl. 131a) + VI 143 + III’ 49
+ 3 VI 185' + (I+l) 187' (mit Spiegel). Bll. 1“", 186“’ Pergament (alter Spiegel, s. Fragmente); Bll. 1, 63 und 78
Pergament; Maße: 10,2 x 15, nach innen eingeschlagen. Bll. 2' -, 187"' und Spiegel modern. Foliierung des 17. Jhs.:
1-180, Bll. 1 ;:‘, 2 ;:‘, 131 a— 131b, 181 ;:"-187 ;:' mit moderner Zählung. Bll. 8-19 Blattzählung des 15. Jhs. (neben der
späteren durchgängigen Foliierung): 1-12. 114 r am unteren Rand in Rot: 16 (Kustode?), 86 r am unteren Rand: 4.
Wz.: Dreiberg, darüber zweikonturige Stange mit Blume (Bll. 5, 44, 53, 58, 60, 77, 82, 85), Piccard 16, IX/2710
(Augsburg u.a. 1462-1464); Waage (Bll. 17, 18, 42, 127, 143), Piccard 5, 1/224 (Landshut 1469); Turm (Bll. 179,
180), Piccard, WZK, Nr. 100.572 u.a. (Ansbach u.a. 1460-1466); Stange, zweikonturig, mit Kreuz (Bl. 95),
nicht nachweisbar; drei Varianten Ochsenkopf (Bll. 27, 113, 154, 162), nicht nachweisbar; weitere Wz. (Bll. 105,
175, 176), nicht ldentifizierbar. Schriftraum: I. 2 r-7 v, 44 r-93 v (rundum durch Striche begrenzt): 8,5 x 5; 23-25
Zeilen. Sorgfältige spätgotische Kursive, rubriziert (blau und rot; 44 r-77 r nur rot). 2 r-7 r am Rand Buchstaben,
73 r-74 r am Rand Monatsnamen; II. 8 r-43 v (links und rechts durch Striche begrenzt): 9,5 x 5; 24-30 Zeilen. Spät-
gotische Kursive. Uberschriften in Auszeichnungsschrift und zentriert. Übliche Rubrizieinmg. ll v, 14 r, 14 v, 19 r
u.ö. am Rand blaue Absatzmarken; 33 v-43 r eiliger geschrieben; III. 94 r-108 v: 5,5 x 2; 2-5 Zeilen (Bild-
unterschriften). Spätgotische Bastarda; IV. 109 r—11 l v, 114 r—127 r (links und rechts durch Striche begrenzt): 9x5;
28-34 Zeilen; 122 r-126 v zwei Spalten. Spätgotische Kursive, ähnlich Fland I. Übliche Rubrizierung; V. 11 l v—
113 r, 127 v—12S r, 129 v, 139 v—141 r: 8,5-9,5 x 4,5-6; 20 Zeilen. Spätgotische Bastarda. Überschriften in spätgotischer
Minuskel; VI. 131 1: 9,5 x 6,5; 21 Zeilen. Spätgotische Bastarda, ähnlich Hand V; VII. 132 r—139 r, 142 r—143 v (links
und rechts durch Striche begrenzt): 9x5; 26-28 Zeilen. Deutsche Kursive, ähnhch Hand I; VIII. 141 v: 8 x 6; 19
Zeilen. Spätgotische Bastarda; IX. 144 r—149 r: 7,5 x 5; 12 Zeilen. Gotische Buchkursive (dt.); X. 149 v: 7 x 6; 16
Zeilen. Gotische Kursive; XI. 150 r—173 v: 8,5-9,5 x 6-6,5; 16-19 Zeilen. Gotische Kursive, unregelmäßig (ab-
wechselnd nach rechts und nach links geneigt). Häufig Korrekturen im Text. Tintenkleckse; XII. 174—180 v
(vorgezeichnete Begrenzungen fiir Schriftraum und Zeilen nicht verwendet): 7,5-8,5 x 5,5-6,5; 18-19 Zeilen.
Gotische Buchkursive (dt.; ldentisch in Cod. Pal. germ. 545). 174 r/v Raum für Initialen, nicht ausgeführt. 7 r/v, 8 r,
13 r, 33 r, 43 v, 126 v, 127 r u.ö. Nachträge und Ergänzungen von verschiedenen weiteren Händen. Kolorierte Feder-
zeichnungen: drei Darstellungen eines Menschen: l v mit Benennung einzelner Krankheiten zu den Körperteilen
(‘Fasciculus medicinae’, s. Lit., Bl. 12 r); 63 r Aderlassmann: Lassstellen nummeriert: 1-32, Körperteile beschriftet:
Aries. Thaurus. ... pisces', 78 v Wundenmann: Darstellung von Wunden an diversen Körperteilen, beschriftet und
nummeriert, verschiedene Waffen bezeichnen Arten von Wunden; 94 r-108 v 28 Halbfiguren (Maße: 7 x 5,5-6):
Ärzte bei der Harnschau. Starke Benutzungsspuren: Papier abgegriffen, fleckig und beschädigt; Einband ab-
gegriffen. Textverlust durch Beschnitt an den Rändern (11 r, 12 v, 22 v, 37 r, 95 v). Brauner Ledereinband über Pappe
mit blinden Streicheisenlinien und Plattenstempeln (Raute mit Blumenornamentik, Sterne). Farbschnitt (gelb).
Reste von zwei Riemenschließen. Restaurierung 1973 (Walter Schmitt/Heidelberg), dabei alten Lederbezug ab-
gelöst und wiederverwendet, Hs. ausgelöst und neu geheftet, Risse mit Japanpapier geschlossen.
398
8. 89 r—92 1 SENTENZEN VOM LEIDEN CHRISTI. Merck Aber sant Bernhart spricht
der mentsch ist nit wirdig des leidens Christi... 92 r... Alfl willig du bist gewesen zu sinden
Deo gracias Anno domini 1506 an sant Peters abent im brachmonat. Genannt werden:
Bernardus Claraevallensis (89 r, 90 v, 91 r); St. Gregorius (89 r, 91 v, 92 r); Eusebius (89 v);
Origenes (89 v); St. Augustinus (90 r, 91 r); Sophronius Eusebius Hieronymus (91 v). Ähnlich
in München UB 4° Cod. ms. 479, 7 r-8 v (vgl. Kat. München, UB 1, S. 119; mit weiterer
Lit.). - 93' :'—110' :' leer.
PK
Cod. Pal. germ. 644
Medizinische Traktate und Rezepte
Papier • 191 Bll. • 10,2 x 7,5 ■ Süddeutschland (Franken?) ■ zwischen 1450 und 1470
Lagen: (I+l) 2" (mit Spiegel) + (III+l) 7 + 4 VI 55 + (VI+1) 68 + (VI+1) 81 + VI 93 + 4 V 131b (mit Bl. 131a) + VI 143 + III’ 49
+ 3 VI 185' + (I+l) 187' (mit Spiegel). Bll. 1“", 186“’ Pergament (alter Spiegel, s. Fragmente); Bll. 1, 63 und 78
Pergament; Maße: 10,2 x 15, nach innen eingeschlagen. Bll. 2' -, 187"' und Spiegel modern. Foliierung des 17. Jhs.:
1-180, Bll. 1 ;:‘, 2 ;:‘, 131 a— 131b, 181 ;:"-187 ;:' mit moderner Zählung. Bll. 8-19 Blattzählung des 15. Jhs. (neben der
späteren durchgängigen Foliierung): 1-12. 114 r am unteren Rand in Rot: 16 (Kustode?), 86 r am unteren Rand: 4.
Wz.: Dreiberg, darüber zweikonturige Stange mit Blume (Bll. 5, 44, 53, 58, 60, 77, 82, 85), Piccard 16, IX/2710
(Augsburg u.a. 1462-1464); Waage (Bll. 17, 18, 42, 127, 143), Piccard 5, 1/224 (Landshut 1469); Turm (Bll. 179,
180), Piccard, WZK, Nr. 100.572 u.a. (Ansbach u.a. 1460-1466); Stange, zweikonturig, mit Kreuz (Bl. 95),
nicht nachweisbar; drei Varianten Ochsenkopf (Bll. 27, 113, 154, 162), nicht nachweisbar; weitere Wz. (Bll. 105,
175, 176), nicht ldentifizierbar. Schriftraum: I. 2 r-7 v, 44 r-93 v (rundum durch Striche begrenzt): 8,5 x 5; 23-25
Zeilen. Sorgfältige spätgotische Kursive, rubriziert (blau und rot; 44 r-77 r nur rot). 2 r-7 r am Rand Buchstaben,
73 r-74 r am Rand Monatsnamen; II. 8 r-43 v (links und rechts durch Striche begrenzt): 9,5 x 5; 24-30 Zeilen. Spät-
gotische Kursive. Uberschriften in Auszeichnungsschrift und zentriert. Übliche Rubrizieinmg. ll v, 14 r, 14 v, 19 r
u.ö. am Rand blaue Absatzmarken; 33 v-43 r eiliger geschrieben; III. 94 r-108 v: 5,5 x 2; 2-5 Zeilen (Bild-
unterschriften). Spätgotische Bastarda; IV. 109 r—11 l v, 114 r—127 r (links und rechts durch Striche begrenzt): 9x5;
28-34 Zeilen; 122 r-126 v zwei Spalten. Spätgotische Kursive, ähnlich Fland I. Übliche Rubrizierung; V. 11 l v—
113 r, 127 v—12S r, 129 v, 139 v—141 r: 8,5-9,5 x 4,5-6; 20 Zeilen. Spätgotische Bastarda. Überschriften in spätgotischer
Minuskel; VI. 131 1: 9,5 x 6,5; 21 Zeilen. Spätgotische Bastarda, ähnlich Hand V; VII. 132 r—139 r, 142 r—143 v (links
und rechts durch Striche begrenzt): 9x5; 26-28 Zeilen. Deutsche Kursive, ähnhch Hand I; VIII. 141 v: 8 x 6; 19
Zeilen. Spätgotische Bastarda; IX. 144 r—149 r: 7,5 x 5; 12 Zeilen. Gotische Buchkursive (dt.); X. 149 v: 7 x 6; 16
Zeilen. Gotische Kursive; XI. 150 r—173 v: 8,5-9,5 x 6-6,5; 16-19 Zeilen. Gotische Kursive, unregelmäßig (ab-
wechselnd nach rechts und nach links geneigt). Häufig Korrekturen im Text. Tintenkleckse; XII. 174—180 v
(vorgezeichnete Begrenzungen fiir Schriftraum und Zeilen nicht verwendet): 7,5-8,5 x 5,5-6,5; 18-19 Zeilen.
Gotische Buchkursive (dt.; ldentisch in Cod. Pal. germ. 545). 174 r/v Raum für Initialen, nicht ausgeführt. 7 r/v, 8 r,
13 r, 33 r, 43 v, 126 v, 127 r u.ö. Nachträge und Ergänzungen von verschiedenen weiteren Händen. Kolorierte Feder-
zeichnungen: drei Darstellungen eines Menschen: l v mit Benennung einzelner Krankheiten zu den Körperteilen
(‘Fasciculus medicinae’, s. Lit., Bl. 12 r); 63 r Aderlassmann: Lassstellen nummeriert: 1-32, Körperteile beschriftet:
Aries. Thaurus. ... pisces', 78 v Wundenmann: Darstellung von Wunden an diversen Körperteilen, beschriftet und
nummeriert, verschiedene Waffen bezeichnen Arten von Wunden; 94 r-108 v 28 Halbfiguren (Maße: 7 x 5,5-6):
Ärzte bei der Harnschau. Starke Benutzungsspuren: Papier abgegriffen, fleckig und beschädigt; Einband ab-
gegriffen. Textverlust durch Beschnitt an den Rändern (11 r, 12 v, 22 v, 37 r, 95 v). Brauner Ledereinband über Pappe
mit blinden Streicheisenlinien und Plattenstempeln (Raute mit Blumenornamentik, Sterne). Farbschnitt (gelb).
Reste von zwei Riemenschließen. Restaurierung 1973 (Walter Schmitt/Heidelberg), dabei alten Lederbezug ab-
gelöst und wiederverwendet, Hs. ausgelöst und neu geheftet, Risse mit Japanpapier geschlossen.
398