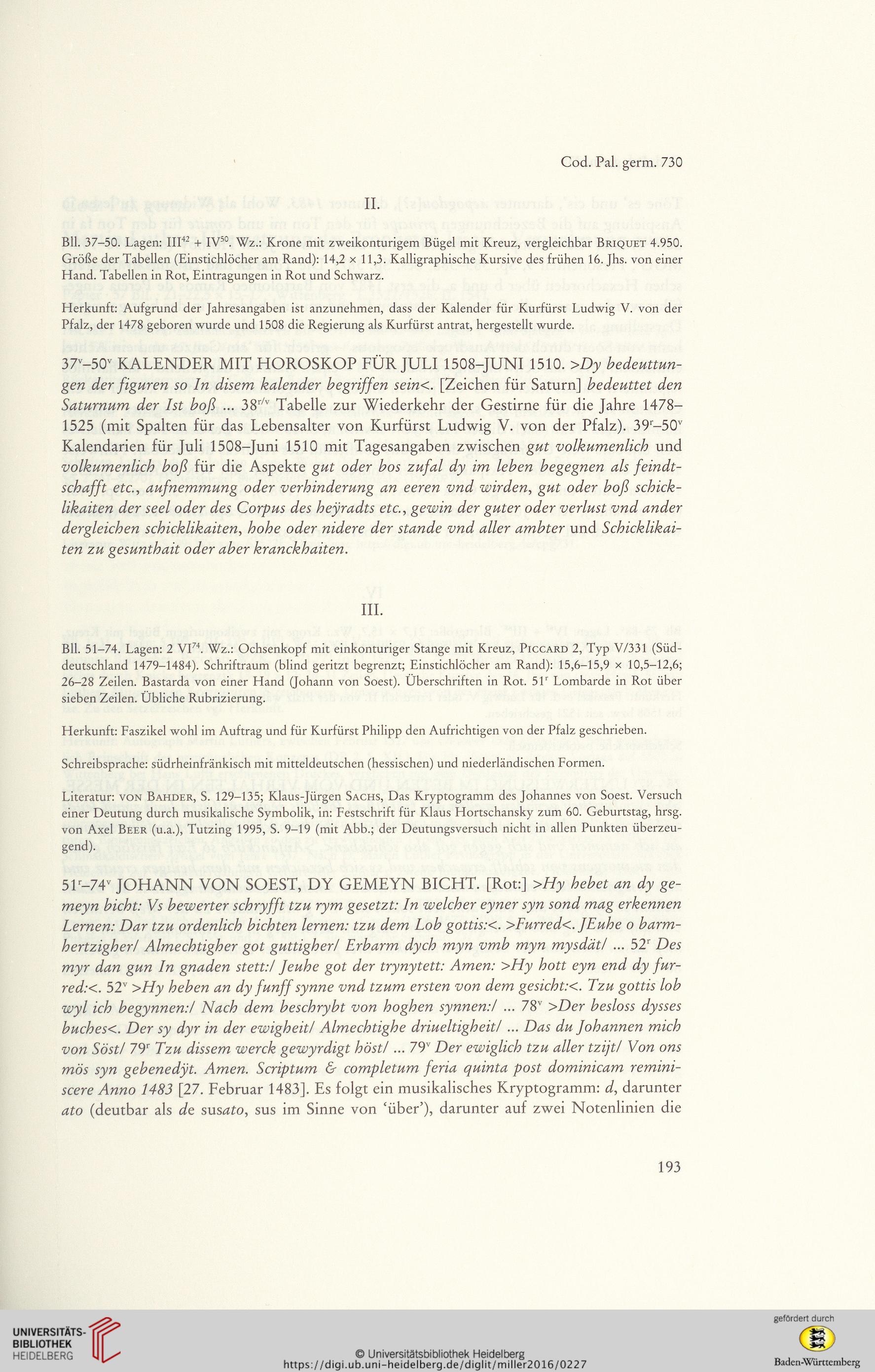Cod. Pal. germ. 730
II.
Bll. 37-50. Lagen: III42 + IV’0. Wz.: Krone mit zweikonturigem Bügel mit Kreuz, vergleichbar Briquet 4.950.
Größe der Tabellen (Einstichlöcher am Rand): 14,2 x 11,3. Kalligraphische Kursive des frühen 16. Jhs. von einer
Hand. Tabellen in Rot, Eintragungen in Rot und Schwarz.
Herkunft: Aufgrund der Jahresangaben ist anzunehmen, dass der Kalender für Kurfürst Ludwig V. von der
Pfalz, der 1478 geboren wurde und 1508 die Regierung als Kurfürst antrat, hergestellt wurde.
37v-50v KALENDER MIT HOROSKOP FÜR JULI 1508-JUNI 1510. >Dy bedeuttun-
gen der figuren so In disem kalender begriffen sein<. [Zeichen für Saturn] bedeuttet den
Saturnum der Ist boß ... 38r/v Tabelle zur Wiederkehr der Gestirne für die Jahre 1478—
1525 (mit Spalten für das Lebensalter von Kurfürst Ludwig V. von der Pfalz). 39r-50v
Kalendarien für Juli 1508-Juni 1510 mit Tagesangaben zwischen gut volkumenlich und
volkumenlich boß für die Aspekte gut oder bos zufal dy im leben begegnen als feindt-
schafft etc., aufnemmung oder Verhinderung an eeren vnd wir den, gut oder boß schick-
likaiten der seel oder des Corpus des heyradts etc., gewin der guter oder Verlust vnd ander
dergleichen schicklikaiten, hohe oder nidere der stände vnd aller ambter und Schicklikai-
ten zu gesunthait oder aber kranckhaiten.
III.
Bll. 51-74. Lagen: 2 VI74. Wz.: Ochsenkopf mit einkonturiger Stange mit Kreuz, Piccard 2, Typ V/331 (Süd-
deutschland 1479-1484). Schriftraum (blind geritzt begrenzt; Einstichlöcher am Rand): 15,6-15,9 x 10,5-12,6;
26-28 Zeilen. Bastarda von einer Hand (Johann von Soest). Überschriften in Rot. 51r Lombarde in Rot über
sieben Zeilen. Übliche Rubrizierung.
Herkunft: Faszikel wohl im Auftrag und für Kurfürst Philipp den Aufrichtigen von der Pfalz geschrieben.
Schreibsprache: südrheinfränkisch mit mitteldeutschen (hessischen) und niederländischen Formen.
Literatur: von Bahder, S. 129-135; Klaus-Jürgen Sachs, Das Kryptogramm des Johannes von Soest. Versuch
einer Deutung durch musikalische Symbolik, in: Festschrift für Klaus Hortschansky zum 60. Geburtstag, hrsg.
von Axel Beer (u.a.), Tutzing 1995, S. 9-19 (mit Abb.; der Deutungsversuch nicht in allen Punkten überzeu-
gend).
51r-74v JOHANN VON SOEST, DY GEMEYN BICHT. [Rot:] >Hy hebet an dy ge-
meyn bicht: Vs bewerter schryfft tzu rym gesetzt: In welcher eyner syn sond mag erkennen
Lernen: Dar tzu ordenlich bichten lernen: tzu dem Lob gottis:<. >Furred<. JEuhe o barm-
hertzigher/ Almechtigher got guttigherl Erbarm dych myn vmb myn mysdät/ ... 52r Des
myr dan gun In gnaden stett:/ Jeuhe got der trynytett: Amen: >Hy hott eyn end dy fur-
red:<. 52v >Hy heben an dy fünff synne vnd tzum ersten von dem gesicht:<. Tzu gottis lob
wyl ich begynnen:/ Nach dem beschrybt von hoghen synnen:/ ... 78v >Der besloss dysses
buches<. Der sy dyr in der ewigheit/ Almechtighe driueltigheit/ ... Das du Johannen mich
von Söst/ 7T Tzu dissem werck gewyrdigt höst/ ... 79v Der ewiglich tzu aller tzijt/ Von ons
mös syn gebenedyt. Amen. Scriptum & completum feria quinta post dominicam remini-
scere Anno 1483 [27. Februar 1483]. Es folgt ein musikalisches Kryptogramm: d, darunter
ato (deutbar als de susato, sus im Sinne von ‘über’), darunter auf zwei Notenlinien die
193
II.
Bll. 37-50. Lagen: III42 + IV’0. Wz.: Krone mit zweikonturigem Bügel mit Kreuz, vergleichbar Briquet 4.950.
Größe der Tabellen (Einstichlöcher am Rand): 14,2 x 11,3. Kalligraphische Kursive des frühen 16. Jhs. von einer
Hand. Tabellen in Rot, Eintragungen in Rot und Schwarz.
Herkunft: Aufgrund der Jahresangaben ist anzunehmen, dass der Kalender für Kurfürst Ludwig V. von der
Pfalz, der 1478 geboren wurde und 1508 die Regierung als Kurfürst antrat, hergestellt wurde.
37v-50v KALENDER MIT HOROSKOP FÜR JULI 1508-JUNI 1510. >Dy bedeuttun-
gen der figuren so In disem kalender begriffen sein<. [Zeichen für Saturn] bedeuttet den
Saturnum der Ist boß ... 38r/v Tabelle zur Wiederkehr der Gestirne für die Jahre 1478—
1525 (mit Spalten für das Lebensalter von Kurfürst Ludwig V. von der Pfalz). 39r-50v
Kalendarien für Juli 1508-Juni 1510 mit Tagesangaben zwischen gut volkumenlich und
volkumenlich boß für die Aspekte gut oder bos zufal dy im leben begegnen als feindt-
schafft etc., aufnemmung oder Verhinderung an eeren vnd wir den, gut oder boß schick-
likaiten der seel oder des Corpus des heyradts etc., gewin der guter oder Verlust vnd ander
dergleichen schicklikaiten, hohe oder nidere der stände vnd aller ambter und Schicklikai-
ten zu gesunthait oder aber kranckhaiten.
III.
Bll. 51-74. Lagen: 2 VI74. Wz.: Ochsenkopf mit einkonturiger Stange mit Kreuz, Piccard 2, Typ V/331 (Süd-
deutschland 1479-1484). Schriftraum (blind geritzt begrenzt; Einstichlöcher am Rand): 15,6-15,9 x 10,5-12,6;
26-28 Zeilen. Bastarda von einer Hand (Johann von Soest). Überschriften in Rot. 51r Lombarde in Rot über
sieben Zeilen. Übliche Rubrizierung.
Herkunft: Faszikel wohl im Auftrag und für Kurfürst Philipp den Aufrichtigen von der Pfalz geschrieben.
Schreibsprache: südrheinfränkisch mit mitteldeutschen (hessischen) und niederländischen Formen.
Literatur: von Bahder, S. 129-135; Klaus-Jürgen Sachs, Das Kryptogramm des Johannes von Soest. Versuch
einer Deutung durch musikalische Symbolik, in: Festschrift für Klaus Hortschansky zum 60. Geburtstag, hrsg.
von Axel Beer (u.a.), Tutzing 1995, S. 9-19 (mit Abb.; der Deutungsversuch nicht in allen Punkten überzeu-
gend).
51r-74v JOHANN VON SOEST, DY GEMEYN BICHT. [Rot:] >Hy hebet an dy ge-
meyn bicht: Vs bewerter schryfft tzu rym gesetzt: In welcher eyner syn sond mag erkennen
Lernen: Dar tzu ordenlich bichten lernen: tzu dem Lob gottis:<. >Furred<. JEuhe o barm-
hertzigher/ Almechtigher got guttigherl Erbarm dych myn vmb myn mysdät/ ... 52r Des
myr dan gun In gnaden stett:/ Jeuhe got der trynytett: Amen: >Hy hott eyn end dy fur-
red:<. 52v >Hy heben an dy fünff synne vnd tzum ersten von dem gesicht:<. Tzu gottis lob
wyl ich begynnen:/ Nach dem beschrybt von hoghen synnen:/ ... 78v >Der besloss dysses
buches<. Der sy dyr in der ewigheit/ Almechtighe driueltigheit/ ... Das du Johannen mich
von Söst/ 7T Tzu dissem werck gewyrdigt höst/ ... 79v Der ewiglich tzu aller tzijt/ Von ons
mös syn gebenedyt. Amen. Scriptum & completum feria quinta post dominicam remini-
scere Anno 1483 [27. Februar 1483]. Es folgt ein musikalisches Kryptogramm: d, darunter
ato (deutbar als de susato, sus im Sinne von ‘über’), darunter auf zwei Notenlinien die
193