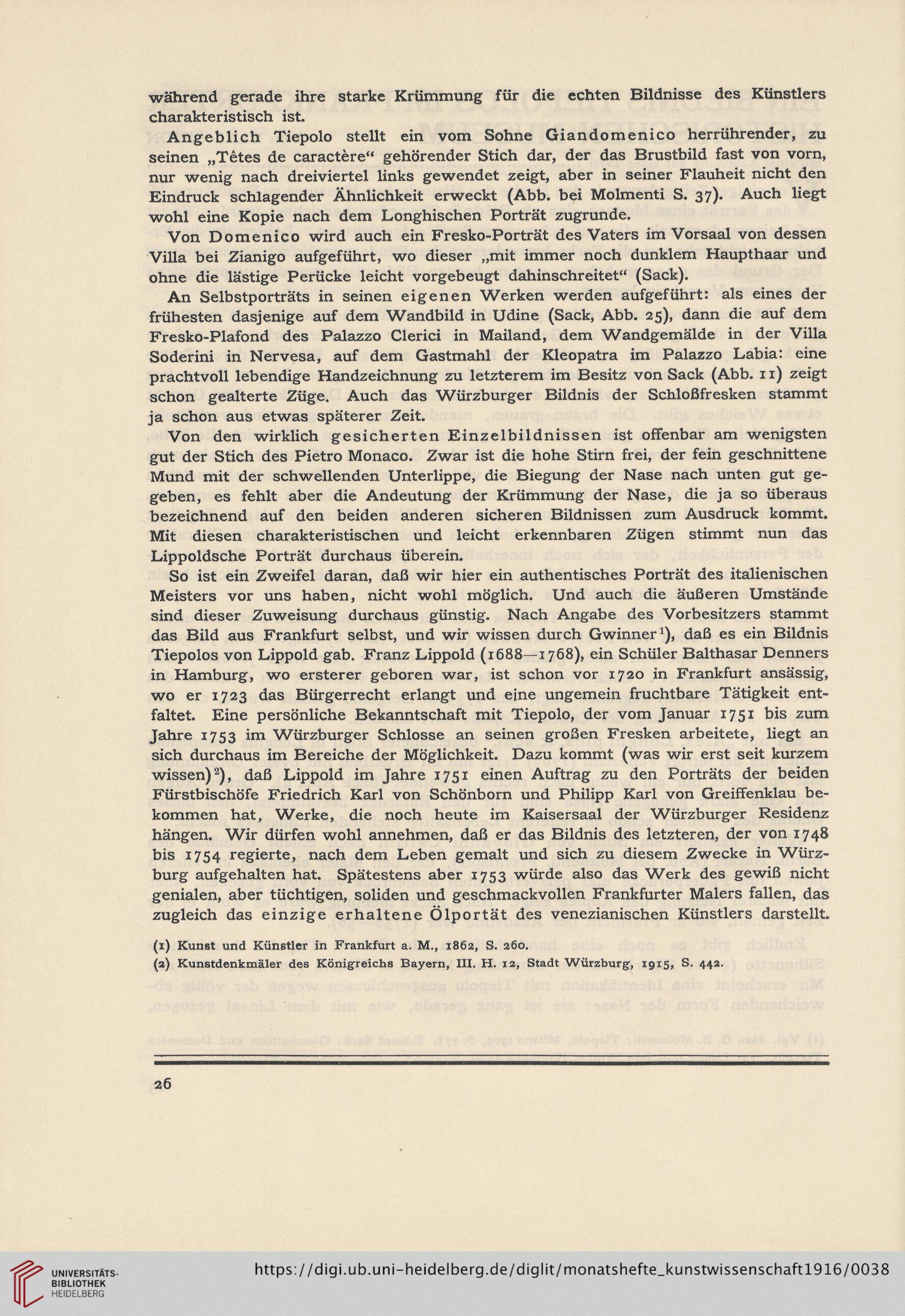während gerade ihre starke Krümmung für die echten Bildnisse des Künstlers
charakteristisch ist.
Angeblich Tiepolo stellt ein vom Sohne Giandomenico herrührender, zu
seinen „Tetes de caractere“ gehörender Stich dar, der das Brustbild fast von vorn,
nur wenig nach dreiviertel links gewendet zeigt, aber in seiner Flauheit nicht den
Eindruck schlagender Ähnlichkeit erweckt (Abb. bei Molmenti S. 37). Auch liegt
wohl eine Kopie nach dem Longhischen Porträt zugrunde.
Von Domenico wird auch ein Fresko-Porträt des Vaters im Vorsaal von dessen
Villa bei Zianigo aufgeführt, wo dieser „mit immer noch dunklem Haupthaar und
ohne die lästige Perücke leicht vorgebeugt dahinschreitet“ (Sack).
An Selbstporträts in seinen eigenen Werken werden aufgeführt: als eines der
frühesten dasjenige auf dem Wandbild in Udine (Sack, Abb. 25), dann die auf dem
Fresko-Plafond des Palazzo Clerici in Mailand, dem Wandgemälde in der Villa
Soderini in Nervesa, auf dem Gastmahl der Kleopatra im Palazzo Labia: eine
prachtvoll lebendige Handzeichnung zu letzterem im Besitz von Sack (Abb. 11) zeigt
schon gealterte Züge. Auch das Würzburger Bildnis der Schloßfresken stammt
ja schon aus etwas späterer Zeit.
Von den wirklich gesicherten Einzelbildnissen ist offenbar am wenigsten
gut der Stich des Pietro Monaco. Zwar ist die hohe Stirn frei, der fein geschnittene
Mund mit der schwellenden Unterlippe, die Biegung der Nase nach unten gut ge-
geben, es fehlt aber die Andeutung der Krümmung der Nase, die ja so überaus
bezeichnend auf den beiden anderen sicheren Bildnissen zum Ausdruck kommt.
Mit diesen charakteristischen und leicht erkennbaren Zügen stimmt nun das
Lippoldsche Porträt durchaus überein.
So ist ein Zweifel daran, daß wir hier ein authentisches Porträt des italienischen
Meisters vor uns haben, nicht wohl möglich. Und auch die äußeren Umstände
sind dieser Zuweisung durchaus günstig. Nach Angabe des Vorbesitzers stammt
das Bild aus Frankfurt selbst, und wir wissen durch Gwinner1), daß es ein Bildnis
Tiepolos von Lippold gab. Franz Lippold (1688—1768), ein Schüler Balthasar Denners
in Hamburg, wo ersterer geboren war, ist schon vor 1720 in Frankfurt ansässig,
wo er 1723 das Bürgerrecht erlangt und eine ungemein fruchtbare Tätigkeit ent-
faltet. Eine persönliche Bekanntschaft mit Tiepolo, der vom Januar 1751 bis zum
Jahre 1753 im Würzburger Schlosse an seinen großen Fresken arbeitete, liegt an
sich durchaus im Bereiche der Möglichkeit. Dazu kommt (was wir erst seit kurzem
wissen)2), daß Lippold im Jahre 1751 einen Auftrag zu den Porträts der beiden
Fürstbischöfe Friedrich Karl von Schönborn und Philipp Karl von Greiffenklau be-
kommen hat, Werke, die noch heute im Kaisersaal der Würzburger Residenz
hängen. Wir dürfen wohl annehmen, daß er das Bildnis des letzteren, der von 1748
bis 1754 regierte, nach dem Leben gemalt und sich zu diesem Zwecke in Würz-
burg aufgehalten hat. Spätestens aber 1753 würde also das Werk des gewiß nicht
genialen, aber tüchtigen, soliden und geschmackvollen Frankfurter Malers fallen, das
zugleich das einzige erhaltene Ölportät des venezianischen Künstlers darstellt.
(1) Kunst und Künstler in Frankfurt a. Μ., 1862, S. 260.
(2) Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern, III. H. 12, Stadt Würzburg, 1915, S. 442.
26
charakteristisch ist.
Angeblich Tiepolo stellt ein vom Sohne Giandomenico herrührender, zu
seinen „Tetes de caractere“ gehörender Stich dar, der das Brustbild fast von vorn,
nur wenig nach dreiviertel links gewendet zeigt, aber in seiner Flauheit nicht den
Eindruck schlagender Ähnlichkeit erweckt (Abb. bei Molmenti S. 37). Auch liegt
wohl eine Kopie nach dem Longhischen Porträt zugrunde.
Von Domenico wird auch ein Fresko-Porträt des Vaters im Vorsaal von dessen
Villa bei Zianigo aufgeführt, wo dieser „mit immer noch dunklem Haupthaar und
ohne die lästige Perücke leicht vorgebeugt dahinschreitet“ (Sack).
An Selbstporträts in seinen eigenen Werken werden aufgeführt: als eines der
frühesten dasjenige auf dem Wandbild in Udine (Sack, Abb. 25), dann die auf dem
Fresko-Plafond des Palazzo Clerici in Mailand, dem Wandgemälde in der Villa
Soderini in Nervesa, auf dem Gastmahl der Kleopatra im Palazzo Labia: eine
prachtvoll lebendige Handzeichnung zu letzterem im Besitz von Sack (Abb. 11) zeigt
schon gealterte Züge. Auch das Würzburger Bildnis der Schloßfresken stammt
ja schon aus etwas späterer Zeit.
Von den wirklich gesicherten Einzelbildnissen ist offenbar am wenigsten
gut der Stich des Pietro Monaco. Zwar ist die hohe Stirn frei, der fein geschnittene
Mund mit der schwellenden Unterlippe, die Biegung der Nase nach unten gut ge-
geben, es fehlt aber die Andeutung der Krümmung der Nase, die ja so überaus
bezeichnend auf den beiden anderen sicheren Bildnissen zum Ausdruck kommt.
Mit diesen charakteristischen und leicht erkennbaren Zügen stimmt nun das
Lippoldsche Porträt durchaus überein.
So ist ein Zweifel daran, daß wir hier ein authentisches Porträt des italienischen
Meisters vor uns haben, nicht wohl möglich. Und auch die äußeren Umstände
sind dieser Zuweisung durchaus günstig. Nach Angabe des Vorbesitzers stammt
das Bild aus Frankfurt selbst, und wir wissen durch Gwinner1), daß es ein Bildnis
Tiepolos von Lippold gab. Franz Lippold (1688—1768), ein Schüler Balthasar Denners
in Hamburg, wo ersterer geboren war, ist schon vor 1720 in Frankfurt ansässig,
wo er 1723 das Bürgerrecht erlangt und eine ungemein fruchtbare Tätigkeit ent-
faltet. Eine persönliche Bekanntschaft mit Tiepolo, der vom Januar 1751 bis zum
Jahre 1753 im Würzburger Schlosse an seinen großen Fresken arbeitete, liegt an
sich durchaus im Bereiche der Möglichkeit. Dazu kommt (was wir erst seit kurzem
wissen)2), daß Lippold im Jahre 1751 einen Auftrag zu den Porträts der beiden
Fürstbischöfe Friedrich Karl von Schönborn und Philipp Karl von Greiffenklau be-
kommen hat, Werke, die noch heute im Kaisersaal der Würzburger Residenz
hängen. Wir dürfen wohl annehmen, daß er das Bildnis des letzteren, der von 1748
bis 1754 regierte, nach dem Leben gemalt und sich zu diesem Zwecke in Würz-
burg aufgehalten hat. Spätestens aber 1753 würde also das Werk des gewiß nicht
genialen, aber tüchtigen, soliden und geschmackvollen Frankfurter Malers fallen, das
zugleich das einzige erhaltene Ölportät des venezianischen Künstlers darstellt.
(1) Kunst und Künstler in Frankfurt a. Μ., 1862, S. 260.
(2) Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern, III. H. 12, Stadt Würzburg, 1915, S. 442.
26