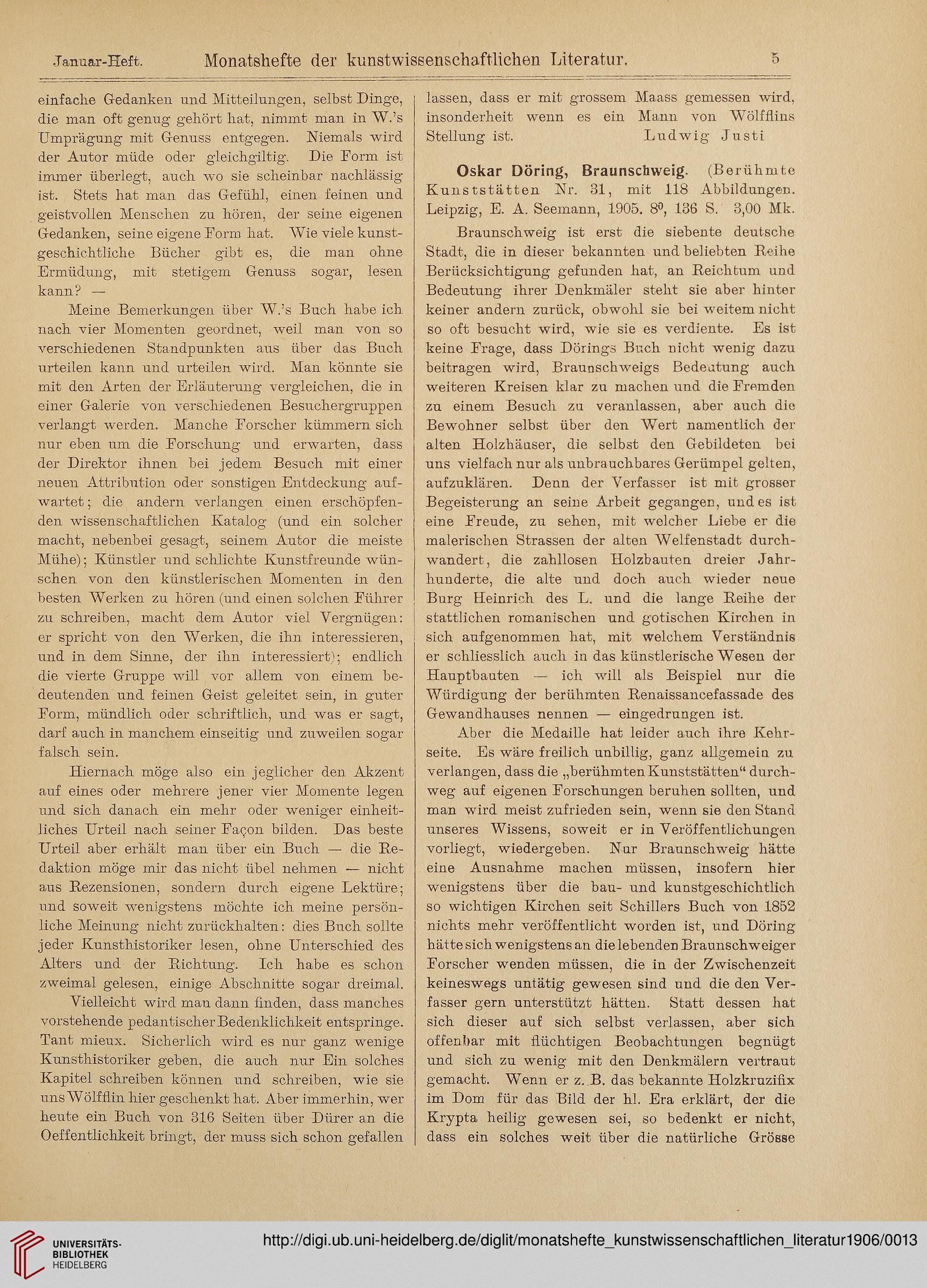Januar-Heft.
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
einfache Gedanken und Mitteilungen, selbst Dinge,
die man oft genug gehört hat, nimmt man in W.’s
Umprägung mit Genuss entgegen. Niemals wird
der Autor müde oder gleichgiltig. Die Form ist
immer überlegt, auch wo sie scheinbar nachlässig
ist. Stets hat man das Gefühl, einen feinen und
geistvollen Menschen zu hören, der seine eigenen
Gedanken, seine eigene Form hat. Wie viele kunst-
geschichtliche Bücher gibt es, die man ohne
Ermüdung, mit stetigem Genuss sogar, lesen
kann? —
Meine Bemerkungen über W.’s Buch habe ich
nach vier Momenten geordnet, weil man von so
verschiedenen Standpunkten aus über das Buch
urteilen kann und urteilen wird. Man könnte sie
mit den Arten der Erläuterung vergleichen, die in
einer Galerie von verschiedenen Besuchergruppen
verlangt werden. Manche Forscher kümmern sich
nur eben um die Forschung und erwarten, dass
der Direktor ihnen bei jedem Besuch mit einer
neuen Attribution oder sonstigen Entdeckung auf-
wartet ; die andern verlangen einen erschöpfen-
den wissenschaftlichen Katalog (und ein solcher
macht, nebenbei gesagt, seinem Autor die meiste
Mühe); Künstler und schlichte Kunstfreunde wün-
schen von den künstlerischen Momenten in den
besten Werken zu hören (und einen solchen Führer
zu schreiben, macht dem Autor viel Vergnügen: I
er spricht von den Werken, die ihn interessieren,
und in dem Sinne, der ihn interessiert); endlich
die vierte Gruppe will vor allem von einem be-
deutenden und feinen Geist geleitet sein, in guter
Form, mündlich oder schriftlich, und was er sagt,
darf auch in manchem einseitig und zuweilen sogar
falsch sein.
Hiernach möge also ein jeglicher den Akzent
auf eines oder mehrere jener vier Momente legen
und sich danach ein mehr oder weniger einheit-
liches Urteil nach seiner Facon bilden. Das beste
Urteil aber erhält man über ein Buch — die Re-
daktion möge mir das nicht übel nehmen — nicht
aus Rezensionen, sondern durch eigene Lektüre;
und soweit wenigstens möchte ich meine persön-
liche Meinung nicht zurückhalten: dies Buch sollte
jeder Kunsthistoriker lesen, ohne Unterschied des
Alters und der Richtung. Ich habe es schon
zweimal gelesen, einige Abschnitte sogar dreimal.
Vielleicht wird man dann finden, dass manches
vorstehende pedantischer Bedenklichkeit entspringe.
Tant mieux. Sicherlich wird es nur ganz wenige
Kunsthistoriker geben, die auch nur Ein solches
Kapitel schreiben können und schreiben, wie sie
uns WölffLin hier geschenkt hat. Aber immerhin, wer
heute ein Buch von 316 Seiten über Dürer an die
Oeffentlichkeit bringt, der muss sich schon gefallen
lassen, dass er mit grossem Maass gemessen wird,
insonderheit wenn es ein Mann von Wölfflins
Stellung ist. Ludwig Justi
Oskar Döring, Braunschweig. (Berühmte
Kunststätten Nr. 31, mit 118 Abbildungen.
Leipzig, E. A. Seemann, 1905. 8°, 136 S. 3,00 Mk.
Braunschweig ist erst die siebente deutsche
Stadt, die in dieser bekannten und beliebten Reihe
Berücksichtigung gefunden hat, an Reichtum und
Bedeutung ihrer Denkmäler steht sie aber hinter
keiner andern zurück, obwohl sie bei weitem nicht
so oft besucht wird, wie sie es verdiente. Es ist
keine Frage, dass Dörings Buch nicht wenig dazu
beitragen wird, Braunschweigs Bedeutung auch
weiteren Kreisen klar zu machen und die Fremden
zu einem Besuch zu veranlassen, aber auch die
Bewohner selbst über den Wert namentlich der
alten Holzhäuser, die selbst den Gebildeten bei
uns vielfach nur als unbrauchbares Gerümpel gelten,
aufzuklären. Denn der Verfasser ist mit grosser
Begeisterung an seine Arbeit gegangen, und es ist
eine Freude, zu sehen, mit welcher Liebe er die
malerischen Strassen der alten Weifenstadt durch-
wandert, die zahllosen Holzbauten dreier Jahr-
hunderte, die alte und doch auch wieder neue
Burg Heinrich des L. und die lange Reihe der
stattlichen romanischen und gotischen Kirchen in
sich aufgenommen hat, mit welchem Verständnis
er schliesslich auch in das künstlerische Wesen der
Hauptbauten — ich will als Beispiel nur die
Würdigung der berühmten Renaissancefassade des
Gewandhauses nennen — ein gedrungen ist.
Aber die Medaille hat leider auch ihre Kehr-
seite. Es wäre freilich unbillig, ganz allgemein zu
verlangen, dass die „berühmten Kunststätten“ durch-
weg auf eigenen Forschungen beruhen sollten, und
man wird meist zufrieden sein, wenn sie den Stand
unseres Wissens, soweit er in Veröffentlichungen
vorliegt, wiedergeben. Nur Braunschweig hätte
eine Ausnahme machen müssen, insofern hier
wenigstens über die bau- und kunstgeschichtlich
so wichtigen Kirchen seit Schillers Buch von 1852
nichts mehr veröffentlicht worden ist, und Döring
hätte sich wenigstens an die lebenden Braunschweiger
Forscher wenden müssen, die in der Zwischenzeit
keineswegs untätig gewesen sind und die den Ver-
fasser gern unterstützt hätten. Statt dessen hat
sich dieser auf sich selbst verlassen, aber sich
offenbar mit flüchtigen Beobachtungen begnügt
und sich zu wenig mit den Denkmälern vertraut
gemacht. Wenn er z. B. das bekannte Holzkruzifix
im Dom für das Bild der hl. Era erklärt, der die
Krypta heilig gewesen sei, so bedenkt er nicht,
dass ein solches weit über die natürliche Grösse
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
einfache Gedanken und Mitteilungen, selbst Dinge,
die man oft genug gehört hat, nimmt man in W.’s
Umprägung mit Genuss entgegen. Niemals wird
der Autor müde oder gleichgiltig. Die Form ist
immer überlegt, auch wo sie scheinbar nachlässig
ist. Stets hat man das Gefühl, einen feinen und
geistvollen Menschen zu hören, der seine eigenen
Gedanken, seine eigene Form hat. Wie viele kunst-
geschichtliche Bücher gibt es, die man ohne
Ermüdung, mit stetigem Genuss sogar, lesen
kann? —
Meine Bemerkungen über W.’s Buch habe ich
nach vier Momenten geordnet, weil man von so
verschiedenen Standpunkten aus über das Buch
urteilen kann und urteilen wird. Man könnte sie
mit den Arten der Erläuterung vergleichen, die in
einer Galerie von verschiedenen Besuchergruppen
verlangt werden. Manche Forscher kümmern sich
nur eben um die Forschung und erwarten, dass
der Direktor ihnen bei jedem Besuch mit einer
neuen Attribution oder sonstigen Entdeckung auf-
wartet ; die andern verlangen einen erschöpfen-
den wissenschaftlichen Katalog (und ein solcher
macht, nebenbei gesagt, seinem Autor die meiste
Mühe); Künstler und schlichte Kunstfreunde wün-
schen von den künstlerischen Momenten in den
besten Werken zu hören (und einen solchen Führer
zu schreiben, macht dem Autor viel Vergnügen: I
er spricht von den Werken, die ihn interessieren,
und in dem Sinne, der ihn interessiert); endlich
die vierte Gruppe will vor allem von einem be-
deutenden und feinen Geist geleitet sein, in guter
Form, mündlich oder schriftlich, und was er sagt,
darf auch in manchem einseitig und zuweilen sogar
falsch sein.
Hiernach möge also ein jeglicher den Akzent
auf eines oder mehrere jener vier Momente legen
und sich danach ein mehr oder weniger einheit-
liches Urteil nach seiner Facon bilden. Das beste
Urteil aber erhält man über ein Buch — die Re-
daktion möge mir das nicht übel nehmen — nicht
aus Rezensionen, sondern durch eigene Lektüre;
und soweit wenigstens möchte ich meine persön-
liche Meinung nicht zurückhalten: dies Buch sollte
jeder Kunsthistoriker lesen, ohne Unterschied des
Alters und der Richtung. Ich habe es schon
zweimal gelesen, einige Abschnitte sogar dreimal.
Vielleicht wird man dann finden, dass manches
vorstehende pedantischer Bedenklichkeit entspringe.
Tant mieux. Sicherlich wird es nur ganz wenige
Kunsthistoriker geben, die auch nur Ein solches
Kapitel schreiben können und schreiben, wie sie
uns WölffLin hier geschenkt hat. Aber immerhin, wer
heute ein Buch von 316 Seiten über Dürer an die
Oeffentlichkeit bringt, der muss sich schon gefallen
lassen, dass er mit grossem Maass gemessen wird,
insonderheit wenn es ein Mann von Wölfflins
Stellung ist. Ludwig Justi
Oskar Döring, Braunschweig. (Berühmte
Kunststätten Nr. 31, mit 118 Abbildungen.
Leipzig, E. A. Seemann, 1905. 8°, 136 S. 3,00 Mk.
Braunschweig ist erst die siebente deutsche
Stadt, die in dieser bekannten und beliebten Reihe
Berücksichtigung gefunden hat, an Reichtum und
Bedeutung ihrer Denkmäler steht sie aber hinter
keiner andern zurück, obwohl sie bei weitem nicht
so oft besucht wird, wie sie es verdiente. Es ist
keine Frage, dass Dörings Buch nicht wenig dazu
beitragen wird, Braunschweigs Bedeutung auch
weiteren Kreisen klar zu machen und die Fremden
zu einem Besuch zu veranlassen, aber auch die
Bewohner selbst über den Wert namentlich der
alten Holzhäuser, die selbst den Gebildeten bei
uns vielfach nur als unbrauchbares Gerümpel gelten,
aufzuklären. Denn der Verfasser ist mit grosser
Begeisterung an seine Arbeit gegangen, und es ist
eine Freude, zu sehen, mit welcher Liebe er die
malerischen Strassen der alten Weifenstadt durch-
wandert, die zahllosen Holzbauten dreier Jahr-
hunderte, die alte und doch auch wieder neue
Burg Heinrich des L. und die lange Reihe der
stattlichen romanischen und gotischen Kirchen in
sich aufgenommen hat, mit welchem Verständnis
er schliesslich auch in das künstlerische Wesen der
Hauptbauten — ich will als Beispiel nur die
Würdigung der berühmten Renaissancefassade des
Gewandhauses nennen — ein gedrungen ist.
Aber die Medaille hat leider auch ihre Kehr-
seite. Es wäre freilich unbillig, ganz allgemein zu
verlangen, dass die „berühmten Kunststätten“ durch-
weg auf eigenen Forschungen beruhen sollten, und
man wird meist zufrieden sein, wenn sie den Stand
unseres Wissens, soweit er in Veröffentlichungen
vorliegt, wiedergeben. Nur Braunschweig hätte
eine Ausnahme machen müssen, insofern hier
wenigstens über die bau- und kunstgeschichtlich
so wichtigen Kirchen seit Schillers Buch von 1852
nichts mehr veröffentlicht worden ist, und Döring
hätte sich wenigstens an die lebenden Braunschweiger
Forscher wenden müssen, die in der Zwischenzeit
keineswegs untätig gewesen sind und die den Ver-
fasser gern unterstützt hätten. Statt dessen hat
sich dieser auf sich selbst verlassen, aber sich
offenbar mit flüchtigen Beobachtungen begnügt
und sich zu wenig mit den Denkmälern vertraut
gemacht. Wenn er z. B. das bekannte Holzkruzifix
im Dom für das Bild der hl. Era erklärt, der die
Krypta heilig gewesen sei, so bedenkt er nicht,
dass ein solches weit über die natürliche Grösse