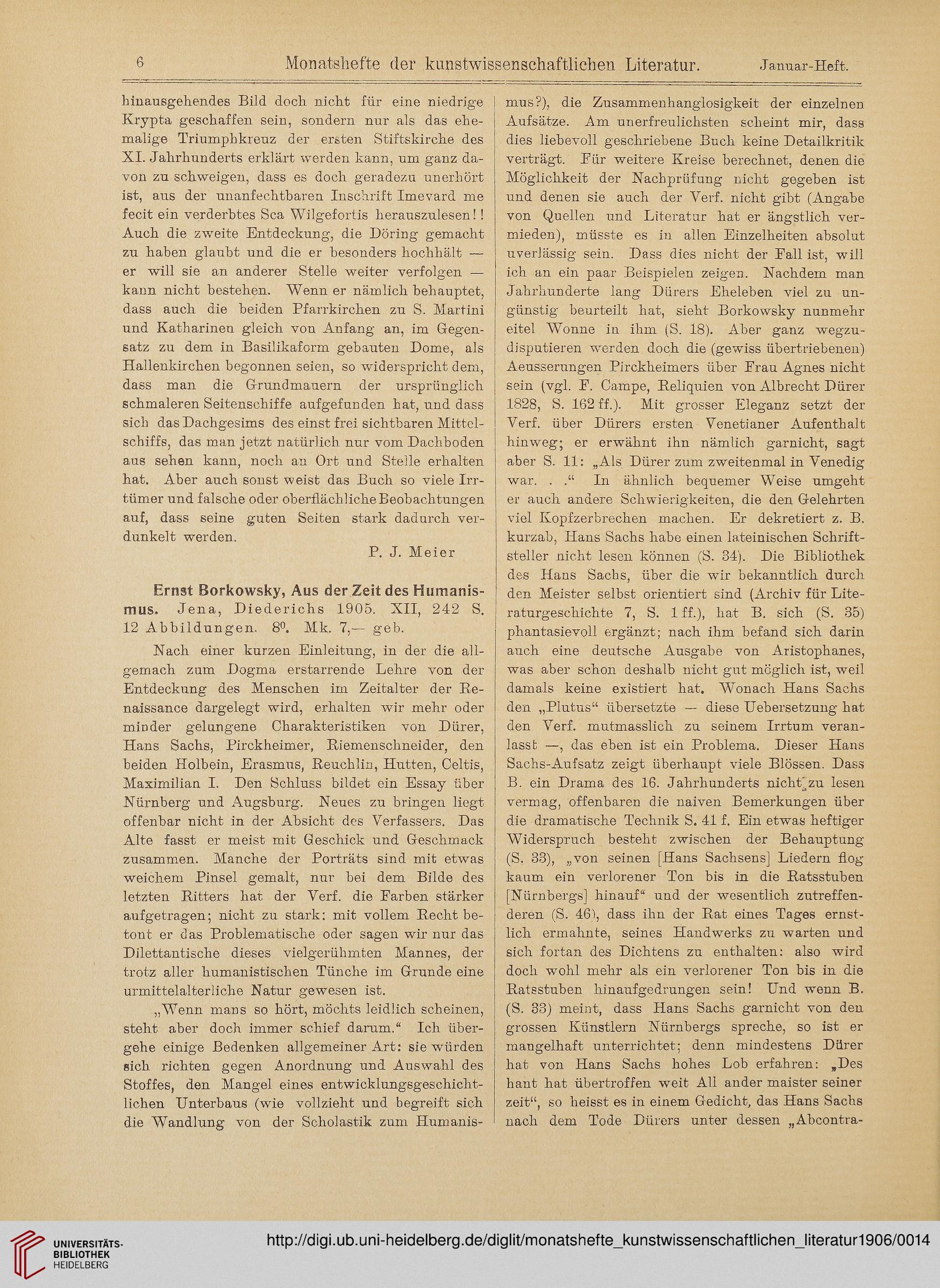6
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
Januar-Heft.
hinausgehendes Bild doch, nicht für eine niedrige
Krypta geschaffen sein, sondern nur als das ehe-
malige Triumphkreuz der ersten Stiftskirche des
XI. Jahrhunderts erklärt werden kann, um ganz da-
von zu schweigen, dass es doch geradezu unerhört
ist, aus der unanfechtbaren Inschrift Imevard nie
fecit ein verderbtes Sca Wilgefortis herauszulesen! !
Auch die zweite Entdeckung, die Döring gemacht
zu haben glaubt und die er besonders hochhält —
er will sie an anderer Stelle weiter verfolgen —
kann nicht bestehen. Wenn er nämlich behauptet,
dass auch die beiden Pfarrkirchen zu S. Martini
und Katharinen gleich von Anfang an, im Gegen-
satz zu dem in Basilikaform gebauten Dome, als
Hallenkirchen begonnen seien, so widerspricht dem,
dass man die Grundmauern der ursprünglich
schmaleren Seitenschiffe aufgefunden hat, und dass
sich das Dachgesims des einst frei sichtbaren Mittel-
schiffs, das man jetzt natürlich nur vom Dachboden
aus sehen kann, noch an Ort und Stelle erhalten
hat. Aber auch sonst weist das Buch so viele Irr-
tümer und falsche oder oberflächliche Beobachtungen
auf, dass seine guten Seiten stark dadurch ver-
dunkelt werden.
P. J. Meier
Ernst Borkowsky, Aus der Zeit des Humanis-
mus. Jena, Diederichs 1905. XII, 242 S.
12 Abbildungen. 8°. Mk. 7,— geb.
Nach einer kurzen Einleitung, in der die all-
gemach zum Dogma erstarrende Lehre von der
Entdeckung des Menschen im Zeitalter der Re-
naissance dargelegt wird, erhalten wir mehr oder
minder gelungene Charakteristiken von Dürer,
Hans Sachs, Pirckheimer, Riemenschneider, den
beiden Holbein, Erasmus, Reuchlia, Hutten, Celtis,
Maximilian I. Den Schluss bildet ein Essay über
Nürnberg und Augsburg. Neues zu bringen liegt
offenbar nicht in der Absicht des Verfassers. Das
Alte fasst er meist mit Geschick und Geschmack
zusammen. Manche der Porträts sind mit etwas
weichem Pinsel gemalt, nur bei dem Bilde des
letzten Ritters hat der Verf. die Farben stärker
aufgetragen; nicht zu stark: mit vollem Recht be-
tont er das Problematische oder sagen wir nur das
Dilettantische dieses vielgerühmten Mannes, der
trotz aller humanistischen Tünche im Grunde eine
urmittelalterliche Natur gewesen ist.
„Wenn maus so hört, möchts leidlich scheinen,
steht aber doch immer schief darum.“ Ich über-
gehe einige Bedenken allgemeiner Art: sie würden
sich richten gegen Anordnung und Auswahl des
Stoffes, den Mangel eines entwicklungsgeschicht-
lichen Unterbaus (wie vollzieht und begreift sich
die Wandlung von der Scholastik zum Humanis-
mus?), die Zusammenhanglosigkeit der einzelnen
Aufsätze. Am unerfreulichsten scheint mir, dass
dies liebevoll geschriebene Buch keine Detailkritik
verträgt. Für weitere Kreise berechnet, denen die
Möglichkeit der Nachprüfung nicht gegeben ist
und denen sie auch der Verf. nicht gibt (Angabe
von Quellen und Literatur hat er ängstlich, ver-
mieden), müsste es in allen Einzelheiten absolut
uverlässig sein. Dass dies nicht der Fall ist, will
ich an ein paar Beispielen zeigen. Nachdem man
Jahrhunderte lang Dürers Eheleben viel zu un-
günstig beurteilt hat, sieht Borkowsky nunmehr
eitel Wonne in ihm (S. 18). Aber ganz wegzu-
disputieren werden doch die (gewiss übertriebenen)
Aeusserungen Pirckheimers über Frau Agnes nicht
sein (vgl, F. Campe, Reliquien von Albrecht Dürer
1828, S. 162 ff.). Mit grosser Eleganz setzt der
Verf. über Dürers ersten Venetianer Aufenthalt
hinweg; er erwähnt ihn nämlich garnicht, sagt
aber 8. 11: „Als Dürer zum zweitenmal in Venedig
war. . .“ In ähnlich bequemer Weise umgeht
er auch andere Schwierigkeiten, die den Gelehrten
viel Kopfzerbrechen machen. Er dekretiert z. B.
kurzab, Hans Sachs habe einen lateinischen Schrift-
steller nicht lesen können (S. 34). Die Bibliothek
des Hans Sachs, über die wir bekanntlich durch
den Meister selbst orientiert sind (Archiv für Lite-
raturgeschichte 7, S. 1 ff.), hat B. sich (S. 35)
phantasievoll ergänzt; nach ihm befand sich darin
auch eine deutsche Ausgabe von Aristophanes,
was aber schon deshalb nicht gut möglich ist, weil
damals keine existiert hat. Wonach Hans Sachs
den „Plutus“ übersetzte — diese Uebersetzung hat
den Verf. mutmasslich zu seinem Irrtum veran-
lasst —, das eben ist ein Problema. Dieser Hans
Sachs-Aufsatz zeigt überhaupt viele Blössen. Dass
B. ein Drama des 16. Jahrhunderts nicht'zu lesen
vermag, offenbaren die naiven Bemerkungen über
die dramatische Technik S. 41 f. Ein etwas heftiger
Widerspruch besteht zwischen der Behauptung
(S. 33), „von seinen [Hans Sachsens] Liedern flog
kaum ein verlorener Ton bis in die Ratsstuben
[Nürnbergs] hinauf“ und der wesentlich zutreffen-
deren (S. 46), dass ihn der Rat eines Tages ernst-
lich ermahnte, seines Handwerks zu warten und
sich fortan des Dichtens zu enthalten: also wird
doch wohl mehr als ein verlorener Ton bis in die
Ratsstuben hinaufgedrungen sein! Und wenn B.
(S. 33) meint, dass Hans Sachs garnicht von den
grossen Künstlern Nürnbergs spreche, so ist er
mangelhaft unterrichtet; denn mindestens Dürer
hat von Hans Sachs hohes Lob erfahren: „Des
hant hat übertroffen weit All ander maister seiner
zeit“, so heisst es in einem Gedicht, das Hans Sachs
nach dem Tode Dürers unter dessen „Abcontra-
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
Januar-Heft.
hinausgehendes Bild doch, nicht für eine niedrige
Krypta geschaffen sein, sondern nur als das ehe-
malige Triumphkreuz der ersten Stiftskirche des
XI. Jahrhunderts erklärt werden kann, um ganz da-
von zu schweigen, dass es doch geradezu unerhört
ist, aus der unanfechtbaren Inschrift Imevard nie
fecit ein verderbtes Sca Wilgefortis herauszulesen! !
Auch die zweite Entdeckung, die Döring gemacht
zu haben glaubt und die er besonders hochhält —
er will sie an anderer Stelle weiter verfolgen —
kann nicht bestehen. Wenn er nämlich behauptet,
dass auch die beiden Pfarrkirchen zu S. Martini
und Katharinen gleich von Anfang an, im Gegen-
satz zu dem in Basilikaform gebauten Dome, als
Hallenkirchen begonnen seien, so widerspricht dem,
dass man die Grundmauern der ursprünglich
schmaleren Seitenschiffe aufgefunden hat, und dass
sich das Dachgesims des einst frei sichtbaren Mittel-
schiffs, das man jetzt natürlich nur vom Dachboden
aus sehen kann, noch an Ort und Stelle erhalten
hat. Aber auch sonst weist das Buch so viele Irr-
tümer und falsche oder oberflächliche Beobachtungen
auf, dass seine guten Seiten stark dadurch ver-
dunkelt werden.
P. J. Meier
Ernst Borkowsky, Aus der Zeit des Humanis-
mus. Jena, Diederichs 1905. XII, 242 S.
12 Abbildungen. 8°. Mk. 7,— geb.
Nach einer kurzen Einleitung, in der die all-
gemach zum Dogma erstarrende Lehre von der
Entdeckung des Menschen im Zeitalter der Re-
naissance dargelegt wird, erhalten wir mehr oder
minder gelungene Charakteristiken von Dürer,
Hans Sachs, Pirckheimer, Riemenschneider, den
beiden Holbein, Erasmus, Reuchlia, Hutten, Celtis,
Maximilian I. Den Schluss bildet ein Essay über
Nürnberg und Augsburg. Neues zu bringen liegt
offenbar nicht in der Absicht des Verfassers. Das
Alte fasst er meist mit Geschick und Geschmack
zusammen. Manche der Porträts sind mit etwas
weichem Pinsel gemalt, nur bei dem Bilde des
letzten Ritters hat der Verf. die Farben stärker
aufgetragen; nicht zu stark: mit vollem Recht be-
tont er das Problematische oder sagen wir nur das
Dilettantische dieses vielgerühmten Mannes, der
trotz aller humanistischen Tünche im Grunde eine
urmittelalterliche Natur gewesen ist.
„Wenn maus so hört, möchts leidlich scheinen,
steht aber doch immer schief darum.“ Ich über-
gehe einige Bedenken allgemeiner Art: sie würden
sich richten gegen Anordnung und Auswahl des
Stoffes, den Mangel eines entwicklungsgeschicht-
lichen Unterbaus (wie vollzieht und begreift sich
die Wandlung von der Scholastik zum Humanis-
mus?), die Zusammenhanglosigkeit der einzelnen
Aufsätze. Am unerfreulichsten scheint mir, dass
dies liebevoll geschriebene Buch keine Detailkritik
verträgt. Für weitere Kreise berechnet, denen die
Möglichkeit der Nachprüfung nicht gegeben ist
und denen sie auch der Verf. nicht gibt (Angabe
von Quellen und Literatur hat er ängstlich, ver-
mieden), müsste es in allen Einzelheiten absolut
uverlässig sein. Dass dies nicht der Fall ist, will
ich an ein paar Beispielen zeigen. Nachdem man
Jahrhunderte lang Dürers Eheleben viel zu un-
günstig beurteilt hat, sieht Borkowsky nunmehr
eitel Wonne in ihm (S. 18). Aber ganz wegzu-
disputieren werden doch die (gewiss übertriebenen)
Aeusserungen Pirckheimers über Frau Agnes nicht
sein (vgl, F. Campe, Reliquien von Albrecht Dürer
1828, S. 162 ff.). Mit grosser Eleganz setzt der
Verf. über Dürers ersten Venetianer Aufenthalt
hinweg; er erwähnt ihn nämlich garnicht, sagt
aber 8. 11: „Als Dürer zum zweitenmal in Venedig
war. . .“ In ähnlich bequemer Weise umgeht
er auch andere Schwierigkeiten, die den Gelehrten
viel Kopfzerbrechen machen. Er dekretiert z. B.
kurzab, Hans Sachs habe einen lateinischen Schrift-
steller nicht lesen können (S. 34). Die Bibliothek
des Hans Sachs, über die wir bekanntlich durch
den Meister selbst orientiert sind (Archiv für Lite-
raturgeschichte 7, S. 1 ff.), hat B. sich (S. 35)
phantasievoll ergänzt; nach ihm befand sich darin
auch eine deutsche Ausgabe von Aristophanes,
was aber schon deshalb nicht gut möglich ist, weil
damals keine existiert hat. Wonach Hans Sachs
den „Plutus“ übersetzte — diese Uebersetzung hat
den Verf. mutmasslich zu seinem Irrtum veran-
lasst —, das eben ist ein Problema. Dieser Hans
Sachs-Aufsatz zeigt überhaupt viele Blössen. Dass
B. ein Drama des 16. Jahrhunderts nicht'zu lesen
vermag, offenbaren die naiven Bemerkungen über
die dramatische Technik S. 41 f. Ein etwas heftiger
Widerspruch besteht zwischen der Behauptung
(S. 33), „von seinen [Hans Sachsens] Liedern flog
kaum ein verlorener Ton bis in die Ratsstuben
[Nürnbergs] hinauf“ und der wesentlich zutreffen-
deren (S. 46), dass ihn der Rat eines Tages ernst-
lich ermahnte, seines Handwerks zu warten und
sich fortan des Dichtens zu enthalten: also wird
doch wohl mehr als ein verlorener Ton bis in die
Ratsstuben hinaufgedrungen sein! Und wenn B.
(S. 33) meint, dass Hans Sachs garnicht von den
grossen Künstlern Nürnbergs spreche, so ist er
mangelhaft unterrichtet; denn mindestens Dürer
hat von Hans Sachs hohes Lob erfahren: „Des
hant hat übertroffen weit All ander maister seiner
zeit“, so heisst es in einem Gedicht, das Hans Sachs
nach dem Tode Dürers unter dessen „Abcontra-