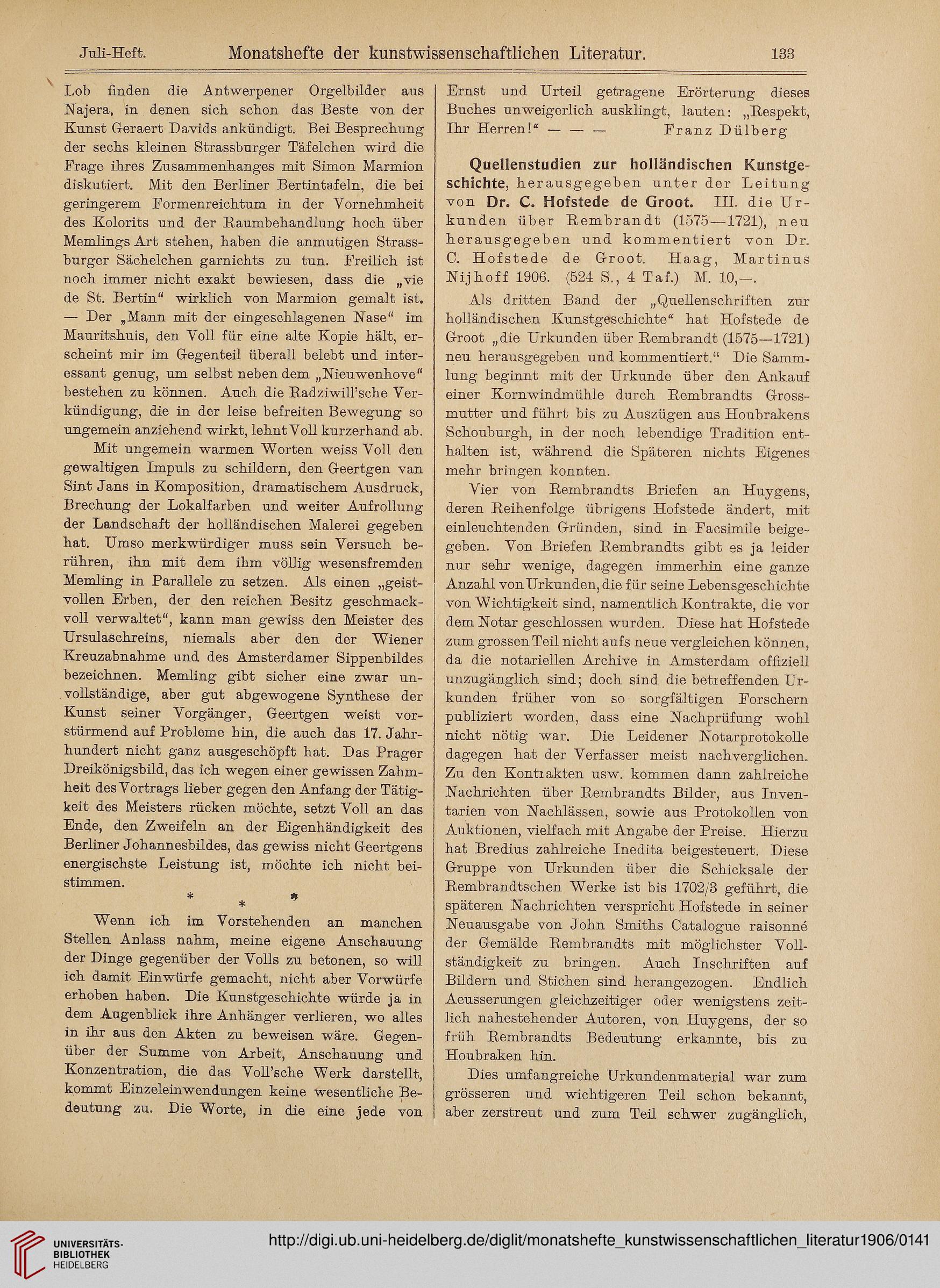Juli-Heft.
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
133
Lob finden die Antwerpener Orgelbilder aus
Najera, in denen sieb schon das Beste von der
Kunst Geraert Davids ankündigt. Bei Besprechung
der sechs kleinen Strassburger Täfelchen wird die
Frage ihres Zusammenhanges mit Simon Marmion
diskutiert. Mit den Berliner Bertintafeln, die bei
geringerem Formenreichtum in der Vornehmheit
des Kolorits und der Raumbehandlung hoch über
Memlings Art stehen, haben die anmutigen Strass-
burger Sächelchen garnichts zu tun. Freilich ist
noch immer nicht exakt bewiesen, dass die „vie
de St. Bertin“ wirklich von Marmion gemalt ist.
— Der „Mann mit der eingeschlagenen Nase“ im
Mauritshuis, den Voll für eine alte Kopie hält, er-
scheint mir im Gegenteil überall belebt und inter-
essant genug, um selbst neben dem „Nieuwenhove“
bestehen zu können. Auch die Radziwill’sche Ver-
kündigung, die in der leise befreiten Bewegung so
ungemein anziehend wirkt, lehnt Voll kurzerhand ab.
Mit ungemein warmen Worten weiss Voll den
gewaltigen Impuls zu schildern, den Geertgen van
Sint Jans in Komposition, dramatischem Ausdruck,
Brechung der Lokalfarben und weiter Aufrollung
der Landschaft der holländischen Malerei gegeben
hat. Umso merkwürdiger muss sein Versuch be-
rühren, ihn mit dem ihm völlig wesensfremden
Memling in Parallele zu setzen. Als einen „geist-
vollen Erben, der den reichen Besitz geschmack-
voll verwaltet“, kann man gewiss den Meister des
Ursulaschreins, niemals aber den der Wiener
Kreuzabnahme und des Amsterdamer Sippenbildes
bezeichnen. Memling gibt sicher eine zwar un-
vollständige, aber gut abgewogene Synthese der
Kunst seiner Vorgänger, Geertgen weist vor-
stürmend auf Probleme hin, die auch das 17. Jahr-
hundert nicht ganz ausgeschöpft hat. Das Prager
Dreikönigsbild, das ich wegen einer gewissen Zahm-
heit des Vortrags lieber gegen den Anfang der Tätig-
keit des Meisters rücken möchte, setzt Voll an das
Ende, den Zweifeln an der Eigenhändigkeit des
Berliner Johannesbildes, das gewiss nicht Geertgens
energischste Leistung ist, möchte ich nicht bei-
stimmen.
* «
*
Wenn ich im Vorstehenden an manchen
Stellen Anlass nahm, meine eigene Anschauung
der Dinge gegenüber der Völls zu betonen, so will
ich damit Einwürfe gemacht, nicht aber Vorwürfe
erhoben haben. Die Kunstgeschichte würde ja in
dem Augenblick ihre Anhänger verlieren, wo alles
in ihr aus den Akten zu beweisen wäre. Gegen-
über der Summe von Arbeit, Anschauung und
Konzentration, die das Voll’sche Werk darstellt,
kommt Einzeleinwendungen keine wesentliche Be-
deutung zu. Die Worte, in die eine jede von
Ernst und Urteil getragene Erörterung dieses
Buches unweigerlich ausklingt, lauten: „Respekt,
Ihr Herren!“ — — — Franz Dülberg
Quellenstudien zur holländischen Kunstge-
schichte, her ausgegeben unter der Leitung
von Dr. C. Hofstede de Groot. III. die Ur-
kunden über Rembrandt (1575 —1721), neu
herausgegeben und kommentiert von Dr.
C. Hofstede de Groot. Haag, Martinus
Nijhoff 1906. (524 S., 4 Taf.) M. 10,-.
Als dritten Band der „Quellenschriften zur
holländischen Kunstgeschichte“ hat Hofstede de
Groot „die Urkunden über Rembrandt (1575—1721)
neu herausgegeben und kommentiert.“ Die Samm-
lung beginnt mit der Urkunde über den Ankauf
einer Korn Windmühle durch Rembrandts Gross-
mutter und führt bis zu Auszügen aus Houbrakens
Schouburgh, in der noch lebendige Tradition ent-
halten ist, während die Späteren nichts Eigenes
mehr bringen konnten.
Vier von Rembrandts Briefen an Huygens,
deren Reihenfolge übrigens Hofstede ändert, mit
einleuchtenden Gründen, sind in Facsimile beige-
geben. Von Briefen Rembrandts gibt es ja leider
nur sehr wenige, dagegen immerhin eine ganze
Anzahl von Urkunden, die für seine Lebensgeschichte
von Wichtigkeit sind, namentlich Kontrakte, die vor
dem Notar geschlossen wurden. Diese hat Hofstede
zum grossen Teil nicht aufs neue vergleichen können,
da die notariellen Archive in Amsterdam offiziell
unzugänglich sind; doch sind die betieffenden Ur-
kunden früher von so sorgfältigen Forschern
publiziert worden, dass eine Nachprüfung wohl
nicht nötig war. Die Leidener Notarprotokolle
dagegen hat der Verfasser meist nach verglichen.
Zu den Konti akten usw. kommen dann zahlreiche
Nachrichten über Rembrandts Bilder, aus Inven-
tarien von Nachlässen, sowie aus Protokollen von
Auktionen, vielfach mit Angabe der Preise. Hierzu
hat Bredius zahlreiche Inedita beigesteuert. Diese
Gruppe von Urkunden über die Schicksale der
Rembrandtschen Werke ist bis 1702/3 geführt, die
späteren Nachrichten verspricht Hofstede in seiner
Neuausgabe von John Smiths Catalogue raisonne
der Gemälde Rembrandts mit möglichster Voll-
ständigkeit zu bringen. Auch Inschriften auf
Bildern und Stichen sind herangezogen. Endlich
Aeusserungen gleichzeitiger oder wenigstens zeit-
lich nahestehender Autoren, von Huygens, der so
früh Rembrandts Bedeutung erkannte, bis zu
Houbraken hin.
Dies umfangreiche Urkundenmaterial war zum
grösseren und wichtigeren Teil schon bekannt,
aber zerstreut und zum Teil schwer zugänglich,
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
133
Lob finden die Antwerpener Orgelbilder aus
Najera, in denen sieb schon das Beste von der
Kunst Geraert Davids ankündigt. Bei Besprechung
der sechs kleinen Strassburger Täfelchen wird die
Frage ihres Zusammenhanges mit Simon Marmion
diskutiert. Mit den Berliner Bertintafeln, die bei
geringerem Formenreichtum in der Vornehmheit
des Kolorits und der Raumbehandlung hoch über
Memlings Art stehen, haben die anmutigen Strass-
burger Sächelchen garnichts zu tun. Freilich ist
noch immer nicht exakt bewiesen, dass die „vie
de St. Bertin“ wirklich von Marmion gemalt ist.
— Der „Mann mit der eingeschlagenen Nase“ im
Mauritshuis, den Voll für eine alte Kopie hält, er-
scheint mir im Gegenteil überall belebt und inter-
essant genug, um selbst neben dem „Nieuwenhove“
bestehen zu können. Auch die Radziwill’sche Ver-
kündigung, die in der leise befreiten Bewegung so
ungemein anziehend wirkt, lehnt Voll kurzerhand ab.
Mit ungemein warmen Worten weiss Voll den
gewaltigen Impuls zu schildern, den Geertgen van
Sint Jans in Komposition, dramatischem Ausdruck,
Brechung der Lokalfarben und weiter Aufrollung
der Landschaft der holländischen Malerei gegeben
hat. Umso merkwürdiger muss sein Versuch be-
rühren, ihn mit dem ihm völlig wesensfremden
Memling in Parallele zu setzen. Als einen „geist-
vollen Erben, der den reichen Besitz geschmack-
voll verwaltet“, kann man gewiss den Meister des
Ursulaschreins, niemals aber den der Wiener
Kreuzabnahme und des Amsterdamer Sippenbildes
bezeichnen. Memling gibt sicher eine zwar un-
vollständige, aber gut abgewogene Synthese der
Kunst seiner Vorgänger, Geertgen weist vor-
stürmend auf Probleme hin, die auch das 17. Jahr-
hundert nicht ganz ausgeschöpft hat. Das Prager
Dreikönigsbild, das ich wegen einer gewissen Zahm-
heit des Vortrags lieber gegen den Anfang der Tätig-
keit des Meisters rücken möchte, setzt Voll an das
Ende, den Zweifeln an der Eigenhändigkeit des
Berliner Johannesbildes, das gewiss nicht Geertgens
energischste Leistung ist, möchte ich nicht bei-
stimmen.
* «
*
Wenn ich im Vorstehenden an manchen
Stellen Anlass nahm, meine eigene Anschauung
der Dinge gegenüber der Völls zu betonen, so will
ich damit Einwürfe gemacht, nicht aber Vorwürfe
erhoben haben. Die Kunstgeschichte würde ja in
dem Augenblick ihre Anhänger verlieren, wo alles
in ihr aus den Akten zu beweisen wäre. Gegen-
über der Summe von Arbeit, Anschauung und
Konzentration, die das Voll’sche Werk darstellt,
kommt Einzeleinwendungen keine wesentliche Be-
deutung zu. Die Worte, in die eine jede von
Ernst und Urteil getragene Erörterung dieses
Buches unweigerlich ausklingt, lauten: „Respekt,
Ihr Herren!“ — — — Franz Dülberg
Quellenstudien zur holländischen Kunstge-
schichte, her ausgegeben unter der Leitung
von Dr. C. Hofstede de Groot. III. die Ur-
kunden über Rembrandt (1575 —1721), neu
herausgegeben und kommentiert von Dr.
C. Hofstede de Groot. Haag, Martinus
Nijhoff 1906. (524 S., 4 Taf.) M. 10,-.
Als dritten Band der „Quellenschriften zur
holländischen Kunstgeschichte“ hat Hofstede de
Groot „die Urkunden über Rembrandt (1575—1721)
neu herausgegeben und kommentiert.“ Die Samm-
lung beginnt mit der Urkunde über den Ankauf
einer Korn Windmühle durch Rembrandts Gross-
mutter und führt bis zu Auszügen aus Houbrakens
Schouburgh, in der noch lebendige Tradition ent-
halten ist, während die Späteren nichts Eigenes
mehr bringen konnten.
Vier von Rembrandts Briefen an Huygens,
deren Reihenfolge übrigens Hofstede ändert, mit
einleuchtenden Gründen, sind in Facsimile beige-
geben. Von Briefen Rembrandts gibt es ja leider
nur sehr wenige, dagegen immerhin eine ganze
Anzahl von Urkunden, die für seine Lebensgeschichte
von Wichtigkeit sind, namentlich Kontrakte, die vor
dem Notar geschlossen wurden. Diese hat Hofstede
zum grossen Teil nicht aufs neue vergleichen können,
da die notariellen Archive in Amsterdam offiziell
unzugänglich sind; doch sind die betieffenden Ur-
kunden früher von so sorgfältigen Forschern
publiziert worden, dass eine Nachprüfung wohl
nicht nötig war. Die Leidener Notarprotokolle
dagegen hat der Verfasser meist nach verglichen.
Zu den Konti akten usw. kommen dann zahlreiche
Nachrichten über Rembrandts Bilder, aus Inven-
tarien von Nachlässen, sowie aus Protokollen von
Auktionen, vielfach mit Angabe der Preise. Hierzu
hat Bredius zahlreiche Inedita beigesteuert. Diese
Gruppe von Urkunden über die Schicksale der
Rembrandtschen Werke ist bis 1702/3 geführt, die
späteren Nachrichten verspricht Hofstede in seiner
Neuausgabe von John Smiths Catalogue raisonne
der Gemälde Rembrandts mit möglichster Voll-
ständigkeit zu bringen. Auch Inschriften auf
Bildern und Stichen sind herangezogen. Endlich
Aeusserungen gleichzeitiger oder wenigstens zeit-
lich nahestehender Autoren, von Huygens, der so
früh Rembrandts Bedeutung erkannte, bis zu
Houbraken hin.
Dies umfangreiche Urkundenmaterial war zum
grösseren und wichtigeren Teil schon bekannt,
aber zerstreut und zum Teil schwer zugänglich,