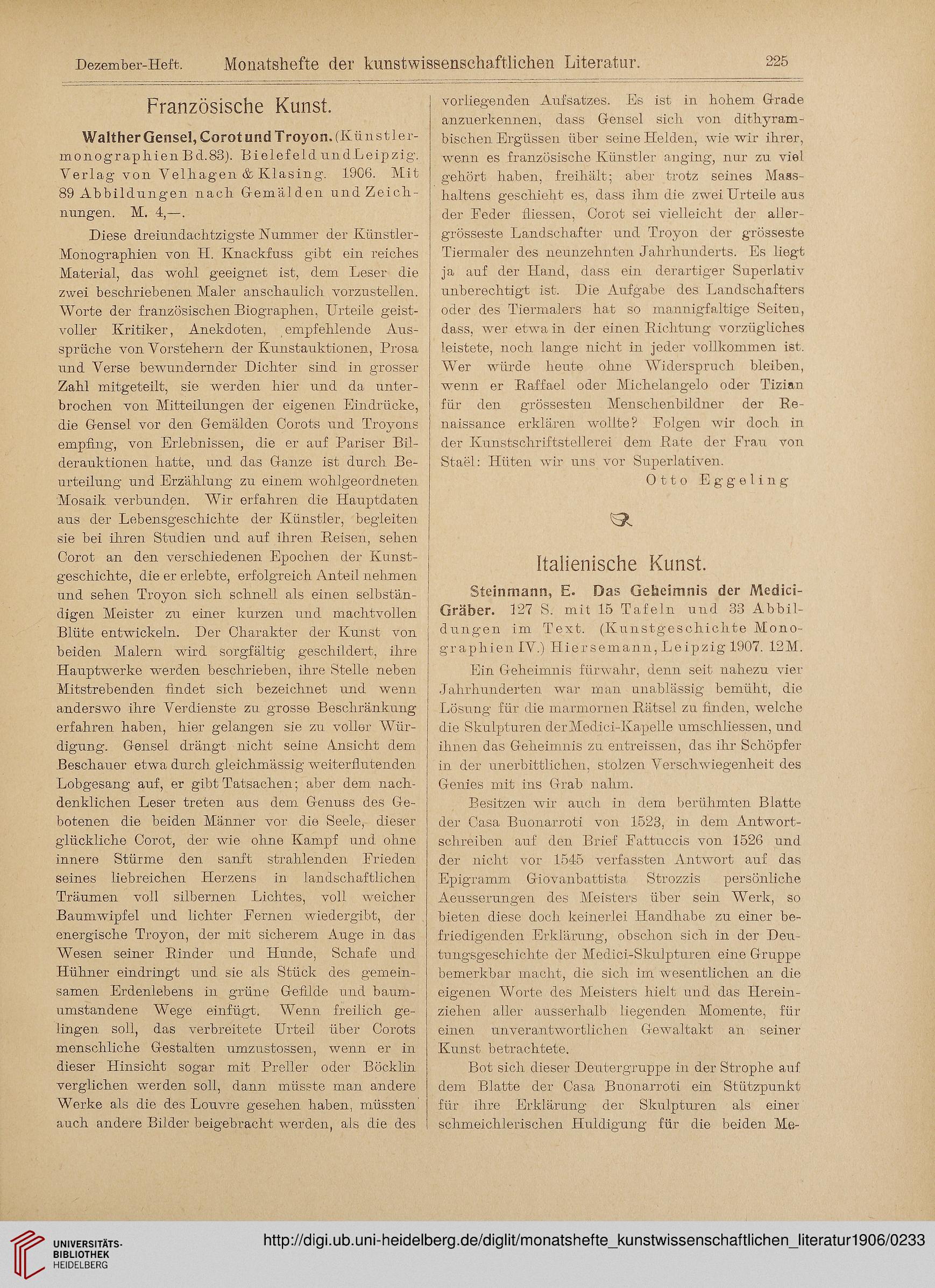225
Dezember-Heft. Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
Französische Kunst.
Walther Gensei, Corot und Troyon. (Künstler-
monograp hienB d.83). Bielef eld undLeipzig.
Verlag von Velhagen & Klasing. 1906. Mit
89 Abbildungen nach Gemälden und Zeich-
nungen. M. 4,—.
Diese dreiundachtzigste Nummer der Künstler-
Monographien von H. Knackfuss gibt ein reiches
Material, das wohl geeignet ist, dem Lesei' die
zwei beschriebenen Maler anschaulich vorzustellen.
Worte der französischen Biographen, Urteile geist-
voller Kritiker, Anekdoten, empfehlende Aus-
sprüche von Vorstehern der Kunstauktionen, Prosa
und Verse bewundernder Dichter sind in grosser
Zahl mitgeteilt, sie werden hier und da unter-
brochen von Mitteilungen der eigenen Eindrücke,
die Gensei vor den Gemälden Corots und Troyons
empfing, von Erlebnissen, die er auf Pariser Bil-
derauktionen hatte, und das Ganze ist durch Be-
urteilung und Erzählung zu einem wohlgeordneten
Mosaik verbunden. Wir erfahren die Hauptdaten
aus der Lebensgeschichte der Künstler, begleiten
sie bei ihren Studien und auf ihren Reisen, sehen
Corot an den verschiedenen Epochen der Kunst-
geschichte, die er erlebte, erfolgreich Anteil nehmen
und sehen Troyon sich schnell als einen selbstän-
digen Meister zu einer kurzen und machtvollen
Blüte entwickeln. Der Charakter der Kunst von
beiden Malern wird sorgfältig geschildert, ihre
Hauptwerke werden beschrieben, ihre Stelle neben
Mitstrebenden findet sich bezeichnet und wenn
anderswo ihre Verdienste zu grosse Beschränkung
erfahren haben, hier gelangen sie zu voller Wür-
digung. Gensei drängt nicht seine Ansicht dem
Beschauer etwa durch gleichmässig weiterflutenden
Lobgesang auf, er gibt Tatsachen; aber dem. nach-
denklichen Leser treten aus dem Genuss des Ge-
botenen die beiden Männer vor die Seele, dieser
glückliche Corot, der wie ohne Kampf nnd ohne
innere Stürme den sanft strahlenden Frieden
seines liebreichen Herzens in landschaftlichen
Träumen voll silbernen Lichtes, voll weicher
Baumwipfel und lichter Fernen wiedergibt, der
energische Troyon, der mit sicherem Auge in das
Wesen seiner Rinder und Hunde, Schafe und
Hühner eindringt und sie als Stück des gemein-
samen Erdenlebens in grüne Gefilde und baum-
umstandene Wege einfügt. Wenn freilich ge-
lingen soll, das verbreitete Urteil über Corots
menschliche Gestalten umzustossen, wenn er in
dieser Hinsicht sogar mit Preller oder Böcklin
verglichen werden soll, dann müsste man andere
Werke als die des Louvre gesehen haben, müssten
auch andere Bilder beigebracht werden, als die des
vorliegenden Aufsatzes. Es ist in hohem Grade
anzuerkennen, dass Gensei sich von dithyram-
bischen Ergüssen über seine Helden, wie wir ihrer,
wenn es französische Künstler anging, nur zu viel
gehört haben, freihält; aber trotz seines Mass-
haltens geschieht es, dass ihm die zwei Urteile aus
der Feder fliessen, Corot sei vielleicht der aller -
grösseste Landschafter und Troyon der grösseste
Tiermaler des neunzehnten Jahrhunderts. Es liegt
ja auf der Hand, dass ein derartiger Superlativ
unberechtigt ist. Die Aufgabe des Landschafters
oder. des Tiermalers hat so mannigfaltige Seiten,
dass, wer etwa in der einen Richtung vorzügliches
leistete, noch lange nicht in jeder vollkommen ist.
Wer würde heute ohne Widerspruch bleiben,
wenn er Raffael oder Michelangelo oder Tizian
für den grössesten Menschenbildner der Re-
naissance erklären wollte? Folgen wir doch in
der Kunstschriftstellerei dem Rate der Frau von
Stael: Hüten wir uns vor Superlativen.
Otto Eg geling
Italienische Kunst.
Steinmann, E. Das Geheimnis der Medici-
Gräber. 127 S. mit 15 Tafeln und 33 Abbil-
dungen im Text. (Kunstgeschichte Mono-
graphien IV.) Hiersemann, Leipzig 1907. 12M.
Ein Geheimnis fürwahr, denn seit nahezu vier
Jahrhunderten war man unablässig bemüht, die
Lösung für die marmornen Rätsel zu finden, welche
die Skulpturen derMedici-Kapelle umschliessen, und
ihnen das Geheimnis zu entreissen, das ihr Schöpfer
in der unerbittlichen, stolzen Verschwiegenheit des
Genies mit ins Grab nahm.
Besitzen wir auch in dem berühmten Blatte
der Casa Buonarroti von 1523, in dem Antwort-
schreiben auf den Brief Fattuccis von 1526 und
der nicht vor 1545 verfassten Antwort auf das
Epigramm Giovanbattista Strozzis persönliche
Aeusserungen des Meisters über sein Werk, so
bieten diese doch keinerlei Handhabe zu einer be-
friedigenden Erklärung, obschon sich in der Deu-
tungsgeschichte der Medici-Skulpturen eine Gruppe
bemerkbar macht, die sich im wesentlichen an die
eigenen Worte des Meisters hielt nnd das Fierein-
ziehen aller ausserhalb liegenden Momente, für
einen unverantwortlichen Gewaltakt an seiner
Kunst betrachtete.
Bot sich dieser Deutergruppe in der Strophe auf
dem Blatte der Casa Buonarroti ein Stützpunkt
für ihre Erklärung der Skulpturen als einer
schmeichlerischen Huldigung für die beiden Me-
Dezember-Heft. Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
Französische Kunst.
Walther Gensei, Corot und Troyon. (Künstler-
monograp hienB d.83). Bielef eld undLeipzig.
Verlag von Velhagen & Klasing. 1906. Mit
89 Abbildungen nach Gemälden und Zeich-
nungen. M. 4,—.
Diese dreiundachtzigste Nummer der Künstler-
Monographien von H. Knackfuss gibt ein reiches
Material, das wohl geeignet ist, dem Lesei' die
zwei beschriebenen Maler anschaulich vorzustellen.
Worte der französischen Biographen, Urteile geist-
voller Kritiker, Anekdoten, empfehlende Aus-
sprüche von Vorstehern der Kunstauktionen, Prosa
und Verse bewundernder Dichter sind in grosser
Zahl mitgeteilt, sie werden hier und da unter-
brochen von Mitteilungen der eigenen Eindrücke,
die Gensei vor den Gemälden Corots und Troyons
empfing, von Erlebnissen, die er auf Pariser Bil-
derauktionen hatte, und das Ganze ist durch Be-
urteilung und Erzählung zu einem wohlgeordneten
Mosaik verbunden. Wir erfahren die Hauptdaten
aus der Lebensgeschichte der Künstler, begleiten
sie bei ihren Studien und auf ihren Reisen, sehen
Corot an den verschiedenen Epochen der Kunst-
geschichte, die er erlebte, erfolgreich Anteil nehmen
und sehen Troyon sich schnell als einen selbstän-
digen Meister zu einer kurzen und machtvollen
Blüte entwickeln. Der Charakter der Kunst von
beiden Malern wird sorgfältig geschildert, ihre
Hauptwerke werden beschrieben, ihre Stelle neben
Mitstrebenden findet sich bezeichnet und wenn
anderswo ihre Verdienste zu grosse Beschränkung
erfahren haben, hier gelangen sie zu voller Wür-
digung. Gensei drängt nicht seine Ansicht dem
Beschauer etwa durch gleichmässig weiterflutenden
Lobgesang auf, er gibt Tatsachen; aber dem. nach-
denklichen Leser treten aus dem Genuss des Ge-
botenen die beiden Männer vor die Seele, dieser
glückliche Corot, der wie ohne Kampf nnd ohne
innere Stürme den sanft strahlenden Frieden
seines liebreichen Herzens in landschaftlichen
Träumen voll silbernen Lichtes, voll weicher
Baumwipfel und lichter Fernen wiedergibt, der
energische Troyon, der mit sicherem Auge in das
Wesen seiner Rinder und Hunde, Schafe und
Hühner eindringt und sie als Stück des gemein-
samen Erdenlebens in grüne Gefilde und baum-
umstandene Wege einfügt. Wenn freilich ge-
lingen soll, das verbreitete Urteil über Corots
menschliche Gestalten umzustossen, wenn er in
dieser Hinsicht sogar mit Preller oder Böcklin
verglichen werden soll, dann müsste man andere
Werke als die des Louvre gesehen haben, müssten
auch andere Bilder beigebracht werden, als die des
vorliegenden Aufsatzes. Es ist in hohem Grade
anzuerkennen, dass Gensei sich von dithyram-
bischen Ergüssen über seine Helden, wie wir ihrer,
wenn es französische Künstler anging, nur zu viel
gehört haben, freihält; aber trotz seines Mass-
haltens geschieht es, dass ihm die zwei Urteile aus
der Feder fliessen, Corot sei vielleicht der aller -
grösseste Landschafter und Troyon der grösseste
Tiermaler des neunzehnten Jahrhunderts. Es liegt
ja auf der Hand, dass ein derartiger Superlativ
unberechtigt ist. Die Aufgabe des Landschafters
oder. des Tiermalers hat so mannigfaltige Seiten,
dass, wer etwa in der einen Richtung vorzügliches
leistete, noch lange nicht in jeder vollkommen ist.
Wer würde heute ohne Widerspruch bleiben,
wenn er Raffael oder Michelangelo oder Tizian
für den grössesten Menschenbildner der Re-
naissance erklären wollte? Folgen wir doch in
der Kunstschriftstellerei dem Rate der Frau von
Stael: Hüten wir uns vor Superlativen.
Otto Eg geling
Italienische Kunst.
Steinmann, E. Das Geheimnis der Medici-
Gräber. 127 S. mit 15 Tafeln und 33 Abbil-
dungen im Text. (Kunstgeschichte Mono-
graphien IV.) Hiersemann, Leipzig 1907. 12M.
Ein Geheimnis fürwahr, denn seit nahezu vier
Jahrhunderten war man unablässig bemüht, die
Lösung für die marmornen Rätsel zu finden, welche
die Skulpturen derMedici-Kapelle umschliessen, und
ihnen das Geheimnis zu entreissen, das ihr Schöpfer
in der unerbittlichen, stolzen Verschwiegenheit des
Genies mit ins Grab nahm.
Besitzen wir auch in dem berühmten Blatte
der Casa Buonarroti von 1523, in dem Antwort-
schreiben auf den Brief Fattuccis von 1526 und
der nicht vor 1545 verfassten Antwort auf das
Epigramm Giovanbattista Strozzis persönliche
Aeusserungen des Meisters über sein Werk, so
bieten diese doch keinerlei Handhabe zu einer be-
friedigenden Erklärung, obschon sich in der Deu-
tungsgeschichte der Medici-Skulpturen eine Gruppe
bemerkbar macht, die sich im wesentlichen an die
eigenen Worte des Meisters hielt nnd das Fierein-
ziehen aller ausserhalb liegenden Momente, für
einen unverantwortlichen Gewaltakt an seiner
Kunst betrachtete.
Bot sich dieser Deutergruppe in der Strophe auf
dem Blatte der Casa Buonarroti ein Stützpunkt
für ihre Erklärung der Skulpturen als einer
schmeichlerischen Huldigung für die beiden Me-