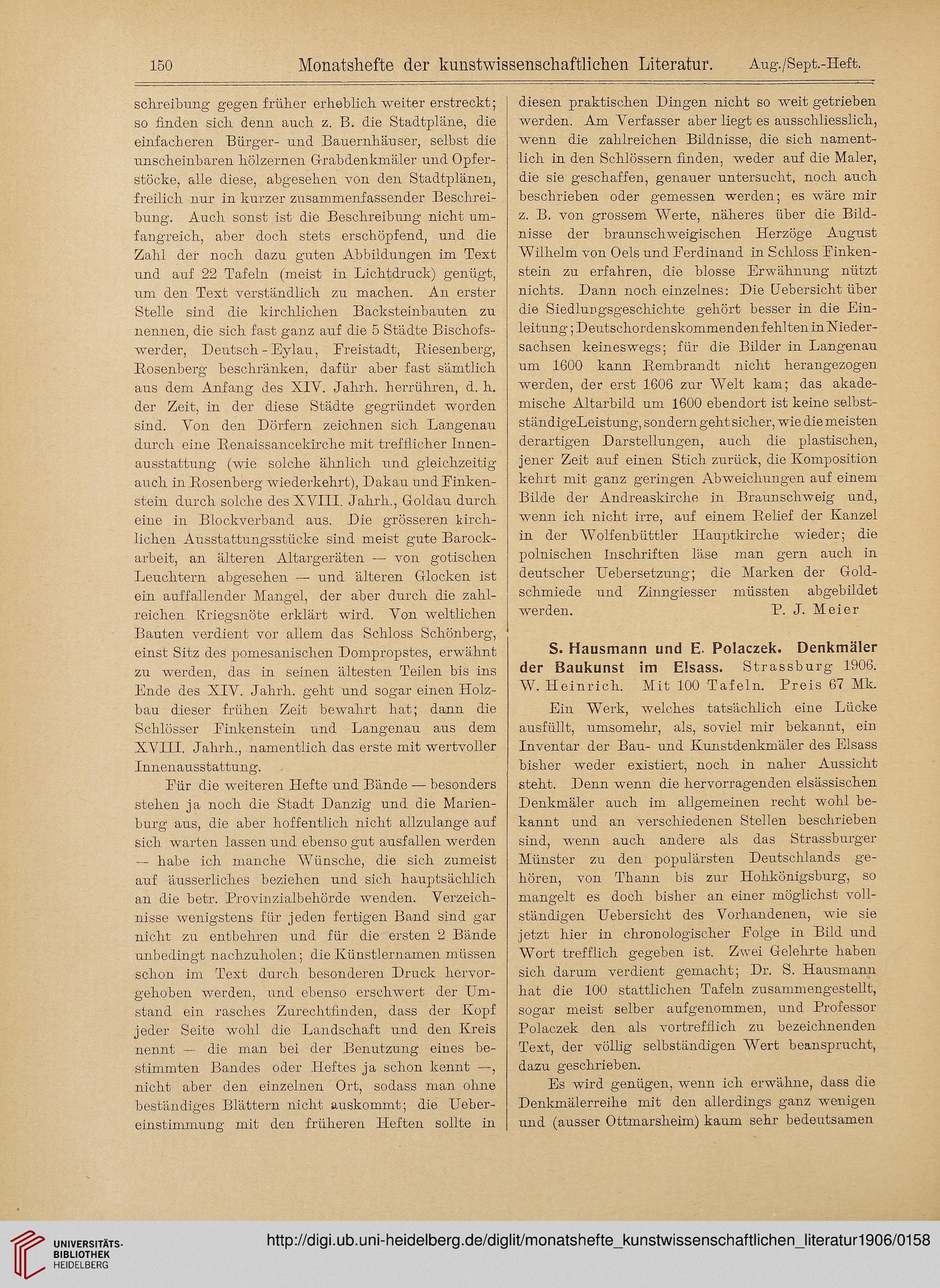150
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur. Aug./Sept.-Heft.
Schreibung gegen früher erheblich weiter erstreckt;
so finden sich denn auch z. B. die Stadtpläne, die
einfacheren Bürger- und Bauernhäuser, selbst die
unscheinbaren hölzernen Grabdenkmäler und Opfer-
stöcke, alle diese, abgesehen von den Stadtplänen,
freilich nur in kurzer zusammenfassender Beschrei-
bung. Auch sonst ist die Beschreibung nicht um-
fangreich, aber doch stets erschöpfend, und die
Zahl der noch dazu guten Abbildungen im Text
und auf 22 Tafeln (meist in Lichtdruck) genügt,
um den Text verständlich zu machen. An erster
Stelle sind die kirchlichen Backsteinbauten zu
nennen, die sich fast ganz auf die 5 Städte Bischofs-
werder, Deutsch - Eylau, Freistadt, Riesenberg,
Rosenberg beschränken, dafür aber fast sämtlich
aus dem Anfang des XIV. Jahrh. herrühren, d. h.
der Zeit, in der diese Städte gegründet worden
sind. Von den Dörfern zeichnen sich Langenau
durch eine Renaissancekirche mit trefflicher Innen-
ausstattung (wie solche ähnlich und gleichzeitig
auch in Rosenberg wiederkehrt), Dakau und Finken-
stein durch solche des XVIII. Jahrh., Goldau durch
eine in Blockverband aus. Die grösseren kirch-
lichen Ausstattungsstücke sind meist gute Barock-
arbeit, an älteren Altargeräten — von gotischen
Leuchtern abgesehen — und älteren Glocken ist
ein auffallender Mangel, der aber durch die zahl-
reichen Kriegsnöte erklärt wird. Von weltlichen
Bauten verdient vor allem das Schloss Schönberg,
einst Sitz des pomesanischen Dompropstes, erwähnt
zu werden, das in seinen ältesten Teilen bis ins
Ende des XIV. Jahrh. geht und sogar einen Holz-
bau dieser frühen Zeit bewahrt hat; dann die
Schlösser Finkenstein und Langenau aus dem
XVIII. Jahrh., namentlich das erste mit wertvoller
Innenausstattung.
Für die weiteren Hefte und Bände — besonders
stehen ja noch die Stadt Danzig und die Marien-
burg aus, die aber hoffentlich nicht allzulange auf
sich warten lassen und ebenso gut ausfallen werden
— habe ich manche Wünsche, die sich zumeist
auf äusserliches beziehen und sich hauptsächlich
an die betr. Frovinzialbehörde wenden. Verzeich-
nisse wenigstens für jeden fertigen Band sind gar
nicht zu entbehren und für die ersten 2 Bände
unbedingt nachzuholen; die Künstlernamen müssen
schon im Text durch besonderen Druck hervor-
gehoben werden, und ebenso erschwert der Um-
stand ein rasches Zurechtfinden, dass der Kopf
jeder Seite wohl die Landschaft und den Kreis
nennt — die man bei der Benutzung eines be-
stimmten Bandes oder Heftes ja schon kennt —,
nicht aber den einzelnen Ort, sodass man ohne
beständiges Blättern nicht auskommt; die Ueber-
einstimmung mit den früheren Heften sollte in
diesen praktischen Dingen nicht so weit getrieben
werden. Am Verfasser aber liegt es ausschliesslich,
wenn die zahlreichen Bildnisse, die sich nament-
lich in den Schlössern finden, weder auf die Maler,
die sie geschaffen, genauer untersucht, noch auch
beschrieben oder gemessen werden; es wäre mir
z. B. von grossem Werte, näheres über die Bild-
nisse der braunschweigischen Herzöge August
Wilhelm von Oels und Ferdinand in Schloss Finken-
stein zu erfahren, die blosse Erwähnung nützt
nichts. Dann noch einzelnes: Die üebersicht über
die Siedlungsgeschichte gehört besser in die Ein-
leitung ; Deutschordenskommend en fehlten in Nieder-
sachsen keineswegs; für die Bilder in Langenau
um 1600 kann Rembrandt nicht herangezogen
werden, der erst 1606 zur Welt kam; das akade-
mische Altarbild um 1600 ebendort ist keine se-lbst-
ständigeLeistung, sondern geht sicher, wie die meisten
derartigen Darstellungen, auch die plastischen,
jener Zeit auf einen Stich zurück, die Komposition
kehrt mit ganz geringen Abweichungen auf einem
Bilde der Andreaskirche in Braunschweig und,
wenn ich nicht irre, auf einem Relief der Kanzel
in der Wolfenbüttler Hauptkirche wieder; die
polnischen Inschriften läse man gern auch in
deutscher Uebersetzung; die Marken der Gold-
schmiede und Zinngiesser müssten abgebildet
werden. F. J. Meier
S. Hausmann und E. Polaczek. Denkmäler
der Baukunst im Elsass. Strassburg 1906.
W. Heinrich. Mit 100 Tafeln. Freis 67 Mk.
Ein Werk, welches tatsächlich eine Lücke
ausfüllt, umsomehr, als, soviel mir bekannt, ein
Inventar der Bau- und Kunstdenkmäler des Elsass
bisher weder existiert, noch in naher Aussicht
steht. Denn wenn die hervorragenden elsässischen
Denkmäler auch im allgemeinen recht wohl be-
kannt und an verschiedenen Stellen beschrieben
sind, wenn auch andere als das Strassburger
Münster zu den populärsten Deutschlands ge-
hören, von Thann bis zur Hohkönigsburg, so
mangelt es doch bisher an einer möglichst voll-
ständigen Üebersicht des Vorhandenen, wie sie
jetzt hier in chronologischer Folge in Bild und
Wort trefflich gegeben ist. Zwei Gelehrte haben
sich darum verdient gemacht; Dr. S. Hausmann
hat die 100 stattlichen Tafeln zusammengestellt,
sogar meist selber aufgenommen, und Professor
Polaczek den als vortrefflich zu bezeichnenden
Text, der völlig selbständigen Wert beansprucht,
dazu geschrieben.
Es wird genügen, wenn ich erwähne, dass die
Denkmälerreihe mit den allerdings ganz wenigen
und (äusser Ottmarsheim) kaum sehr bedeutsamen
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur. Aug./Sept.-Heft.
Schreibung gegen früher erheblich weiter erstreckt;
so finden sich denn auch z. B. die Stadtpläne, die
einfacheren Bürger- und Bauernhäuser, selbst die
unscheinbaren hölzernen Grabdenkmäler und Opfer-
stöcke, alle diese, abgesehen von den Stadtplänen,
freilich nur in kurzer zusammenfassender Beschrei-
bung. Auch sonst ist die Beschreibung nicht um-
fangreich, aber doch stets erschöpfend, und die
Zahl der noch dazu guten Abbildungen im Text
und auf 22 Tafeln (meist in Lichtdruck) genügt,
um den Text verständlich zu machen. An erster
Stelle sind die kirchlichen Backsteinbauten zu
nennen, die sich fast ganz auf die 5 Städte Bischofs-
werder, Deutsch - Eylau, Freistadt, Riesenberg,
Rosenberg beschränken, dafür aber fast sämtlich
aus dem Anfang des XIV. Jahrh. herrühren, d. h.
der Zeit, in der diese Städte gegründet worden
sind. Von den Dörfern zeichnen sich Langenau
durch eine Renaissancekirche mit trefflicher Innen-
ausstattung (wie solche ähnlich und gleichzeitig
auch in Rosenberg wiederkehrt), Dakau und Finken-
stein durch solche des XVIII. Jahrh., Goldau durch
eine in Blockverband aus. Die grösseren kirch-
lichen Ausstattungsstücke sind meist gute Barock-
arbeit, an älteren Altargeräten — von gotischen
Leuchtern abgesehen — und älteren Glocken ist
ein auffallender Mangel, der aber durch die zahl-
reichen Kriegsnöte erklärt wird. Von weltlichen
Bauten verdient vor allem das Schloss Schönberg,
einst Sitz des pomesanischen Dompropstes, erwähnt
zu werden, das in seinen ältesten Teilen bis ins
Ende des XIV. Jahrh. geht und sogar einen Holz-
bau dieser frühen Zeit bewahrt hat; dann die
Schlösser Finkenstein und Langenau aus dem
XVIII. Jahrh., namentlich das erste mit wertvoller
Innenausstattung.
Für die weiteren Hefte und Bände — besonders
stehen ja noch die Stadt Danzig und die Marien-
burg aus, die aber hoffentlich nicht allzulange auf
sich warten lassen und ebenso gut ausfallen werden
— habe ich manche Wünsche, die sich zumeist
auf äusserliches beziehen und sich hauptsächlich
an die betr. Frovinzialbehörde wenden. Verzeich-
nisse wenigstens für jeden fertigen Band sind gar
nicht zu entbehren und für die ersten 2 Bände
unbedingt nachzuholen; die Künstlernamen müssen
schon im Text durch besonderen Druck hervor-
gehoben werden, und ebenso erschwert der Um-
stand ein rasches Zurechtfinden, dass der Kopf
jeder Seite wohl die Landschaft und den Kreis
nennt — die man bei der Benutzung eines be-
stimmten Bandes oder Heftes ja schon kennt —,
nicht aber den einzelnen Ort, sodass man ohne
beständiges Blättern nicht auskommt; die Ueber-
einstimmung mit den früheren Heften sollte in
diesen praktischen Dingen nicht so weit getrieben
werden. Am Verfasser aber liegt es ausschliesslich,
wenn die zahlreichen Bildnisse, die sich nament-
lich in den Schlössern finden, weder auf die Maler,
die sie geschaffen, genauer untersucht, noch auch
beschrieben oder gemessen werden; es wäre mir
z. B. von grossem Werte, näheres über die Bild-
nisse der braunschweigischen Herzöge August
Wilhelm von Oels und Ferdinand in Schloss Finken-
stein zu erfahren, die blosse Erwähnung nützt
nichts. Dann noch einzelnes: Die üebersicht über
die Siedlungsgeschichte gehört besser in die Ein-
leitung ; Deutschordenskommend en fehlten in Nieder-
sachsen keineswegs; für die Bilder in Langenau
um 1600 kann Rembrandt nicht herangezogen
werden, der erst 1606 zur Welt kam; das akade-
mische Altarbild um 1600 ebendort ist keine se-lbst-
ständigeLeistung, sondern geht sicher, wie die meisten
derartigen Darstellungen, auch die plastischen,
jener Zeit auf einen Stich zurück, die Komposition
kehrt mit ganz geringen Abweichungen auf einem
Bilde der Andreaskirche in Braunschweig und,
wenn ich nicht irre, auf einem Relief der Kanzel
in der Wolfenbüttler Hauptkirche wieder; die
polnischen Inschriften läse man gern auch in
deutscher Uebersetzung; die Marken der Gold-
schmiede und Zinngiesser müssten abgebildet
werden. F. J. Meier
S. Hausmann und E. Polaczek. Denkmäler
der Baukunst im Elsass. Strassburg 1906.
W. Heinrich. Mit 100 Tafeln. Freis 67 Mk.
Ein Werk, welches tatsächlich eine Lücke
ausfüllt, umsomehr, als, soviel mir bekannt, ein
Inventar der Bau- und Kunstdenkmäler des Elsass
bisher weder existiert, noch in naher Aussicht
steht. Denn wenn die hervorragenden elsässischen
Denkmäler auch im allgemeinen recht wohl be-
kannt und an verschiedenen Stellen beschrieben
sind, wenn auch andere als das Strassburger
Münster zu den populärsten Deutschlands ge-
hören, von Thann bis zur Hohkönigsburg, so
mangelt es doch bisher an einer möglichst voll-
ständigen Üebersicht des Vorhandenen, wie sie
jetzt hier in chronologischer Folge in Bild und
Wort trefflich gegeben ist. Zwei Gelehrte haben
sich darum verdient gemacht; Dr. S. Hausmann
hat die 100 stattlichen Tafeln zusammengestellt,
sogar meist selber aufgenommen, und Professor
Polaczek den als vortrefflich zu bezeichnenden
Text, der völlig selbständigen Wert beansprucht,
dazu geschrieben.
Es wird genügen, wenn ich erwähne, dass die
Denkmälerreihe mit den allerdings ganz wenigen
und (äusser Ottmarsheim) kaum sehr bedeutsamen