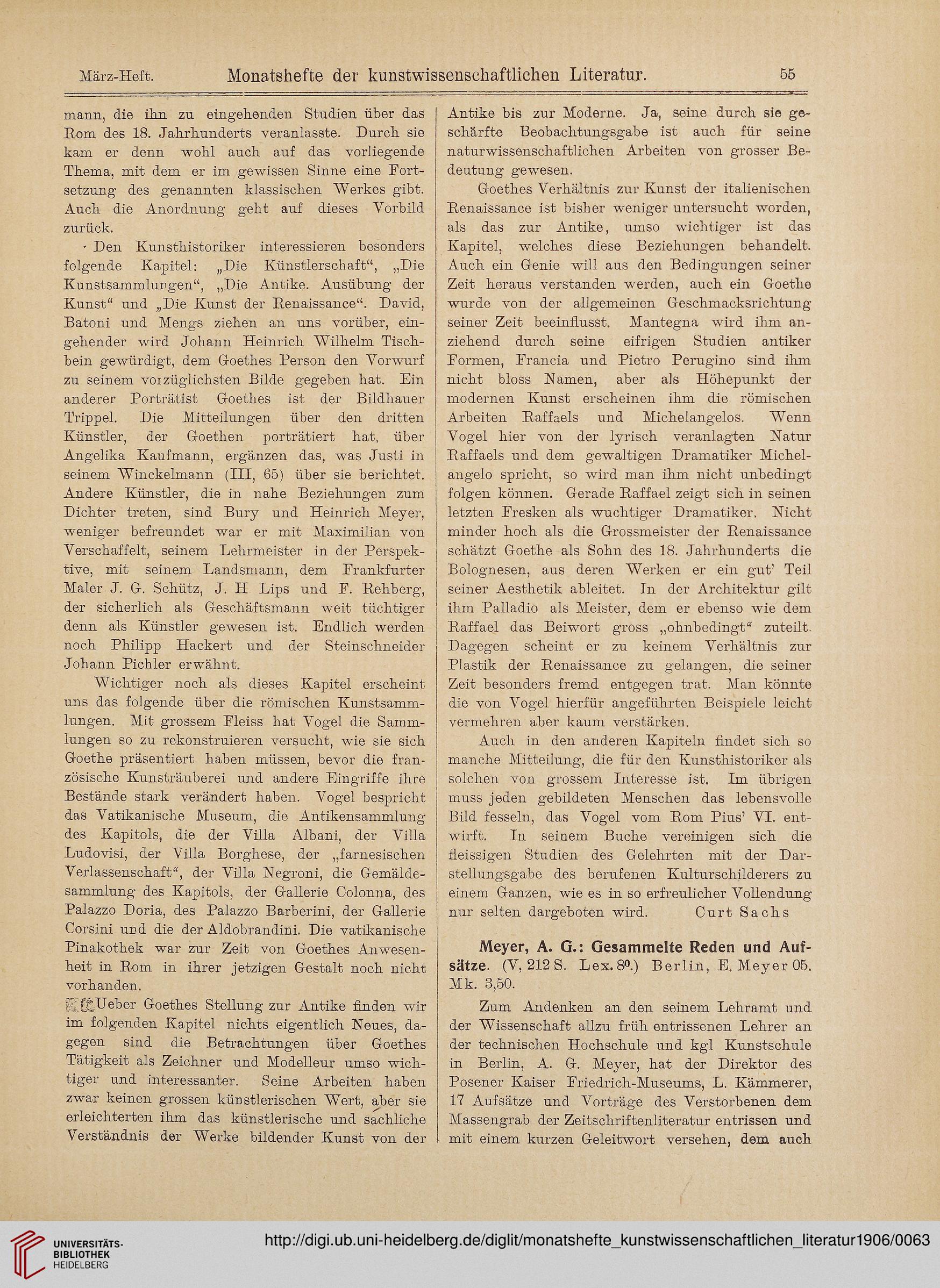März-Heft.
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
55
mann, die ihn, zu eingehenden Studien über das
Hom des 18. Jahrhunderts veranlasste. Durch sie
kam er denn wohl auch auf das vorliegende
Thema, mit dem er im gewissen Sinne eine Fort-
setzung des genannten klassischen Werkes gibt.
Auch die Anordnung geht auf dieses Vorbild
zurück.
’ Den Kunsthistoriker interessieren besonders
folgende Kapitel: „Die Künstlerschaft“, „Die
Kunstsammlungen“, „Die Antike. Ausübung der
Kunst“ und „Die Kunst der Renaissance“. David,
Batoni und Mengs ziehen an uns vorüber, ein-
gehender wird Johann Heinrich Wilhelm Tisch-
bein gewürdigt, dem Goethes Person den Vorwurf
zu seinem voi züglichsten Bilde gegeben hat. Ein
anderer Porträtist Goethes ist der Bildhauer
Trippei. Die Mitteilungen über den dritten
Künstler, der Goethen porträtiert hat, über
Angelika Kaufmann, ergänzen das, was Justi in
seinem Winckelmann (III, 65) über sie berichtet.
Andere Künstler, die in nahe Beziehungen zum
Dichter treten, sind Bury und Heinrich Meyer,
weniger befreundet war er mit Maximilian von
Verschaffelt, seinem Lehrmeister in der Perspek-
tive, mit seinem Landsmann, dem Frankfurter
Maler J. G. Schütz, J. H Lips und F. Rehberg,
der sicherlich als Geschäftsmann weit tüchtiger
denn als Künstler gewesen ist. Endlich werden
noch Philipp Hackert und der Steinschneider
Johann Pichler erwähnt.
Wichtiger noch als dieses Kapitel erscheint
uns das folgende über die römischen Kunstsamm-
lungen. Mit grossem Fleiss hat Vogel die Samm-
lungen so zu rekonstruieren versucht, wie sie sich
Goethe präsentiert haben müssen, bevor die fran-
zösische Kunsträuberei und andere Eingriffe ihre
Bestände stark verändert haben. Vogel bespricht
das Vatikanische Museum, die Antikensammlung
des Kapitols, die der Villa Albani, der Villa
Ludovisi, der Villa Borghese, der „farnesischen
Verlassenschaft“, der Villa Negroni, die Gemälde-
sammlung’ des Kapitols, der Gallerie Colonna, des
Palazzo Doria, des Palazzo Barberini, der Gallerie
Corsini und die der Aldobrandini. Die vatikanische
Pinakothek war zur Zeit von Goethes A n wesen -
heit in Rom in ihrer jetzigen Gestalt noch nicht
vorhanden.
££$Ueber Goethes Stellung zur Antike finden wir
im folgenden Kapitel nichts eigentlich Neues, da-
gegen sind die Betrachtungen über Goethes
Tätigkeit als Zeichner und Modelleur umso wich-
tiger und interessanter. Seine Arbeiten haben
zwar keinen grossen künstlerischen Wert, aber sie
erleichterten ihm das künstlerische und sachliche
Verständnis der Werke bildender Kunst von der
Antike bis zur Moderne. Ja, seine durch sie ge-
schärfte Beobachtungsgabe ist auch für seine
naturwissenschaftlichen Arbeiten von grosser Be-
deutung gewesen.
Goethes Verhältnis zur Kunst der italienischen
Renaissance ist bisher weniger untersucht worden,
als das zur Antike, umso wichtiger ist das
Kapitel, welches diese Beziehungen behandelt.
Auch ein Genie will aus den Bedingungen seiner
Zeit heraus verstanden werden, auch ein Goethe
wurde von der allgemeinen Geschmacksrichtung
seiner Zeit beeinflusst. Mantegna wird ihm an-
ziehend durch seine eifrigen Studien antiker
Formen, Francia und Pietro Perugino sind ihm
nicht bloss Namen, aber als Höhepunkt der
modernen Kunst erscheinen ihm die römischen
Arbeiten Raffaels und Michelangelos. Wenn
Vogel hier von der lyrisch veranlagten Natur
Raffaels und dem gewaltigen Dramatiker Michel-
angelo spricht, so wird man ihm nicht unbedingt
folgen können. Gerade Raffael zeigt sich in seinen
letzten Fresken als wuchtiger Dramatiker. Nicht
minder hoch als die Grossmeister der Renaissance
schätzt Goethe als Sohn des 18. Jahrhunderts die
Bolognesen, aus deren Werken er ein gut’ Teil
seiner Aesthetik ableitet. In der Architektur gilt
ihm Palladio als Meister, dem er ebenso wie dem
Raffael das Beiwort gross „ohnbedingt“ zuteilt.
Dagegen scheint er zu keinem Verhältnis zur
Plastik der Renaissance zu gelangen, die seiner
Zeit besonders fremd entgegen trat. Man könnte
die von Vogel hierfür angeführten Beispiele leicht
vermehren aber kaum verstärken.
Auch in den anderen Kapiteln findet sich so
manche Mitteilung, die für den Kunsthistoriker als
solchen von grossem Interesse ist. Im übrigen
muss jeden gebildeten Menschen das lebensvolle
Bild fesseln, das Vogel vom Rom Pius’ VI. ent-
wirft. In seinem Buche vereinigen sich die
fleissigen Studien des Gelehrten mit der Dar-
stellungsgabe des berufenen Kulturschilderers zu
einem Ganzen, wie es in so erfreulicher Vollendung
nur selten dargeboten wird. Curt Sachs
Meyer, A. G.: Gesammelte Reden und Auf-
sätze. (V, 212 S. Lex. 8°.) Berlin, E. Meyer 05.
Mk. 3,50.
Zum Andenken an den seinem Lehramt und
der Wissenschaft allzu früh entrissenen Lehrer an
der technischen Hochschule und kgl Kunstschule
in Berlin, A. G. Meyer, hat der Direktor des
Posener Kaiser Friedrich-Museums, L. Kämmerer,
17 Aufsätze und Vorträge des Verstorbenen dem
Massengrab der Zeitschriftenliteratur entrissen und
mit einem kurzen Geleitwort versehen, dem auch
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
55
mann, die ihn, zu eingehenden Studien über das
Hom des 18. Jahrhunderts veranlasste. Durch sie
kam er denn wohl auch auf das vorliegende
Thema, mit dem er im gewissen Sinne eine Fort-
setzung des genannten klassischen Werkes gibt.
Auch die Anordnung geht auf dieses Vorbild
zurück.
’ Den Kunsthistoriker interessieren besonders
folgende Kapitel: „Die Künstlerschaft“, „Die
Kunstsammlungen“, „Die Antike. Ausübung der
Kunst“ und „Die Kunst der Renaissance“. David,
Batoni und Mengs ziehen an uns vorüber, ein-
gehender wird Johann Heinrich Wilhelm Tisch-
bein gewürdigt, dem Goethes Person den Vorwurf
zu seinem voi züglichsten Bilde gegeben hat. Ein
anderer Porträtist Goethes ist der Bildhauer
Trippei. Die Mitteilungen über den dritten
Künstler, der Goethen porträtiert hat, über
Angelika Kaufmann, ergänzen das, was Justi in
seinem Winckelmann (III, 65) über sie berichtet.
Andere Künstler, die in nahe Beziehungen zum
Dichter treten, sind Bury und Heinrich Meyer,
weniger befreundet war er mit Maximilian von
Verschaffelt, seinem Lehrmeister in der Perspek-
tive, mit seinem Landsmann, dem Frankfurter
Maler J. G. Schütz, J. H Lips und F. Rehberg,
der sicherlich als Geschäftsmann weit tüchtiger
denn als Künstler gewesen ist. Endlich werden
noch Philipp Hackert und der Steinschneider
Johann Pichler erwähnt.
Wichtiger noch als dieses Kapitel erscheint
uns das folgende über die römischen Kunstsamm-
lungen. Mit grossem Fleiss hat Vogel die Samm-
lungen so zu rekonstruieren versucht, wie sie sich
Goethe präsentiert haben müssen, bevor die fran-
zösische Kunsträuberei und andere Eingriffe ihre
Bestände stark verändert haben. Vogel bespricht
das Vatikanische Museum, die Antikensammlung
des Kapitols, die der Villa Albani, der Villa
Ludovisi, der Villa Borghese, der „farnesischen
Verlassenschaft“, der Villa Negroni, die Gemälde-
sammlung’ des Kapitols, der Gallerie Colonna, des
Palazzo Doria, des Palazzo Barberini, der Gallerie
Corsini und die der Aldobrandini. Die vatikanische
Pinakothek war zur Zeit von Goethes A n wesen -
heit in Rom in ihrer jetzigen Gestalt noch nicht
vorhanden.
££$Ueber Goethes Stellung zur Antike finden wir
im folgenden Kapitel nichts eigentlich Neues, da-
gegen sind die Betrachtungen über Goethes
Tätigkeit als Zeichner und Modelleur umso wich-
tiger und interessanter. Seine Arbeiten haben
zwar keinen grossen künstlerischen Wert, aber sie
erleichterten ihm das künstlerische und sachliche
Verständnis der Werke bildender Kunst von der
Antike bis zur Moderne. Ja, seine durch sie ge-
schärfte Beobachtungsgabe ist auch für seine
naturwissenschaftlichen Arbeiten von grosser Be-
deutung gewesen.
Goethes Verhältnis zur Kunst der italienischen
Renaissance ist bisher weniger untersucht worden,
als das zur Antike, umso wichtiger ist das
Kapitel, welches diese Beziehungen behandelt.
Auch ein Genie will aus den Bedingungen seiner
Zeit heraus verstanden werden, auch ein Goethe
wurde von der allgemeinen Geschmacksrichtung
seiner Zeit beeinflusst. Mantegna wird ihm an-
ziehend durch seine eifrigen Studien antiker
Formen, Francia und Pietro Perugino sind ihm
nicht bloss Namen, aber als Höhepunkt der
modernen Kunst erscheinen ihm die römischen
Arbeiten Raffaels und Michelangelos. Wenn
Vogel hier von der lyrisch veranlagten Natur
Raffaels und dem gewaltigen Dramatiker Michel-
angelo spricht, so wird man ihm nicht unbedingt
folgen können. Gerade Raffael zeigt sich in seinen
letzten Fresken als wuchtiger Dramatiker. Nicht
minder hoch als die Grossmeister der Renaissance
schätzt Goethe als Sohn des 18. Jahrhunderts die
Bolognesen, aus deren Werken er ein gut’ Teil
seiner Aesthetik ableitet. In der Architektur gilt
ihm Palladio als Meister, dem er ebenso wie dem
Raffael das Beiwort gross „ohnbedingt“ zuteilt.
Dagegen scheint er zu keinem Verhältnis zur
Plastik der Renaissance zu gelangen, die seiner
Zeit besonders fremd entgegen trat. Man könnte
die von Vogel hierfür angeführten Beispiele leicht
vermehren aber kaum verstärken.
Auch in den anderen Kapiteln findet sich so
manche Mitteilung, die für den Kunsthistoriker als
solchen von grossem Interesse ist. Im übrigen
muss jeden gebildeten Menschen das lebensvolle
Bild fesseln, das Vogel vom Rom Pius’ VI. ent-
wirft. In seinem Buche vereinigen sich die
fleissigen Studien des Gelehrten mit der Dar-
stellungsgabe des berufenen Kulturschilderers zu
einem Ganzen, wie es in so erfreulicher Vollendung
nur selten dargeboten wird. Curt Sachs
Meyer, A. G.: Gesammelte Reden und Auf-
sätze. (V, 212 S. Lex. 8°.) Berlin, E. Meyer 05.
Mk. 3,50.
Zum Andenken an den seinem Lehramt und
der Wissenschaft allzu früh entrissenen Lehrer an
der technischen Hochschule und kgl Kunstschule
in Berlin, A. G. Meyer, hat der Direktor des
Posener Kaiser Friedrich-Museums, L. Kämmerer,
17 Aufsätze und Vorträge des Verstorbenen dem
Massengrab der Zeitschriftenliteratur entrissen und
mit einem kurzen Geleitwort versehen, dem auch