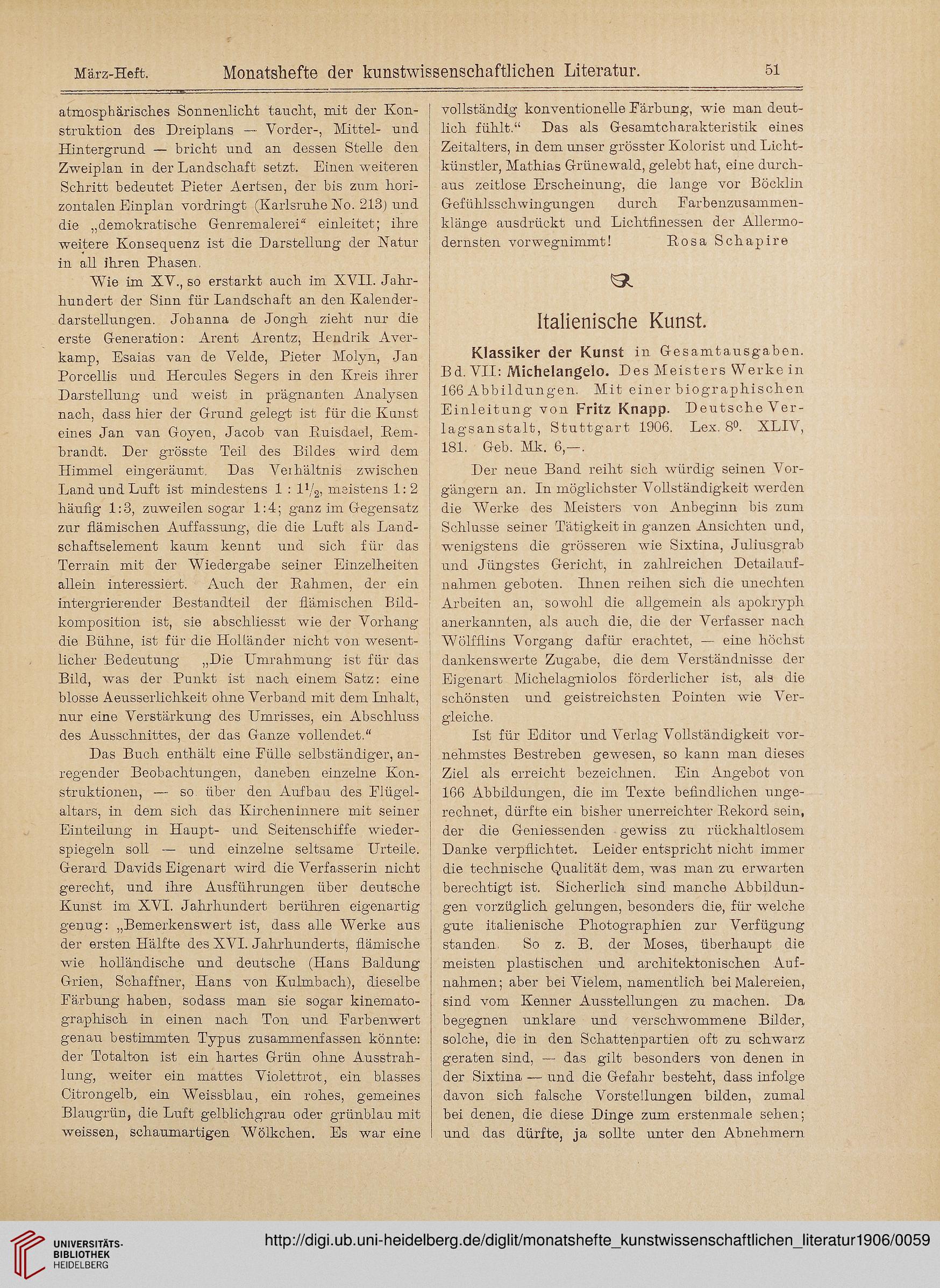März-Heft.
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
51
atmosphärisches Sonnenlicht taucht, mit der Kon-
struktion des Dreiplans — Vorder-, Mittel- und
Hintergrund — bricht und an dessen Stelle den
Zweiplan in der Landschaft setzt. Einen weiteren
Schritt bedeutet Pieter Aertsen, der bis zum hori-
zontalen Einplan vordringt (Karlsruhe No. 213) und
die „demokratische Genremalerei“ einleitet; ihre
weitere Konsequenz ist die Darstellung der Natur
in all ihren Phasen.
Wie im XV., so erstarkt auch im XVII. Jahr-
hundert der Sinn für Landschaft an den Kalender-
darstellungen. Johanna de Jongh zieht nur die
erste Generation: Arent Arentz, Hendrik Aver-
kamp, Esaias van de Velde, Pieter Molyn, Jan
Porcellis und Hercules Segers in den Kreis ihrer
Darstellung und weist in prägnanten Analysen
nach, dass hier der Grund gelegt ist für die Kunst
eines Jan van Goyen, Jacob van Ruisdael, Rem-
brandt. Der grösste Teil des Bildes wird dem
Himmel eingeräumt. Das Verhältnis zwischen
Land und Luft ist mindestens 1 : l1,^, meistens 1: 2
häufig 1:3, zuweilen sogar 1:4; ganz im Gegensatz
zur flämischen Auffassung, die die Luft als Land-
schaftselement kaum kennt und sich für das
Terrain mit der Wiedergabe seiner Einzelheiten
allein interessiert. Auch der Rahmen, der ein
intergrierender Bestandteil der flämischen Bild-
komposition ist, sie ab schliesst wie der Vorhang
die Bühne, ist für die Holländer nicht von wesent-
licher Bedeutung „Die Umrahmung ist für das
Bild, was der Punkt ist nach einem Satz: eine
blosse Aeusserlichkeit ohne Verband mit dem Inhalt,
nur eine Verstärkung des Umrisses, ein Abschluss
des Ausschnittes, der das Ganze vollendet.“
Das Buch enthält eine Fülle selbständiger, an-
regender Beobachtungen, daneben einzelne Kon-
struktionen, — so. über den Aufbau des Flügel-
altars, in dem sich das Kircheninnere mit seiner
Einteilung in Haupt- und Seitenschiffe wieder-
spiegeln soll — und einzelne seltsame Urteile.
Gerard Davids Eigenart wird die Verfasserin nicht
gerecht, und ihre Ausführungen über deutsche
Kunst im XVI. Jahrhundert berühren eigenartig
genug: „Bemerkenswert ist, dass alle Werke aus
der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts, flämische
wie holländische und deutsche (Hans Baldung
Grien, Schaffner, Hans von Kulmbach), dieselbe
Färbung haben, sodass man sie sogar kinemato-
graphisch in einen nach Ton und Farbenwert
genau bestimmten Typus zusammenfassen könnte:
der Totalton ist ein hartes Grün ohne Ausstrah-
lung, weiter ein mattes Violettrot, ein blasses
Citrongelb, ein Weissblau, ein rohes, gemeines
Blaugrün, die Luft gelblichgrau oder grünblau mit
weissen, schaumartigen Wölkchen. Es war eine
vollständig konventionelle Färbung, wie man deut-
lich fühlt.“ Das als Gesamtcharakteristik eines
Zeitalters, in dem unser grösster Kolorist und Licht-
künstler, Mathias Grünewald, gelebt hat, eine durch-
aus zeitlose Erscheinung, die lange vor Böcklin
Gefühlsschwingungen durch Farbenzusammen-
klänge ausdrückt und Lichtfinessen der Allermo-
dernsten vorwegnimmt! Rosa Schapire
<91
Italienische Kunst.
Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben.
Bd. VII: Michelangelo. Des Meisters Werke in
166 Abbildungen. Mit einer biographischen
Einleitung von Fritz Knapp. Deutsche Ver-
lagsanstalt, Stuttgart 1906. Lex. 8°. XLIV,
181. Geb. Mk. 6,—.
Der neue Band reiht sich würdig seinen Vor-
gängern an. In möglichster Vollständigkeit werden
die Werke des Meisters von Anbeginn bis zum
Schlüsse seiner Tätigkeit in ganzen Ansichten und,
wenigstens die grösseren wie Sixtina, Juliusgrab
und Jüngstes Gericht, in zahlreichen Detailauf-
nahmen geboten. Ihnen reihen sich die unechten
Arbeiten an, sowohl die allgemein als apokryph
anerkannten, als auch die, die der Verfasser nach
Wölfflins Vorgang dafür erachtet, — eine höchst
dankenswerte Zugabe, die dem Verständnisse der
Eigenart Michelagniolos förderlicher ist, als die
schönsten und geistreichsten Pointen wie Ver-
gleiche.
Ist für Editor und Verlag Vollständigkeit vor-
nehmstes Bestreben gewesen, so kann man dieses
Ziel als erreicht bezeichnen. Ein Angebot von
166 Abbildungen, die im Texte befindlichen unge-
rechnet, dürfte ein bisher unerreichter Rekord sein,
der die Geniessenden gewiss zu rückhaltlosem
Danke verpflichtet. Leider entspricht nicht immer
die technische Qualität dem, was man zu erwarten
berechtigt ist. Sicherlich sind manche Abbildun-
gen vorzüglich gelungen, besonders die, für welche
gute italienische Photographien zur Verfügung
standen So z. B. der Moses, überhaupt die
meisten plastischen und architektonischen Auf-
nahmen; aber bei Vielem, namentlich bei Malereien,
sind vom Kenner Ausstellungen zu machen. Da
begegnen unklare und verschwommene Bilder,
solche, die in den Schattenpartien oft zu schwarz
geraten sind, — das gilt besonders von denen in
der Sixtina — und die Gefahr besteht, dass infolge
davon sich falsche Vorstellungen bilden, zumal
bei denen, die diese Dinge zum erstenmale sehen;
und das dürfte, ja sollte unter den Abnehmern
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
51
atmosphärisches Sonnenlicht taucht, mit der Kon-
struktion des Dreiplans — Vorder-, Mittel- und
Hintergrund — bricht und an dessen Stelle den
Zweiplan in der Landschaft setzt. Einen weiteren
Schritt bedeutet Pieter Aertsen, der bis zum hori-
zontalen Einplan vordringt (Karlsruhe No. 213) und
die „demokratische Genremalerei“ einleitet; ihre
weitere Konsequenz ist die Darstellung der Natur
in all ihren Phasen.
Wie im XV., so erstarkt auch im XVII. Jahr-
hundert der Sinn für Landschaft an den Kalender-
darstellungen. Johanna de Jongh zieht nur die
erste Generation: Arent Arentz, Hendrik Aver-
kamp, Esaias van de Velde, Pieter Molyn, Jan
Porcellis und Hercules Segers in den Kreis ihrer
Darstellung und weist in prägnanten Analysen
nach, dass hier der Grund gelegt ist für die Kunst
eines Jan van Goyen, Jacob van Ruisdael, Rem-
brandt. Der grösste Teil des Bildes wird dem
Himmel eingeräumt. Das Verhältnis zwischen
Land und Luft ist mindestens 1 : l1,^, meistens 1: 2
häufig 1:3, zuweilen sogar 1:4; ganz im Gegensatz
zur flämischen Auffassung, die die Luft als Land-
schaftselement kaum kennt und sich für das
Terrain mit der Wiedergabe seiner Einzelheiten
allein interessiert. Auch der Rahmen, der ein
intergrierender Bestandteil der flämischen Bild-
komposition ist, sie ab schliesst wie der Vorhang
die Bühne, ist für die Holländer nicht von wesent-
licher Bedeutung „Die Umrahmung ist für das
Bild, was der Punkt ist nach einem Satz: eine
blosse Aeusserlichkeit ohne Verband mit dem Inhalt,
nur eine Verstärkung des Umrisses, ein Abschluss
des Ausschnittes, der das Ganze vollendet.“
Das Buch enthält eine Fülle selbständiger, an-
regender Beobachtungen, daneben einzelne Kon-
struktionen, — so. über den Aufbau des Flügel-
altars, in dem sich das Kircheninnere mit seiner
Einteilung in Haupt- und Seitenschiffe wieder-
spiegeln soll — und einzelne seltsame Urteile.
Gerard Davids Eigenart wird die Verfasserin nicht
gerecht, und ihre Ausführungen über deutsche
Kunst im XVI. Jahrhundert berühren eigenartig
genug: „Bemerkenswert ist, dass alle Werke aus
der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts, flämische
wie holländische und deutsche (Hans Baldung
Grien, Schaffner, Hans von Kulmbach), dieselbe
Färbung haben, sodass man sie sogar kinemato-
graphisch in einen nach Ton und Farbenwert
genau bestimmten Typus zusammenfassen könnte:
der Totalton ist ein hartes Grün ohne Ausstrah-
lung, weiter ein mattes Violettrot, ein blasses
Citrongelb, ein Weissblau, ein rohes, gemeines
Blaugrün, die Luft gelblichgrau oder grünblau mit
weissen, schaumartigen Wölkchen. Es war eine
vollständig konventionelle Färbung, wie man deut-
lich fühlt.“ Das als Gesamtcharakteristik eines
Zeitalters, in dem unser grösster Kolorist und Licht-
künstler, Mathias Grünewald, gelebt hat, eine durch-
aus zeitlose Erscheinung, die lange vor Böcklin
Gefühlsschwingungen durch Farbenzusammen-
klänge ausdrückt und Lichtfinessen der Allermo-
dernsten vorwegnimmt! Rosa Schapire
<91
Italienische Kunst.
Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben.
Bd. VII: Michelangelo. Des Meisters Werke in
166 Abbildungen. Mit einer biographischen
Einleitung von Fritz Knapp. Deutsche Ver-
lagsanstalt, Stuttgart 1906. Lex. 8°. XLIV,
181. Geb. Mk. 6,—.
Der neue Band reiht sich würdig seinen Vor-
gängern an. In möglichster Vollständigkeit werden
die Werke des Meisters von Anbeginn bis zum
Schlüsse seiner Tätigkeit in ganzen Ansichten und,
wenigstens die grösseren wie Sixtina, Juliusgrab
und Jüngstes Gericht, in zahlreichen Detailauf-
nahmen geboten. Ihnen reihen sich die unechten
Arbeiten an, sowohl die allgemein als apokryph
anerkannten, als auch die, die der Verfasser nach
Wölfflins Vorgang dafür erachtet, — eine höchst
dankenswerte Zugabe, die dem Verständnisse der
Eigenart Michelagniolos förderlicher ist, als die
schönsten und geistreichsten Pointen wie Ver-
gleiche.
Ist für Editor und Verlag Vollständigkeit vor-
nehmstes Bestreben gewesen, so kann man dieses
Ziel als erreicht bezeichnen. Ein Angebot von
166 Abbildungen, die im Texte befindlichen unge-
rechnet, dürfte ein bisher unerreichter Rekord sein,
der die Geniessenden gewiss zu rückhaltlosem
Danke verpflichtet. Leider entspricht nicht immer
die technische Qualität dem, was man zu erwarten
berechtigt ist. Sicherlich sind manche Abbildun-
gen vorzüglich gelungen, besonders die, für welche
gute italienische Photographien zur Verfügung
standen So z. B. der Moses, überhaupt die
meisten plastischen und architektonischen Auf-
nahmen; aber bei Vielem, namentlich bei Malereien,
sind vom Kenner Ausstellungen zu machen. Da
begegnen unklare und verschwommene Bilder,
solche, die in den Schattenpartien oft zu schwarz
geraten sind, — das gilt besonders von denen in
der Sixtina — und die Gefahr besteht, dass infolge
davon sich falsche Vorstellungen bilden, zumal
bei denen, die diese Dinge zum erstenmale sehen;
und das dürfte, ja sollte unter den Abnehmern