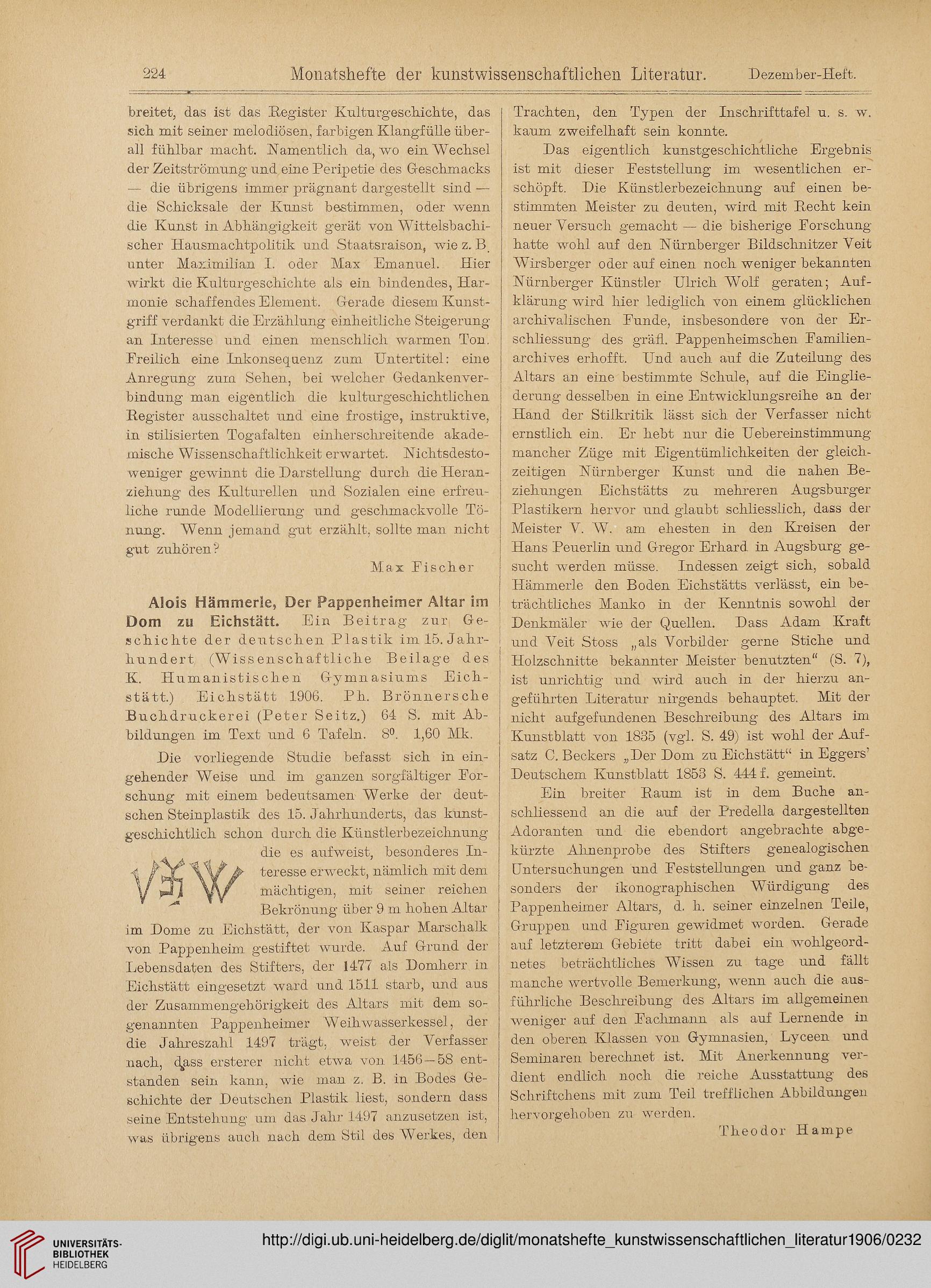224 Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur. Dezember-Heft.
breitet, das ist das Register Kulturgeschichte, das
sich mit seiner melodiösen, farbigen Klangfülle über-
all fühlbar macht. Namentlich da, wo ein Wechsel
der Zeitströmung und eine Peripetie des Geschmacks
— die übrigens immer prägnant dargestellt sind —
die Schicksale der Kunst bestimmen, oder wenn
die Kunst in Abhängigkeit gerät von Wittelsbachi-
scher Hausmachtpolitik und Staatsraison, wiez. B
unter Maximilian I. oder Max Emanuel. Hier
wirkt die Kulturgeschichte als ein bindendes, Har-
monie schaffendes Element. Gerade diesem Kunst-
griff verdankt die Erzählung einheitliche Steigerung
an Interesse und einen menschlich warmen Ton.
Freilich eine Inkonsequenz zum Untertitel: eine
Anregung zum Sehen, bei welcher Gedankenver-
bindung man eigentlich die kulturgeschichtlichen
Register ausschaltet und eine frostige, instruktive,
in stilisierten Togafalten einherschreitende akade-
mische Wissenschaftlichkeit erwartet. Nichtsdesto-
weniger- gewinnt die Darstellung durch die Heran-
ziehung des Kulturellen und Sozialen eine erfreu-
liche runde Modellierung und geschmackvolle Tö-
nung. Wenn jemand gut erzählt, sollte man nicht |
gut zuhören'?
Max Fischer i
Alois Hämmerle, Der Pappenheimer Altar im
Dom zu Eichstätt. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der deutschen Plastik im 15. Jahr-
hundert (Wissenschaftliche Beilage des
K. Humanistischen Gymnasiums Eich-
stätt.) Eichstätt 1906. Ph. Brönnersche
Buchdruckerei (Peter Seitz.) 64 S. mit Ab-
bildungen im Text und 6 Tafeln. 8°. 1,60 Mk,
Die vorliegende Studie befasst sich in ein-
gehender Weise und im ganzen sorgfältiger For-
schung mit einem bedeutsamen Werke der deut-
schen Steinplastik des 15. Jahrhunderts, das kunst-
geschichtlich schon durch die Künstlerbezeichnung
. , ( die es aufweist, besonderes In-
/ / teresse erweckt, nämlich mit dem
y jU j mächtigen, mit seiner reichen
Bekrönung über 9 m hohen Altar
im Dome zu Eichstätt, der von Kaspar Marschalk
von Pappenheim gestiftet wurde. Auf Grund der
Lebensdaten des Stifters, der 1477 als Domherr in
Eichstätt eingesetzt ward und 1511 starb, und aus
der Zusammengehörigkeit des Altars mit dem so-
genannten Pappenheimer Weihwasserkessel, der
die Jahreszahl 1497 trägt, weist der Verfasser
nach, d^ass ersterer nicht etwa von 1456 — 58 ent-
standen sein kann, wie man z. B. in Bodes Ge-
schichte der Deutschen Plastik liest, sondern dass
seine Entstehung um das Jahr 1497 anzusetzen ist,
was übrigens auch nach dem Stil des Werkes, den
Trachten, den Typen der Inschrifttafel u. s. w.
kaum zweifelhaft sein konnte.
Das eigentlich kunstgeschichtliche Ergebnis
ist mit dieser Feststellung im wesentlichen er-
schöpft. Die Künstlerbezeichnung auf einen be-
stimmten Meister zu deuten, wird mit Recht kein
neuer Versuch gemacht — die bisherige Forschung
hatte wohl auf den Nürnberger Bildschnitzer Veit
Wirsberger oder auf einen noch weniger bekannten
Nürnberger Künstler Ulrich Wolf geraten; Auf-
klärung wird liier lediglich von einem glücklichen
archivalischen Funde, insbesondere von der Er-
schliessung des gräfl. Pappenheimschen Familien-
archives erhofft. Und auch auf die Zuteilung des
Altars an eine bestimmte Schule, auf die Einglie-
derung desselben in eine Entwicklungsreihe an der
Hand der Stilkritik lässt sich der Verfasser nicht
ernstlich ein. Er hebt nur die Uebereinstimmung
mancher Züge mit Eigentümlichkeiten der gleich-
zeitigen Nürnberger Kunst und die nahen Be-
ziehungen Eichstätts zu mehreren Augsburger
Plastikern hervor und glaubt schliesslich, dass der
Meister V. W. am ehesten in den Kreisen der
Hans Peuerlin und Gregor Erhard in Augsburg ge-
sucht werden müsse. Indessen zeigt sich, sobald
Hämmerle den Boden Eichstätts verlässt, ein be-
trächtliches Manko in der Kenntnis sowohl der
Denkmäler wie der- Quellen. Dass Adam Kraft
und Veit Stoss „als Vorbilder gerne Stiche und
Holzschnitte bekannter Meister benutzten“ (S. 7),
ist unrichtig und wird auch in der- hierzu an-
geführten Literatur nirgends behauptet. Mit der
nicht aufgefundenen Beschreibung des Altars im
Kunstblatt von 1835 (vgl. S. 49) ist wohl der Auf-
satz C. Beckers „Der Dom zu Eichstätt“ in Eggers'
Deutschem Kunstblatt 1853 S. 444 f. gemeint.
Ein breiter Raum ist in dem Buche an-
schliessend an die auf der Predella dargestellten
Adoranten und die ebendort angebrachte abge-
kürzte Ahnenprobe des Stifters genealogischen
Untersuchungen und Feststellungen und ganz be-
sonders der ikonographischen Würdigung des
Pappenheimer Altars, d. h. seiner einzelnen Teile,
Gruppen und Figuren gewidmet worden. Gerade
auf letzterem Gebiete tritt dabei ein wohlgeord-
netes beträchtliches Wissen zu tage und fällt
manche wertvolle Bemerkung, wenn auch die aus-
führliche Beschreibung des Altars im allgemeinen
weniger auf den Fachmann als auf Lernende in
den oberen Klassen von Gymnasien, Lyceen und
Seminaren berechnet ist. Mit Anerkennung ver-
dient endlich noch die reiche Ausstattung des
Schriftchens mit zum Teil trefflichen Abbildungen
hervorgehoben zu werden.
Theodor Hampe
breitet, das ist das Register Kulturgeschichte, das
sich mit seiner melodiösen, farbigen Klangfülle über-
all fühlbar macht. Namentlich da, wo ein Wechsel
der Zeitströmung und eine Peripetie des Geschmacks
— die übrigens immer prägnant dargestellt sind —
die Schicksale der Kunst bestimmen, oder wenn
die Kunst in Abhängigkeit gerät von Wittelsbachi-
scher Hausmachtpolitik und Staatsraison, wiez. B
unter Maximilian I. oder Max Emanuel. Hier
wirkt die Kulturgeschichte als ein bindendes, Har-
monie schaffendes Element. Gerade diesem Kunst-
griff verdankt die Erzählung einheitliche Steigerung
an Interesse und einen menschlich warmen Ton.
Freilich eine Inkonsequenz zum Untertitel: eine
Anregung zum Sehen, bei welcher Gedankenver-
bindung man eigentlich die kulturgeschichtlichen
Register ausschaltet und eine frostige, instruktive,
in stilisierten Togafalten einherschreitende akade-
mische Wissenschaftlichkeit erwartet. Nichtsdesto-
weniger- gewinnt die Darstellung durch die Heran-
ziehung des Kulturellen und Sozialen eine erfreu-
liche runde Modellierung und geschmackvolle Tö-
nung. Wenn jemand gut erzählt, sollte man nicht |
gut zuhören'?
Max Fischer i
Alois Hämmerle, Der Pappenheimer Altar im
Dom zu Eichstätt. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der deutschen Plastik im 15. Jahr-
hundert (Wissenschaftliche Beilage des
K. Humanistischen Gymnasiums Eich-
stätt.) Eichstätt 1906. Ph. Brönnersche
Buchdruckerei (Peter Seitz.) 64 S. mit Ab-
bildungen im Text und 6 Tafeln. 8°. 1,60 Mk,
Die vorliegende Studie befasst sich in ein-
gehender Weise und im ganzen sorgfältiger For-
schung mit einem bedeutsamen Werke der deut-
schen Steinplastik des 15. Jahrhunderts, das kunst-
geschichtlich schon durch die Künstlerbezeichnung
. , ( die es aufweist, besonderes In-
/ / teresse erweckt, nämlich mit dem
y jU j mächtigen, mit seiner reichen
Bekrönung über 9 m hohen Altar
im Dome zu Eichstätt, der von Kaspar Marschalk
von Pappenheim gestiftet wurde. Auf Grund der
Lebensdaten des Stifters, der 1477 als Domherr in
Eichstätt eingesetzt ward und 1511 starb, und aus
der Zusammengehörigkeit des Altars mit dem so-
genannten Pappenheimer Weihwasserkessel, der
die Jahreszahl 1497 trägt, weist der Verfasser
nach, d^ass ersterer nicht etwa von 1456 — 58 ent-
standen sein kann, wie man z. B. in Bodes Ge-
schichte der Deutschen Plastik liest, sondern dass
seine Entstehung um das Jahr 1497 anzusetzen ist,
was übrigens auch nach dem Stil des Werkes, den
Trachten, den Typen der Inschrifttafel u. s. w.
kaum zweifelhaft sein konnte.
Das eigentlich kunstgeschichtliche Ergebnis
ist mit dieser Feststellung im wesentlichen er-
schöpft. Die Künstlerbezeichnung auf einen be-
stimmten Meister zu deuten, wird mit Recht kein
neuer Versuch gemacht — die bisherige Forschung
hatte wohl auf den Nürnberger Bildschnitzer Veit
Wirsberger oder auf einen noch weniger bekannten
Nürnberger Künstler Ulrich Wolf geraten; Auf-
klärung wird liier lediglich von einem glücklichen
archivalischen Funde, insbesondere von der Er-
schliessung des gräfl. Pappenheimschen Familien-
archives erhofft. Und auch auf die Zuteilung des
Altars an eine bestimmte Schule, auf die Einglie-
derung desselben in eine Entwicklungsreihe an der
Hand der Stilkritik lässt sich der Verfasser nicht
ernstlich ein. Er hebt nur die Uebereinstimmung
mancher Züge mit Eigentümlichkeiten der gleich-
zeitigen Nürnberger Kunst und die nahen Be-
ziehungen Eichstätts zu mehreren Augsburger
Plastikern hervor und glaubt schliesslich, dass der
Meister V. W. am ehesten in den Kreisen der
Hans Peuerlin und Gregor Erhard in Augsburg ge-
sucht werden müsse. Indessen zeigt sich, sobald
Hämmerle den Boden Eichstätts verlässt, ein be-
trächtliches Manko in der Kenntnis sowohl der
Denkmäler wie der- Quellen. Dass Adam Kraft
und Veit Stoss „als Vorbilder gerne Stiche und
Holzschnitte bekannter Meister benutzten“ (S. 7),
ist unrichtig und wird auch in der- hierzu an-
geführten Literatur nirgends behauptet. Mit der
nicht aufgefundenen Beschreibung des Altars im
Kunstblatt von 1835 (vgl. S. 49) ist wohl der Auf-
satz C. Beckers „Der Dom zu Eichstätt“ in Eggers'
Deutschem Kunstblatt 1853 S. 444 f. gemeint.
Ein breiter Raum ist in dem Buche an-
schliessend an die auf der Predella dargestellten
Adoranten und die ebendort angebrachte abge-
kürzte Ahnenprobe des Stifters genealogischen
Untersuchungen und Feststellungen und ganz be-
sonders der ikonographischen Würdigung des
Pappenheimer Altars, d. h. seiner einzelnen Teile,
Gruppen und Figuren gewidmet worden. Gerade
auf letzterem Gebiete tritt dabei ein wohlgeord-
netes beträchtliches Wissen zu tage und fällt
manche wertvolle Bemerkung, wenn auch die aus-
führliche Beschreibung des Altars im allgemeinen
weniger auf den Fachmann als auf Lernende in
den oberen Klassen von Gymnasien, Lyceen und
Seminaren berechnet ist. Mit Anerkennung ver-
dient endlich noch die reiche Ausstattung des
Schriftchens mit zum Teil trefflichen Abbildungen
hervorgehoben zu werden.
Theodor Hampe