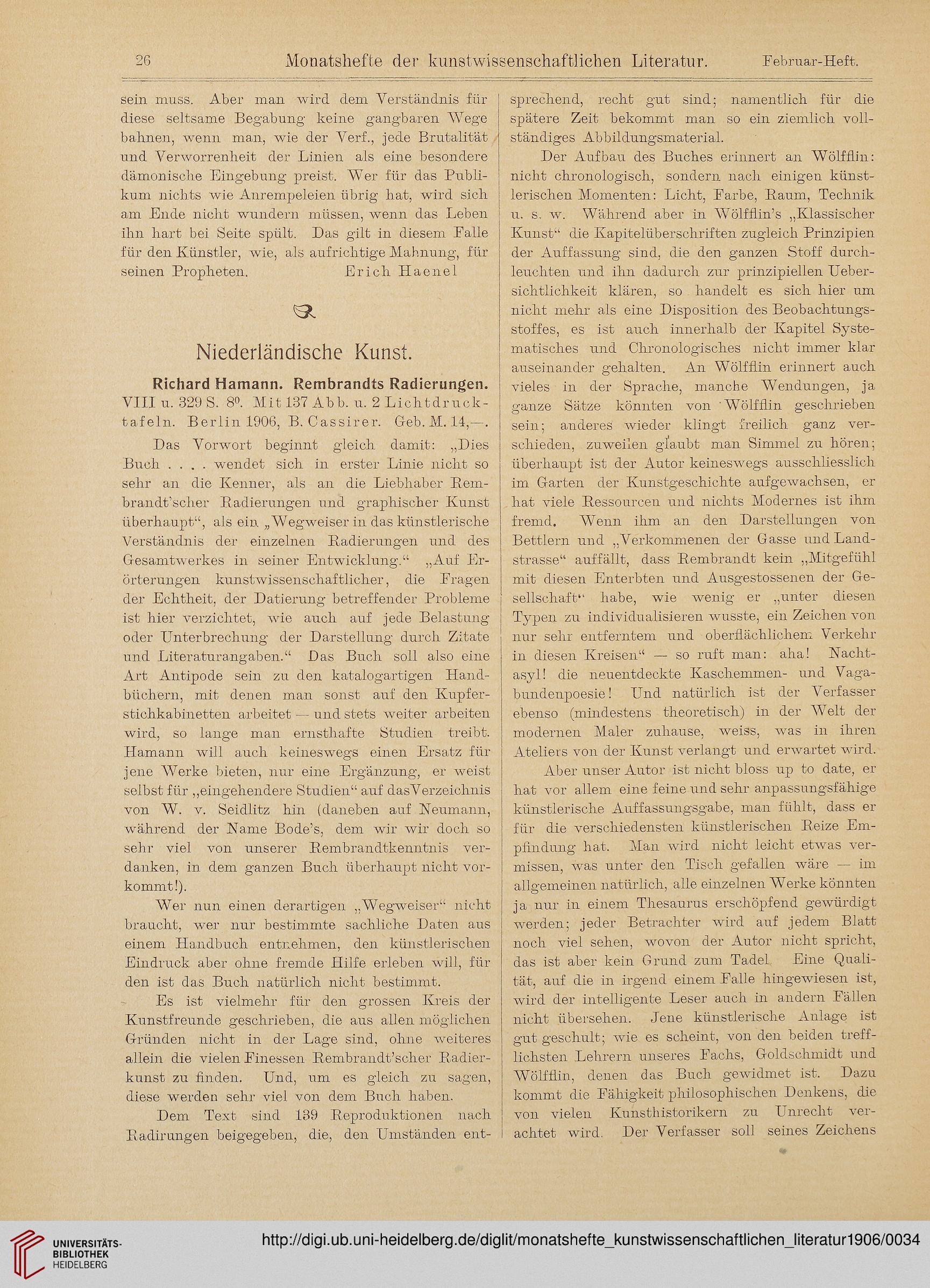26
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
Februar-Heft.
sein muss. Aber man wird dem Verständnis für
diese seltsame Begabung keine gangbaren Wege
bahnen, wenn man, wie der Verf., jede Brutalität
und Verworrenheit der Linien als eine besondere
dämonische Eingebung preist. Wer für das Publi-
kum nichts wie Anrempeleien übrig hat, wird sich
am Ende nicht wundern müssen, wenn das Leben
ihn hart bei Seite spült. Das gilt in diesem Falle
für den Künstler, wie, als aufrichtige Mahnung, für
seinen Propheten. Erich Haenel
Niederländische Kunst.
Richard Hamann. Rembrandts Radierungen.
VIII u. 329 S. 8°. Mit 137 Abb. u. 2 Lichtdruck-
tafeln. Berlin 1906, B. Cassirer. Geb. M. 14,—.
Das Vorwort beginnt gleich damit: „Dies
Buch .... wendet sich in erster Linie nicht so
sehr an die Kenner, als an die Liebhaber Rem-
brandt’scher Radierungen und graphischer Kunst
überhaupt“, als ein „Wegweiser in das künstlerische
Verständnis der einzelnen Radierungen und des
Gesamtwerkes in seiner Entwicklung.“ „Auf Er-
örterungen kunstwissenschaftlicher, die Fragen
der Echtheit, der Datierung betreffender Probleme
ist hier verzichtet, wie auch auf jede Belastung
oder Unterbrechung der Darstellung durch Zitate
und Literaturangaben.“ Das Buch soll also eine
Art Antipode sein zu den katalogartigen Hand-
büchern, mit denen man sonst auf den Kupfer-
stichkabinetten arbeitet — und stets weiter arbeiten
wird, so lange man ernsthafte Studien treibt.
Hamann will auch keineswegs einen Ersatz für
jene Werke bieten, nur eine Ergänzung, er weist
selbst für „eingehendere Studien“ auf dasVerzeichnis
von W. v. Seidlitz hin (daneben auf Neumann,
während der Name Bode’s, dem wir wir doch so
sehr viel von unserer Rembrandtkenntnis ver-
danken, in dem ganzen Buch überhaupt nicht vor-
kommt!).
AVer nun einen derartigen „Wegweiser“ nicht
braucht, wer nur bestimmte sachliche Daten aus
einem Handbuch entnehmen, den künstlerischen
Eindruck aber ohne fremde Hilfe erleben will, für
den ist das Buch natürlich nicht bestimmt.
Es ist vielmehr für den grossen Kreis der
Kunstfreunde geschrieben, die aus allen möglichen
Gründen nicht in der Lage sind, ohne weiteres
allein die vielen Finessen Rembrandt’scher Radier-
kunst zu finden. Und, um es gleich zu sagen,
diese werden sehr viel von dem Buch haben.
Dem Text sind 139 Reproduktionen nach
Radirungen beigegeben, die, den Umständen ent-
sprechend, recht gut sind; namentlich für die
spätere Zeit bekommt man so ein ziemlich voll-
ständiges Abbildungsmaterial.
Der Aufbau des Buches erinnert an Wölfflin:
nicht chronologisch, sondern nach einigen künst-
lerischen Momenten: Licht, Farbe, Raum, Technik
u. s. w. Während aber in Wölfflin’s „Klassischer
Kunst“ die Kapitelüberschriften zugleich Prinzipien
der Auffassung sind, die den ganzen Stoff durch-
leuchten und ihn dadurch zur prinzipiellen Ueber-
sichtlichkeit klären, so handelt es sich hier um
nicht mehr als eine Disposition des Beobachtungs-
stoffes, es ist auch innerhalb der Kapitel Syste-
matisches und Chronologisches nicht immer klar
auseinander gehalten. An Wölfflin erinnert auch
vieles in der Sprache, manche Wendungen, ja
ganze Sätze könnten von Wölfflin geschrieben
sein; anderes wieder klingt freilich ganz ver-
schieden, zuweilen glaubt man Simmel zu hören;
überhaupt ist der Autor keineswegs ausschliesslich
im Garten der Kunstgeschichte aufgewachsen, er
hat viele Ressourcen und nichts Modernes ist ihm
fremd. Wenn ihm an den Darstellungen von
Bettlern und „Verkommenen der Gasse und Land-
strasse“ auffällt, dass Rembrandt kein „Mitgefühl
mit diesen Enterbten und Ausgestossenen der Ge-
sellschaft“ habe, wie wenig er „unter diesen
Typen zu individualisieren wusste, ein Zeichen von
nur sehr entferntem und oberflächlichem Verkehr
in diesen Kreisen“ — so ruft man: aha! Nacht-
asyl! die neuentdeckte Kaschemmen- und Vaga-
bundenpoesie ! Und natürlich ist der Verfasser
ebenso (mindestens theoretisch) in der Welt der
modernen Maler zuhause, weiss, was in ihren
Ateliers von der Kunst verlangt und erwartet wird.
Aber unser Autor ist nicht bloss up to date, er
hat vor allem eine feine und sehr anpassungsfähige
künstlerische Auffassungsgabe, man fühlt, dass er
für die verschiedensten künstlerischen Reize Em-
pfindung hat. Man wird nicht leicht etwas ver-
missen, was unter den Tisch gefallen wäre — im
allgemeinen natürlich, alle einzelnen Werke könnten
ja nur in einem Thesaurus erschöpfend gewürdigt
werden; jeder Betrachter wird auf jedem Blatt
noch viel sehen, wovon der Autor nicht spricht,
das ist aber kein Grund zum Tadel Eine Quali-
tät, auf die in irgend einem Falle hingewiesen ist,
wird der intelligente Leser auch in andern Fällen
nicht übersehen. Jene künstlerische Anlage ist
gut geschult; wie es scheint, von den beiden treff-
lichsten Lehrern unseres Fachs, Goldschmidt und
Wölfflin, denen das Buch gewidmet ist. Dazu
kommt die Fähigkeit philosophischen Denkens, die
von vielen Kunsthistorikern zu Unrecht ver-
achtet wird. Der Verfasser soll seines Zeichens
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
Februar-Heft.
sein muss. Aber man wird dem Verständnis für
diese seltsame Begabung keine gangbaren Wege
bahnen, wenn man, wie der Verf., jede Brutalität
und Verworrenheit der Linien als eine besondere
dämonische Eingebung preist. Wer für das Publi-
kum nichts wie Anrempeleien übrig hat, wird sich
am Ende nicht wundern müssen, wenn das Leben
ihn hart bei Seite spült. Das gilt in diesem Falle
für den Künstler, wie, als aufrichtige Mahnung, für
seinen Propheten. Erich Haenel
Niederländische Kunst.
Richard Hamann. Rembrandts Radierungen.
VIII u. 329 S. 8°. Mit 137 Abb. u. 2 Lichtdruck-
tafeln. Berlin 1906, B. Cassirer. Geb. M. 14,—.
Das Vorwort beginnt gleich damit: „Dies
Buch .... wendet sich in erster Linie nicht so
sehr an die Kenner, als an die Liebhaber Rem-
brandt’scher Radierungen und graphischer Kunst
überhaupt“, als ein „Wegweiser in das künstlerische
Verständnis der einzelnen Radierungen und des
Gesamtwerkes in seiner Entwicklung.“ „Auf Er-
örterungen kunstwissenschaftlicher, die Fragen
der Echtheit, der Datierung betreffender Probleme
ist hier verzichtet, wie auch auf jede Belastung
oder Unterbrechung der Darstellung durch Zitate
und Literaturangaben.“ Das Buch soll also eine
Art Antipode sein zu den katalogartigen Hand-
büchern, mit denen man sonst auf den Kupfer-
stichkabinetten arbeitet — und stets weiter arbeiten
wird, so lange man ernsthafte Studien treibt.
Hamann will auch keineswegs einen Ersatz für
jene Werke bieten, nur eine Ergänzung, er weist
selbst für „eingehendere Studien“ auf dasVerzeichnis
von W. v. Seidlitz hin (daneben auf Neumann,
während der Name Bode’s, dem wir wir doch so
sehr viel von unserer Rembrandtkenntnis ver-
danken, in dem ganzen Buch überhaupt nicht vor-
kommt!).
AVer nun einen derartigen „Wegweiser“ nicht
braucht, wer nur bestimmte sachliche Daten aus
einem Handbuch entnehmen, den künstlerischen
Eindruck aber ohne fremde Hilfe erleben will, für
den ist das Buch natürlich nicht bestimmt.
Es ist vielmehr für den grossen Kreis der
Kunstfreunde geschrieben, die aus allen möglichen
Gründen nicht in der Lage sind, ohne weiteres
allein die vielen Finessen Rembrandt’scher Radier-
kunst zu finden. Und, um es gleich zu sagen,
diese werden sehr viel von dem Buch haben.
Dem Text sind 139 Reproduktionen nach
Radirungen beigegeben, die, den Umständen ent-
sprechend, recht gut sind; namentlich für die
spätere Zeit bekommt man so ein ziemlich voll-
ständiges Abbildungsmaterial.
Der Aufbau des Buches erinnert an Wölfflin:
nicht chronologisch, sondern nach einigen künst-
lerischen Momenten: Licht, Farbe, Raum, Technik
u. s. w. Während aber in Wölfflin’s „Klassischer
Kunst“ die Kapitelüberschriften zugleich Prinzipien
der Auffassung sind, die den ganzen Stoff durch-
leuchten und ihn dadurch zur prinzipiellen Ueber-
sichtlichkeit klären, so handelt es sich hier um
nicht mehr als eine Disposition des Beobachtungs-
stoffes, es ist auch innerhalb der Kapitel Syste-
matisches und Chronologisches nicht immer klar
auseinander gehalten. An Wölfflin erinnert auch
vieles in der Sprache, manche Wendungen, ja
ganze Sätze könnten von Wölfflin geschrieben
sein; anderes wieder klingt freilich ganz ver-
schieden, zuweilen glaubt man Simmel zu hören;
überhaupt ist der Autor keineswegs ausschliesslich
im Garten der Kunstgeschichte aufgewachsen, er
hat viele Ressourcen und nichts Modernes ist ihm
fremd. Wenn ihm an den Darstellungen von
Bettlern und „Verkommenen der Gasse und Land-
strasse“ auffällt, dass Rembrandt kein „Mitgefühl
mit diesen Enterbten und Ausgestossenen der Ge-
sellschaft“ habe, wie wenig er „unter diesen
Typen zu individualisieren wusste, ein Zeichen von
nur sehr entferntem und oberflächlichem Verkehr
in diesen Kreisen“ — so ruft man: aha! Nacht-
asyl! die neuentdeckte Kaschemmen- und Vaga-
bundenpoesie ! Und natürlich ist der Verfasser
ebenso (mindestens theoretisch) in der Welt der
modernen Maler zuhause, weiss, was in ihren
Ateliers von der Kunst verlangt und erwartet wird.
Aber unser Autor ist nicht bloss up to date, er
hat vor allem eine feine und sehr anpassungsfähige
künstlerische Auffassungsgabe, man fühlt, dass er
für die verschiedensten künstlerischen Reize Em-
pfindung hat. Man wird nicht leicht etwas ver-
missen, was unter den Tisch gefallen wäre — im
allgemeinen natürlich, alle einzelnen Werke könnten
ja nur in einem Thesaurus erschöpfend gewürdigt
werden; jeder Betrachter wird auf jedem Blatt
noch viel sehen, wovon der Autor nicht spricht,
das ist aber kein Grund zum Tadel Eine Quali-
tät, auf die in irgend einem Falle hingewiesen ist,
wird der intelligente Leser auch in andern Fällen
nicht übersehen. Jene künstlerische Anlage ist
gut geschult; wie es scheint, von den beiden treff-
lichsten Lehrern unseres Fachs, Goldschmidt und
Wölfflin, denen das Buch gewidmet ist. Dazu
kommt die Fähigkeit philosophischen Denkens, die
von vielen Kunsthistorikern zu Unrecht ver-
achtet wird. Der Verfasser soll seines Zeichens