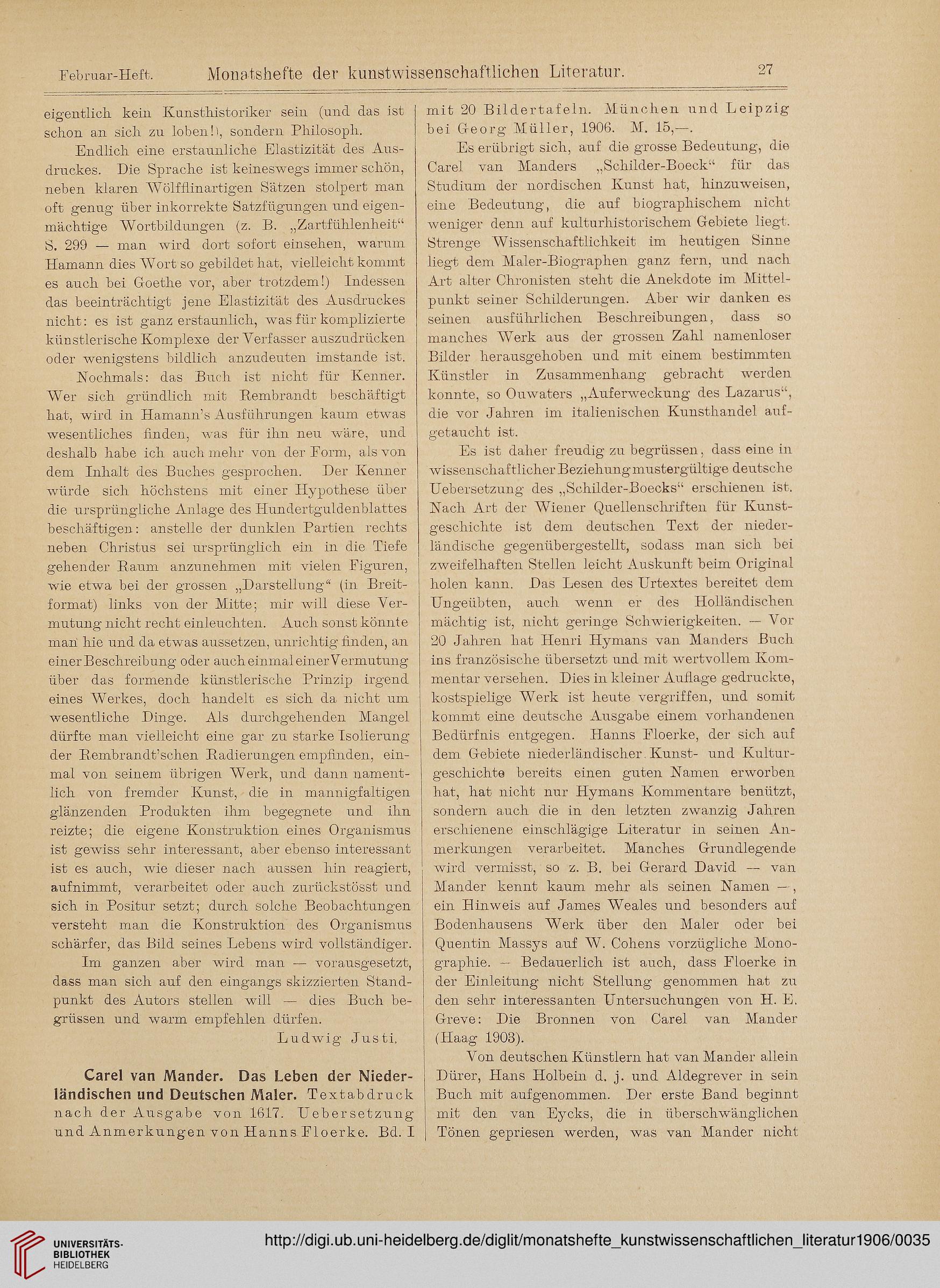Februar-Heft.
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
27
eigentlich, kein Kunsthistoriker sein (und das ist
schon an sich zu loben!), sondern Philosoph.
Endlich eine erstaunliche Elastizität des Aus-
druckes. Die Sprache ist keineswegs immer schön,
neben klaren Wölfflinartigen Sätzen stolpert man
oft genug über inkorrekte Satzfügungen und eigen-
mächtige Wortbildungen (z. B. „Zartfühlenheit“
S. 299 — man wird dort sofort einsehen, warum
Hamann dies Wort so gebildet hat, vielleicht kommt
es auch bei Goethe vor, aber trotzdem!) Indessen
das beeinträchtigt jene Elastizität des Ausdruckes
nicht: es ist ganz erstaunlich, was für komplizierte
künstlerische Komplexe der Verfasser auszudrücken
oder wenigstens bildlich anzudeuten imstande ist.
Nochmals: das Buch ist nicht für Kenner.
Wer sich gründlich mit Rembrandt beschäftigt
hat, wird in Hamann’s Ausführungen kaum etwas
wesentliches finden, was für ihn neu wäre, und
deshalb habe ich auch mehr von der Form, als von
dem Inhalt des Buches gesprochen. Der Kenner
würde sich höchstens mit einer Hypothese über
die ursprüngliche Anlage des Hundertguldenblattes
beschäftigen: anstelle der dunklen Partien rechts
neben Christus sei ursprünglich ein in die Tiefe
gehender Raum anzunehmen mit vielen Figuren,
wie etwa bei der grossen „Darstellung“ (in Breit-
format) links von der Mitte; mir will diese Ver-
mutung nicht recht einleuchten. Auch sonst könnte
man hie und da etwas aussetzen, unrichtig finden, an
einer Beschreibung oder auch einmal einer Vermutung
über das formende künstlerische Prinzip irgend
eines Werkes, doch handelt es sich da nicht um
wesentliche Dinge. Als durchgehenden Mangel
dürfte man vielleicht eine gar zu starke Isolierung
der Rembrandt’schen Radierungen empfinden, ein-
mal von seinem übrigen Werk, und dann nament-
lich von fremder Kunst, die in mannigfaltigen
glänzenden Produkten ihm begegnete und ihn
reizte; die eigene Konstruktion eines Organismus
ist gewiss sehr interessant, aber ebenso interessant
ist es auch, wie dieser nach aussen hin reagiert,
aufnimmt, verarbeitet oder auch zurückstösst und
sich in Positur setzt; durch solche Beobachtungen
versteht man die Konstruktion des Organismus
schärfer, das Bild seines Lebens wird vollständiger.
Im ganzen aber wird man — vorausgesetzt,
dass man sich auf den eingangs skizzierten Stand-
punkt des Autors stellen will — dies Buch be-
grüssen und warm empfehlen dürfen.
Ludwig Justi,
Carei van Mander. Das Leben der Nieder-
ländischen und Deutschen Maler. Textabdruck
nach der Ausgabe von 1617. Uebersetzung
und Anmerkungen von Hanns Floerke. Bd. I
mit 20 Bildertafeln. München und Leipzig
bei Georg Müller, 1906. M. 15,—.
Es erübrigt sich, auf die grosse Bedeutung, die
Carei van Manders „Schilder-Boeck“ für das
Studium der nordischen Kunst hat, hinzu weisen,
eine Bedeutung, die auf biographischem nicht
weniger denn auf kulturhistorischem Gebiete liegt.
Strenge Wissenschaftlichkeit im heutigen Sinne
liegt dem Maler-Biographen ganz fern, und nach
Art alter Chronisten steht die Anekdote im Mittel-
punkt seiner Schilderungen. Aber wir danken es
seinen ausführlichen Beschreibungen, dass so
manches Werk aus der grossen Zahl namenloser
Bilder herausgehoben und mit einem bestimmten
Künstler in Zusammenhang gebracht werden
konnte, so Ouwaters „Auferweckung des Lazarus“,
die vor Jahren im italienischen Kunsthandel auf-
getaucht ist.
Es ist daher freudig zu begrüssen, dass eine in
wissenschaftlicher Beziehung mustergültige deutsche
Uebersetzung des „Schilder-Boecks“ erschienen ist.
Nach Art der Wiener Quellenschriften für Kunst-
geschichte ist dem deutschen Text der nieder-
ländische gegenübergestellt, sodass man sich bei
zweifelhaften Stellen leicht Auskunft beim Original
holen kann. Das Lesen des Urtextes bereitet dem
Ungeübten, auch wenn er des Holländischen
mächtig ist, nicht geringe Schwierigkeiten. — Vor
20 Jahren hat Henri Hymans van Manders Buch
ins französische übersetzt und mit wertvollem Kom-
mentar versehen. Dies in kleiner Auflage gedruckte,
kostspiefige Werk ist heute vergriffen, und somit
kommt eine deutsche Ausgabe einem vorhandenen
Bedürfnis entgegen. Hanns Floerke, der sich auf
dem Gebiete niederländischer Kunst- und Kultur-
geschichte bereits einen guten Namen erworben
hat, hat nicht nur Hymans Kommentare benützt,
sondern auch die in den letzten zwanzig Jahren
erschienene einschlägige Literatur in seinen An-
merkungen verarbeitet. Manches Grundlegende
wird vermisst, so z. B. bei Gerard David — van
Mander kennt kaum mehr als seinen Namen — -,
ein Hinweis auf James Weales und besonders auf
Bodenhausens Werk über den Maler oder bei
Quentin Massys auf W. Cohens vorzügliche Mono-
graphie. — Bedauerlich ist auch, dass Floerke in
der Einleitung nicht Stellung genommen hat zu
den sehr interessanten Untersuchungen von H. E.
Greve: Die Bronnen von Carei van Mander
(Haag 1903).
Von deutschen Künstlern hat van Mander allein
Dürer, Hans Holbein d. j. und Aldegrever in sein
Buch mit aufgenommen. Der erste Band beginnt
mit den van Eycks, die in überschwänglichen
Tönen gepriesen werden, was van Mander nicht
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
27
eigentlich, kein Kunsthistoriker sein (und das ist
schon an sich zu loben!), sondern Philosoph.
Endlich eine erstaunliche Elastizität des Aus-
druckes. Die Sprache ist keineswegs immer schön,
neben klaren Wölfflinartigen Sätzen stolpert man
oft genug über inkorrekte Satzfügungen und eigen-
mächtige Wortbildungen (z. B. „Zartfühlenheit“
S. 299 — man wird dort sofort einsehen, warum
Hamann dies Wort so gebildet hat, vielleicht kommt
es auch bei Goethe vor, aber trotzdem!) Indessen
das beeinträchtigt jene Elastizität des Ausdruckes
nicht: es ist ganz erstaunlich, was für komplizierte
künstlerische Komplexe der Verfasser auszudrücken
oder wenigstens bildlich anzudeuten imstande ist.
Nochmals: das Buch ist nicht für Kenner.
Wer sich gründlich mit Rembrandt beschäftigt
hat, wird in Hamann’s Ausführungen kaum etwas
wesentliches finden, was für ihn neu wäre, und
deshalb habe ich auch mehr von der Form, als von
dem Inhalt des Buches gesprochen. Der Kenner
würde sich höchstens mit einer Hypothese über
die ursprüngliche Anlage des Hundertguldenblattes
beschäftigen: anstelle der dunklen Partien rechts
neben Christus sei ursprünglich ein in die Tiefe
gehender Raum anzunehmen mit vielen Figuren,
wie etwa bei der grossen „Darstellung“ (in Breit-
format) links von der Mitte; mir will diese Ver-
mutung nicht recht einleuchten. Auch sonst könnte
man hie und da etwas aussetzen, unrichtig finden, an
einer Beschreibung oder auch einmal einer Vermutung
über das formende künstlerische Prinzip irgend
eines Werkes, doch handelt es sich da nicht um
wesentliche Dinge. Als durchgehenden Mangel
dürfte man vielleicht eine gar zu starke Isolierung
der Rembrandt’schen Radierungen empfinden, ein-
mal von seinem übrigen Werk, und dann nament-
lich von fremder Kunst, die in mannigfaltigen
glänzenden Produkten ihm begegnete und ihn
reizte; die eigene Konstruktion eines Organismus
ist gewiss sehr interessant, aber ebenso interessant
ist es auch, wie dieser nach aussen hin reagiert,
aufnimmt, verarbeitet oder auch zurückstösst und
sich in Positur setzt; durch solche Beobachtungen
versteht man die Konstruktion des Organismus
schärfer, das Bild seines Lebens wird vollständiger.
Im ganzen aber wird man — vorausgesetzt,
dass man sich auf den eingangs skizzierten Stand-
punkt des Autors stellen will — dies Buch be-
grüssen und warm empfehlen dürfen.
Ludwig Justi,
Carei van Mander. Das Leben der Nieder-
ländischen und Deutschen Maler. Textabdruck
nach der Ausgabe von 1617. Uebersetzung
und Anmerkungen von Hanns Floerke. Bd. I
mit 20 Bildertafeln. München und Leipzig
bei Georg Müller, 1906. M. 15,—.
Es erübrigt sich, auf die grosse Bedeutung, die
Carei van Manders „Schilder-Boeck“ für das
Studium der nordischen Kunst hat, hinzu weisen,
eine Bedeutung, die auf biographischem nicht
weniger denn auf kulturhistorischem Gebiete liegt.
Strenge Wissenschaftlichkeit im heutigen Sinne
liegt dem Maler-Biographen ganz fern, und nach
Art alter Chronisten steht die Anekdote im Mittel-
punkt seiner Schilderungen. Aber wir danken es
seinen ausführlichen Beschreibungen, dass so
manches Werk aus der grossen Zahl namenloser
Bilder herausgehoben und mit einem bestimmten
Künstler in Zusammenhang gebracht werden
konnte, so Ouwaters „Auferweckung des Lazarus“,
die vor Jahren im italienischen Kunsthandel auf-
getaucht ist.
Es ist daher freudig zu begrüssen, dass eine in
wissenschaftlicher Beziehung mustergültige deutsche
Uebersetzung des „Schilder-Boecks“ erschienen ist.
Nach Art der Wiener Quellenschriften für Kunst-
geschichte ist dem deutschen Text der nieder-
ländische gegenübergestellt, sodass man sich bei
zweifelhaften Stellen leicht Auskunft beim Original
holen kann. Das Lesen des Urtextes bereitet dem
Ungeübten, auch wenn er des Holländischen
mächtig ist, nicht geringe Schwierigkeiten. — Vor
20 Jahren hat Henri Hymans van Manders Buch
ins französische übersetzt und mit wertvollem Kom-
mentar versehen. Dies in kleiner Auflage gedruckte,
kostspiefige Werk ist heute vergriffen, und somit
kommt eine deutsche Ausgabe einem vorhandenen
Bedürfnis entgegen. Hanns Floerke, der sich auf
dem Gebiete niederländischer Kunst- und Kultur-
geschichte bereits einen guten Namen erworben
hat, hat nicht nur Hymans Kommentare benützt,
sondern auch die in den letzten zwanzig Jahren
erschienene einschlägige Literatur in seinen An-
merkungen verarbeitet. Manches Grundlegende
wird vermisst, so z. B. bei Gerard David — van
Mander kennt kaum mehr als seinen Namen — -,
ein Hinweis auf James Weales und besonders auf
Bodenhausens Werk über den Maler oder bei
Quentin Massys auf W. Cohens vorzügliche Mono-
graphie. — Bedauerlich ist auch, dass Floerke in
der Einleitung nicht Stellung genommen hat zu
den sehr interessanten Untersuchungen von H. E.
Greve: Die Bronnen von Carei van Mander
(Haag 1903).
Von deutschen Künstlern hat van Mander allein
Dürer, Hans Holbein d. j. und Aldegrever in sein
Buch mit aufgenommen. Der erste Band beginnt
mit den van Eycks, die in überschwänglichen
Tönen gepriesen werden, was van Mander nicht