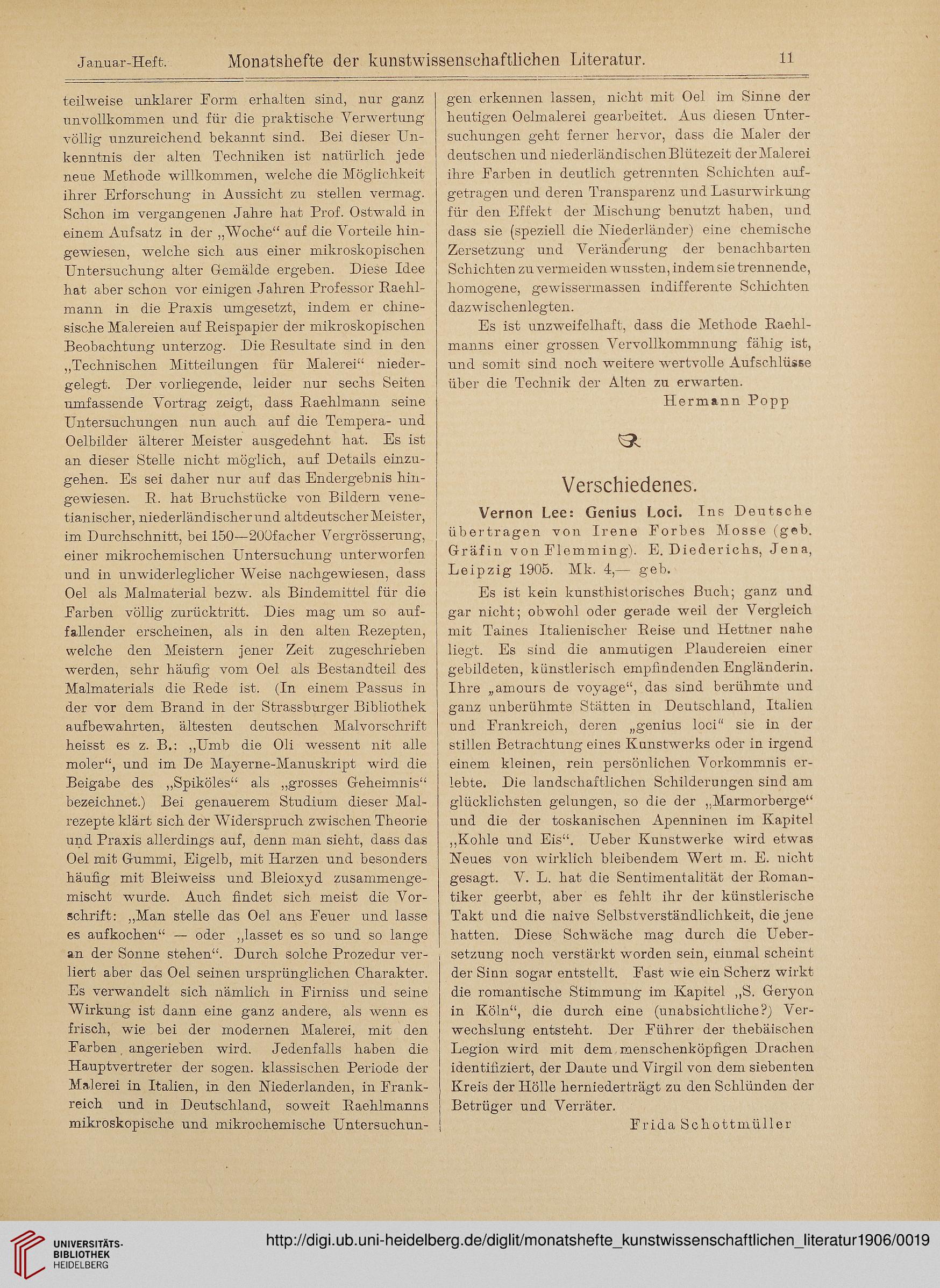Januar-Heft.
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
teilweise unklarer Form erhalten sind, nur ganz
unvollkommen und für die praktische Verwertung
völlig unzureichend bekannt sind. Bei dieser Un-
kenntnis der alten Techniken ist natürlich jede
neue Methode willkommen, welche die Möglichkeit
ihrer Erforschung in Aussicht zu stellen vermag.
Schon im vergangenen Jahre hat Prof. Ostwald in
einem Aufsatz in der „Woche“ auf die Vorteile hin-
gewiesen, welche sich aus einer mikroskopischen
Untersuchung alter Gemälde ergeben. Diese Idee
hat aber schon vor einigen Jahren Professor Raehl-
mann in die Praxis umgesetzt, indem er chine-
sische Malereien auf Reispapier der mikroskopischen
Beobachtung unterzog. Die Resultate sind in den
„Technischen Mitteilungen für Malerei“ nieder-
gelegt. Der vorliegende, leider nur sechs Seiten
umfassende Vortrag zeigt, dass Raehlmann seine
Untersuchungen nun auch auf die Tempera- und
Oelbilder älterer Meister ausgedehnt hat. Es ist
an dieser Stelle nicht möglich, auf Details einzu-
gehen. Es sei daher nur auf das Endergebnis hin-
gewiesen. R. hat Bruchstücke von Bildern vene-
tianischer, niederländischer und altdeutscher Meister,
im Durchschnitt, bei 150—20Üfacher Vergrösserung,
einer' mikrochemischen Untersuchung unterworfen
und in unwiderleglicher Weise nachgewiesen, dass
Oel als Malmaterial bezw. als Bindemittel für die
Farben völlig zurücktritt. Dies mag um so auf-
fallender erscheinen, als in den alten Rezepten,
welche den Meistern jener Zeit zugeschrieben
werden, sehr häufig vom Oel als Bestandteil des
Malmaterials die Rede ist. (In einem Passus in
der vor dem Brand in der Strassburger Bibliothek
aufbewahrten, ältesten deutschen Malvorschrift
heisst es z. B.: ,,Umb die Oli wessent nit alle
moler“, und im De Mayerne-Manuskript wird die
Beigabe des „Spiköles“ als „grosses Geheimnis“
bezeichnet.) Bei genauerem Studium dieser Mal-
rezepte klärt sich der Widerspruch zwischen Theorie
und Praxis allerdings auf, denn man sieht, dass das
Oel mit Gummi, Eigelb, mit Harzen und besonders
häufig mit Bleiweiss und Bleioxyd zusammenge-
mischt wurde. Auch findet sich meist die Vor-
schrift: „Man stelle das Oel ans Feuer und lasse
es aufkochen“ — oder „lasset es so und so lange
an der Sonne stehen“. Durch solche Prozedur ver-
liert aber das Oel seinen ursprünglichen Charakter.
Es verwandelt sich nämlich in Firniss und seine
Wirkung ist dann eine ganz andere, als wenn es
frisch, wie bei der modernen Malerei, mit den
Farben. angerieben wird. Jedenfalls haben die
Hauptvertreter der sogen, klassischen Periode der
Malerei in Italien, in den Niederlanden, in Frank-
reich und in Deutschland, soweit Raehlmanns
mikroskopische und mikrochemische Untersuchun-
gen erkennen lassen, nicht mit Oel im Sinne der
heutigen Oelmalerei gearbeitet. Aus diesen Unter-
suchungen geht ferner hervor, dass die Maler der
deutschen und niederländischen Blütezeit der Malerei
ihre Farben in deutlich getrennten Schichten auf-
getragen und deren Transparenz und Lasurwirkung
für den Effekt der Mischung benutzt haben, und
dass sie (speziell die Niederländer) eine chemische
Zersetzung und Veränderung der benachbarten
Schichten zu vermeiden wussten, indem sie trennende,
homogene, gewissermassen indifferente Schichten
dazwischenlegten.
Es ist unzweifelhaft, dass die Methode Raehl-
manns einer grossen Vervollkommnung fähig ist,
und somit sind noch weitere wertvolle Aufschlüsse
über die Technik der Alten zu erwarten.
Hermann Popp
Verschiedenes.
Vernon Lee: Genius Loci. Ins Deutsche
übertragen von Irene Forbes Mosse (geb.
Gräfin von Flemming). E. Diederichs, Jena,
Leipzig 1905. Mk. 4,— geb.
Es ist kein kunsthistorisches Buch; ganz und
gar nicht; obwohl oder gerade weil der Vergleich
mit Taines Italienischer Reise und Hettner nahe
liegt. Es sind die anmutigen Plaudereien einer
gebildeten, künstlerisch empfindenden Engländerin.
Ihre „amours de voyage“, das sind berühmte und
ganz unberühmte Stätten in Deutschland, Italien
und Frankreich, deren „genius loci“ sie in der
stillen Betrachtung eines Kunstwerks oder in irgend
einem kleinen, rein persönlichen Vorkommnis er-
lebte. Die landschaftlichen Schilderungen sind am
glücklichsten gelungen, so die der „Marmorberge“
und die der toskanischen Apenninen im Kapitel
„Kohle und Eis“. Ueber Kunstwerke wird etwas
Neues von wirklich bleibendem Wert m. E. nicht
gesagt. V. L. hat die Sentimentalität der Roman-
tiker geerbt, aber es fehlt ihr der künstlerische
Takt und die naive Selbstverständlichkeit, die jene
hatten. Diese Schwäche mag durch die Ueber-
setzung noch verstärkt worden sein, einmal scheint
der Sinn sogar entstellt. Fast wie ein Scherz wirkt
die romantische Stimmung im Kapitel „S. Geryon
in Köln“, die durch eine (unabsichtliche?) Ver-
wechslung entsteht. Der Führer der thebäischen
Legion wird mit dem menschenköpfigen Drachen
identifiziert, der Daute und Virgil von dem siebenten
Kreis der Hölle herniederträgt zu den Schlünden der
Betrüger und Verräter.
Frida Schottmüller
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur.
teilweise unklarer Form erhalten sind, nur ganz
unvollkommen und für die praktische Verwertung
völlig unzureichend bekannt sind. Bei dieser Un-
kenntnis der alten Techniken ist natürlich jede
neue Methode willkommen, welche die Möglichkeit
ihrer Erforschung in Aussicht zu stellen vermag.
Schon im vergangenen Jahre hat Prof. Ostwald in
einem Aufsatz in der „Woche“ auf die Vorteile hin-
gewiesen, welche sich aus einer mikroskopischen
Untersuchung alter Gemälde ergeben. Diese Idee
hat aber schon vor einigen Jahren Professor Raehl-
mann in die Praxis umgesetzt, indem er chine-
sische Malereien auf Reispapier der mikroskopischen
Beobachtung unterzog. Die Resultate sind in den
„Technischen Mitteilungen für Malerei“ nieder-
gelegt. Der vorliegende, leider nur sechs Seiten
umfassende Vortrag zeigt, dass Raehlmann seine
Untersuchungen nun auch auf die Tempera- und
Oelbilder älterer Meister ausgedehnt hat. Es ist
an dieser Stelle nicht möglich, auf Details einzu-
gehen. Es sei daher nur auf das Endergebnis hin-
gewiesen. R. hat Bruchstücke von Bildern vene-
tianischer, niederländischer und altdeutscher Meister,
im Durchschnitt, bei 150—20Üfacher Vergrösserung,
einer' mikrochemischen Untersuchung unterworfen
und in unwiderleglicher Weise nachgewiesen, dass
Oel als Malmaterial bezw. als Bindemittel für die
Farben völlig zurücktritt. Dies mag um so auf-
fallender erscheinen, als in den alten Rezepten,
welche den Meistern jener Zeit zugeschrieben
werden, sehr häufig vom Oel als Bestandteil des
Malmaterials die Rede ist. (In einem Passus in
der vor dem Brand in der Strassburger Bibliothek
aufbewahrten, ältesten deutschen Malvorschrift
heisst es z. B.: ,,Umb die Oli wessent nit alle
moler“, und im De Mayerne-Manuskript wird die
Beigabe des „Spiköles“ als „grosses Geheimnis“
bezeichnet.) Bei genauerem Studium dieser Mal-
rezepte klärt sich der Widerspruch zwischen Theorie
und Praxis allerdings auf, denn man sieht, dass das
Oel mit Gummi, Eigelb, mit Harzen und besonders
häufig mit Bleiweiss und Bleioxyd zusammenge-
mischt wurde. Auch findet sich meist die Vor-
schrift: „Man stelle das Oel ans Feuer und lasse
es aufkochen“ — oder „lasset es so und so lange
an der Sonne stehen“. Durch solche Prozedur ver-
liert aber das Oel seinen ursprünglichen Charakter.
Es verwandelt sich nämlich in Firniss und seine
Wirkung ist dann eine ganz andere, als wenn es
frisch, wie bei der modernen Malerei, mit den
Farben. angerieben wird. Jedenfalls haben die
Hauptvertreter der sogen, klassischen Periode der
Malerei in Italien, in den Niederlanden, in Frank-
reich und in Deutschland, soweit Raehlmanns
mikroskopische und mikrochemische Untersuchun-
gen erkennen lassen, nicht mit Oel im Sinne der
heutigen Oelmalerei gearbeitet. Aus diesen Unter-
suchungen geht ferner hervor, dass die Maler der
deutschen und niederländischen Blütezeit der Malerei
ihre Farben in deutlich getrennten Schichten auf-
getragen und deren Transparenz und Lasurwirkung
für den Effekt der Mischung benutzt haben, und
dass sie (speziell die Niederländer) eine chemische
Zersetzung und Veränderung der benachbarten
Schichten zu vermeiden wussten, indem sie trennende,
homogene, gewissermassen indifferente Schichten
dazwischenlegten.
Es ist unzweifelhaft, dass die Methode Raehl-
manns einer grossen Vervollkommnung fähig ist,
und somit sind noch weitere wertvolle Aufschlüsse
über die Technik der Alten zu erwarten.
Hermann Popp
Verschiedenes.
Vernon Lee: Genius Loci. Ins Deutsche
übertragen von Irene Forbes Mosse (geb.
Gräfin von Flemming). E. Diederichs, Jena,
Leipzig 1905. Mk. 4,— geb.
Es ist kein kunsthistorisches Buch; ganz und
gar nicht; obwohl oder gerade weil der Vergleich
mit Taines Italienischer Reise und Hettner nahe
liegt. Es sind die anmutigen Plaudereien einer
gebildeten, künstlerisch empfindenden Engländerin.
Ihre „amours de voyage“, das sind berühmte und
ganz unberühmte Stätten in Deutschland, Italien
und Frankreich, deren „genius loci“ sie in der
stillen Betrachtung eines Kunstwerks oder in irgend
einem kleinen, rein persönlichen Vorkommnis er-
lebte. Die landschaftlichen Schilderungen sind am
glücklichsten gelungen, so die der „Marmorberge“
und die der toskanischen Apenninen im Kapitel
„Kohle und Eis“. Ueber Kunstwerke wird etwas
Neues von wirklich bleibendem Wert m. E. nicht
gesagt. V. L. hat die Sentimentalität der Roman-
tiker geerbt, aber es fehlt ihr der künstlerische
Takt und die naive Selbstverständlichkeit, die jene
hatten. Diese Schwäche mag durch die Ueber-
setzung noch verstärkt worden sein, einmal scheint
der Sinn sogar entstellt. Fast wie ein Scherz wirkt
die romantische Stimmung im Kapitel „S. Geryon
in Köln“, die durch eine (unabsichtliche?) Ver-
wechslung entsteht. Der Führer der thebäischen
Legion wird mit dem menschenköpfigen Drachen
identifiziert, der Daute und Virgil von dem siebenten
Kreis der Hölle herniederträgt zu den Schlünden der
Betrüger und Verräter.
Frida Schottmüller