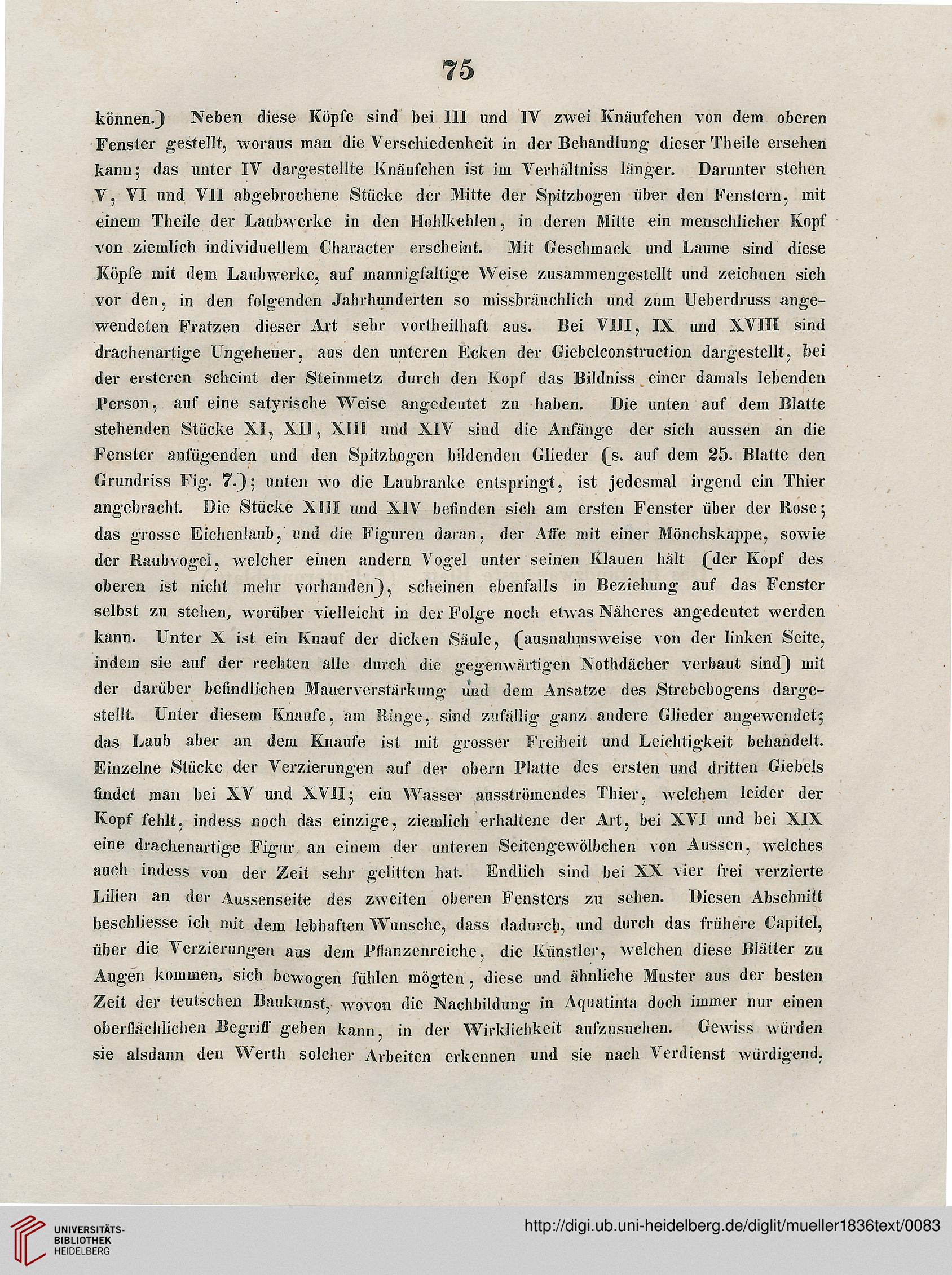75
können.) Neben diese Köpfe sind bei III und IV zwei Knäufchen von dem oberen
Fenster gestellt, woraus man die Verschiedenheit in der Behandlung dieser Theile ersehen
kann; das unter IV dargestellte Knäufchen ist im Verhältniss länger. Darunter stellen
V, VI und VII abgebrochene Stücke der Mitte der Spitzbogen über den Fenstern, mit
einem Theile der Laubwerke in den Hohlkehlen, in deren Mitte ein menschlicher Kopf
von ziemlich individuellem Character erscheint. 3Iit Geschmack und Laune sind diese
Köpfe mit dem Laubwerke, auf mannigfaltige Weise zusammengestellt und zeichnen sich
vor den, in den folgenden Jahrhunderten so missbräuchlich und zum Ueberdruss ange-
wendeten Fratzen dieser Art sehr vortheilhaft aus. Bei VIII, IX und XVIII sind
drachenartige Ungeheuer, aus den unteren Ecken der Giebelconstruction dargestellt, bei
der ersteren scheint der Steinmetz durch den Kopf das Bildniss einer damals lebenden
Person, auf eine satyrische Weise angedeutet zu haben. Die unten auf dem Blatte
stehenden Stücke XI, XII, XIII und XIV sind die Anfänge der sich aussen an die
Fenster anlügenden und den Spitzbogen bildenden Glieder (js. auf dem 25. Blatte den
Grundriss Fig. 7.); unten wo die Laubranke entspringt, ist jedesmal irgend ein Thier
angebracht. Die Stücke XIII und XIV befinden sich am ersten Fenster über der Rose;
das grosse Eichenlaub, und die Figuren daran, der Affe mit einer Mönchskappe, sowie
der Raubvogel, welcher einen andern Vogel unter seinen Klauen hält (der Kopf des
oberen ist nicht mehr vorhanden), scheinen ebenfalls in Beziehung auf das Fenster
selbst zu stehen, worüber vielleicht in der Folge noch etwas Näheres angedeutet werden
kann. Unter X ist ein Knauf der dicken Säule, (^ausnahmsweise von der linken Seite,
indem sie auf der rechten alle durch die <re<renwärtiären Nothdächer verbaut sind) mit
der darüber befindlichen Mauerverstärkung und dem Ansätze des Strebebogens darge-
stellt. Unter diesem Knaufe, am Ringe, sind zufällig ganz andere Glieder angewendet;
das Laub aber an dem Knaufe ist mit grosser Freiheit und Leichtigkeit behandelt.
Einzelne Stücke der Verzierungen auf der obern Platte des ersten und dritten Giebels
findet man bei XV und XVII; ein Wasser ausströmendes Thier, welchem leider der
Kopf fehlt, indess noch das einzige, ziemlich erhaltene der Art, bei XVI und bei XIX
eine drachenartige Figur an einem der unteren Seitengewölbchen von Aussen, welches
auch indess von der Zeit sehr gelitten hat. Endlich sind bei XX vier frei verzierte
Lilien an der Aussenseite des zweiten oberen Fensters zu sehen. Diesen Abschnitt
beschliesse ich mit dem lebhaften Wunsche, dass dadurch, und durch das frühere Capitel,
über die Verzierungen aus dem Pllanzenreiche, die Künstler, Melchen diese Blätter zu
Augen kommen, sich bewogen fühlen mögten , diese und ähnliche Muster aus der besten
Zeit der teutschen Baukunst, wovon die Nachbildung in Aquatinta doch immer nur einen
oberflächlichen Begriff geben kann, in der Wirklichkeit aufzusuchen. Gewiss würden
sie alsdann den Werth solcher Arbeiten erkennen und sie nach Verdienst würdigend.
können.) Neben diese Köpfe sind bei III und IV zwei Knäufchen von dem oberen
Fenster gestellt, woraus man die Verschiedenheit in der Behandlung dieser Theile ersehen
kann; das unter IV dargestellte Knäufchen ist im Verhältniss länger. Darunter stellen
V, VI und VII abgebrochene Stücke der Mitte der Spitzbogen über den Fenstern, mit
einem Theile der Laubwerke in den Hohlkehlen, in deren Mitte ein menschlicher Kopf
von ziemlich individuellem Character erscheint. 3Iit Geschmack und Laune sind diese
Köpfe mit dem Laubwerke, auf mannigfaltige Weise zusammengestellt und zeichnen sich
vor den, in den folgenden Jahrhunderten so missbräuchlich und zum Ueberdruss ange-
wendeten Fratzen dieser Art sehr vortheilhaft aus. Bei VIII, IX und XVIII sind
drachenartige Ungeheuer, aus den unteren Ecken der Giebelconstruction dargestellt, bei
der ersteren scheint der Steinmetz durch den Kopf das Bildniss einer damals lebenden
Person, auf eine satyrische Weise angedeutet zu haben. Die unten auf dem Blatte
stehenden Stücke XI, XII, XIII und XIV sind die Anfänge der sich aussen an die
Fenster anlügenden und den Spitzbogen bildenden Glieder (js. auf dem 25. Blatte den
Grundriss Fig. 7.); unten wo die Laubranke entspringt, ist jedesmal irgend ein Thier
angebracht. Die Stücke XIII und XIV befinden sich am ersten Fenster über der Rose;
das grosse Eichenlaub, und die Figuren daran, der Affe mit einer Mönchskappe, sowie
der Raubvogel, welcher einen andern Vogel unter seinen Klauen hält (der Kopf des
oberen ist nicht mehr vorhanden), scheinen ebenfalls in Beziehung auf das Fenster
selbst zu stehen, worüber vielleicht in der Folge noch etwas Näheres angedeutet werden
kann. Unter X ist ein Knauf der dicken Säule, (^ausnahmsweise von der linken Seite,
indem sie auf der rechten alle durch die <re<renwärtiären Nothdächer verbaut sind) mit
der darüber befindlichen Mauerverstärkung und dem Ansätze des Strebebogens darge-
stellt. Unter diesem Knaufe, am Ringe, sind zufällig ganz andere Glieder angewendet;
das Laub aber an dem Knaufe ist mit grosser Freiheit und Leichtigkeit behandelt.
Einzelne Stücke der Verzierungen auf der obern Platte des ersten und dritten Giebels
findet man bei XV und XVII; ein Wasser ausströmendes Thier, welchem leider der
Kopf fehlt, indess noch das einzige, ziemlich erhaltene der Art, bei XVI und bei XIX
eine drachenartige Figur an einem der unteren Seitengewölbchen von Aussen, welches
auch indess von der Zeit sehr gelitten hat. Endlich sind bei XX vier frei verzierte
Lilien an der Aussenseite des zweiten oberen Fensters zu sehen. Diesen Abschnitt
beschliesse ich mit dem lebhaften Wunsche, dass dadurch, und durch das frühere Capitel,
über die Verzierungen aus dem Pllanzenreiche, die Künstler, Melchen diese Blätter zu
Augen kommen, sich bewogen fühlen mögten , diese und ähnliche Muster aus der besten
Zeit der teutschen Baukunst, wovon die Nachbildung in Aquatinta doch immer nur einen
oberflächlichen Begriff geben kann, in der Wirklichkeit aufzusuchen. Gewiss würden
sie alsdann den Werth solcher Arbeiten erkennen und sie nach Verdienst würdigend.