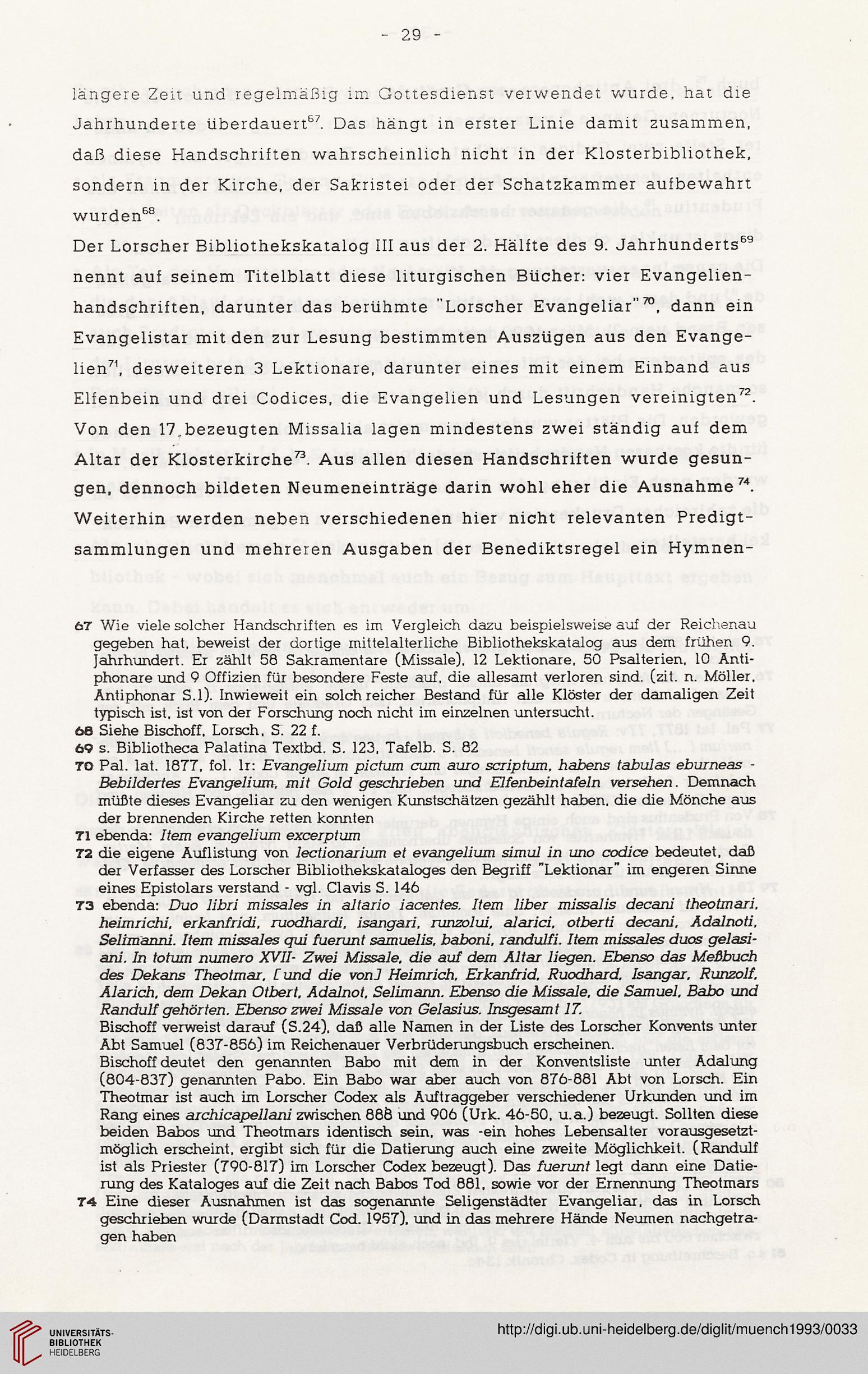29
iängere Zeit und regelmäßig im Gottesdienst verwendet wurde, hat die
Jahrhunderte überdauert67. Das hängt in erster Linie damit zusammen,
daß diese Handschriften wahrscheinlich nicht in der Klosterbibliothek,
sondern in der Kirche, der Sakristei oder der Schatzkammer aufbewahrt
wurden68.
Der Lorscher Bibliothekskatalog III aus der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts69
nennt auf seinem Titelblatt diese liturgischen Bücher: vier Evangelien-
handschriften, darunter das berühmte "Lorscher Evangeliar”^0, dann ein
Evangelistar mit den zur Lesung bestimmten Auszügen aus den Evange-
lien71, desweiteren 3 Lektionare, darunter eines mit einem Einband aus
Elfenbein und drei Codices, die Evangelien und Lesungen vereinigten72.
Von den I7,bezeugten Missalia lagen mindestens zwei ständig auf dem
Altar der Klosterkirche73. Aus allen diesen Handschriften wurde gesun-
gen, dennoch bildeten Neumeneinträge darin wohl eher die Ausnahme 74.
Weiterhin werden neben verschiedenen hier nicht relevanten Predigt-
sammlungen und mehreren Ausgaben der Benediktsregel ein Hymnen-
67 Wie viele solcher Handschriften es im Vergleich dazu beispieisweise auf der Reichenau
gegeben hat, beweist der dortige mittelalterliche Bibliothekskatalog aus dem frühen 9.
Jahrhundert. Er zählt 58 Sakramentare (Missale), 12 Lektionare, 50 Psalterien, 10 Anti-
phonare und 9 Offizien für besondere Feste auf, die allesamt verloren sind. (zit. n. Möller,
Antiphonar S.l). Inwieweit ein solchreicher Bestand für alle Klöster der damaligen Zeit
typisch ist, ist von der Forschung noch nicht im einzelnen untersucht.
68 Siehe Bischoff, Lorsch, S. 22 f.
69 s. Bibliotheca Palatina Textbd. S. 123, Tafelb. S. 82
70 Pal. lat. 1877, fol. lr: Evangelium pictum cum auro scriptum, habens tabulas eburneas -
Bebildertes Evangelium, mit Gold geschrieben und Elfenbeintafeln versehen. Demnach
müflte dieses Evangeliar zu den wenigen Kunstschätzen gezählt haben, die die Mönche aus
der brennenden Kirche retten konnten
71 ebenda: Item evangelium excerptum
72 die eigene Auflistung von lectionarium et evangelium simul in uno codice bedeutet, daß
der Verfasser des Lorscher Bibliothekskataloges den Begriff "Lektionar" im engeren Sinne
eines Epistolars verstand - vgl. Clavis S. 146
73 ebenda: Duo libri missales in altario iacentes. Item liber missalis decani theotmari,
heimrichi, erkanfridi, ruodhardi, isangari, runzolui, alarici, otberti decani, Adalnoti.
Selimarmi. Item missales qui fuerunt samuelis, baboni. randulfi. Item missales duos gelasi-
ani. In totum numero XVII- Zwei Missale, die auf dem Altar liegen. Ebenso das Meßbuch
des Dekans Theotmar. Cund die vonJ Heimrich. Erkanfrid. Ruodhard. Isangar. Runzolf.
Alarich, dem Dekan Otbert. Adalnot. Selimann. Ebenso die Missale. die Samuel. Babo und
Randulf gehörten. Ebenso zwei Missale von Gelasius. Insgesamt 17.
Bischoff verweist darauf (S.24), daß alle Namen in der Liste des Lorscher Konvents unter
Abt Samuel (837-856) im Reichenauer Verbrüderungsbuch erscheinen.
Bischoff deutet den genannten Babo mit dem in der Konventsliste unter Adalung
(804-837) genannten Pabo. Ein Babo war aber auch von 876-881 Abt von Lorsch. Ein
Theotmar ist auch im Lorscher Codex als Auftraggeber verschiedener Urkunden und im
Rang eines archicapellani zwischen 88Ö und 906 (Urk. 46-50, u.a.) bezeugt. Sollten diese
beiden Babos und Theotmars identisch sein, was -ein hohes Lebensalter vorausgesetzt-
möglich erscheint, ergibt sich für die Datierung auch eine zweite Möglichkeit. (Randulf
ist als Priester (790-817) im Lorscher Codex bezeugt). Das fuerunt legt dann eine Datie-
rung des Kataloges auf die Zeit nach Babos Tod 881, sowie vor der Ernennung Theotmars
74 Eine dieser Ausnahmen ist das sogenannte Seligenstädter Evangeliar, das in Lorsch
geschrieben wurde (Darmstadt Cod. 1957), und in das mehrere Hände Neumen nachgetra-
gen haben
iängere Zeit und regelmäßig im Gottesdienst verwendet wurde, hat die
Jahrhunderte überdauert67. Das hängt in erster Linie damit zusammen,
daß diese Handschriften wahrscheinlich nicht in der Klosterbibliothek,
sondern in der Kirche, der Sakristei oder der Schatzkammer aufbewahrt
wurden68.
Der Lorscher Bibliothekskatalog III aus der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts69
nennt auf seinem Titelblatt diese liturgischen Bücher: vier Evangelien-
handschriften, darunter das berühmte "Lorscher Evangeliar”^0, dann ein
Evangelistar mit den zur Lesung bestimmten Auszügen aus den Evange-
lien71, desweiteren 3 Lektionare, darunter eines mit einem Einband aus
Elfenbein und drei Codices, die Evangelien und Lesungen vereinigten72.
Von den I7,bezeugten Missalia lagen mindestens zwei ständig auf dem
Altar der Klosterkirche73. Aus allen diesen Handschriften wurde gesun-
gen, dennoch bildeten Neumeneinträge darin wohl eher die Ausnahme 74.
Weiterhin werden neben verschiedenen hier nicht relevanten Predigt-
sammlungen und mehreren Ausgaben der Benediktsregel ein Hymnen-
67 Wie viele solcher Handschriften es im Vergleich dazu beispieisweise auf der Reichenau
gegeben hat, beweist der dortige mittelalterliche Bibliothekskatalog aus dem frühen 9.
Jahrhundert. Er zählt 58 Sakramentare (Missale), 12 Lektionare, 50 Psalterien, 10 Anti-
phonare und 9 Offizien für besondere Feste auf, die allesamt verloren sind. (zit. n. Möller,
Antiphonar S.l). Inwieweit ein solchreicher Bestand für alle Klöster der damaligen Zeit
typisch ist, ist von der Forschung noch nicht im einzelnen untersucht.
68 Siehe Bischoff, Lorsch, S. 22 f.
69 s. Bibliotheca Palatina Textbd. S. 123, Tafelb. S. 82
70 Pal. lat. 1877, fol. lr: Evangelium pictum cum auro scriptum, habens tabulas eburneas -
Bebildertes Evangelium, mit Gold geschrieben und Elfenbeintafeln versehen. Demnach
müflte dieses Evangeliar zu den wenigen Kunstschätzen gezählt haben, die die Mönche aus
der brennenden Kirche retten konnten
71 ebenda: Item evangelium excerptum
72 die eigene Auflistung von lectionarium et evangelium simul in uno codice bedeutet, daß
der Verfasser des Lorscher Bibliothekskataloges den Begriff "Lektionar" im engeren Sinne
eines Epistolars verstand - vgl. Clavis S. 146
73 ebenda: Duo libri missales in altario iacentes. Item liber missalis decani theotmari,
heimrichi, erkanfridi, ruodhardi, isangari, runzolui, alarici, otberti decani, Adalnoti.
Selimarmi. Item missales qui fuerunt samuelis, baboni. randulfi. Item missales duos gelasi-
ani. In totum numero XVII- Zwei Missale, die auf dem Altar liegen. Ebenso das Meßbuch
des Dekans Theotmar. Cund die vonJ Heimrich. Erkanfrid. Ruodhard. Isangar. Runzolf.
Alarich, dem Dekan Otbert. Adalnot. Selimann. Ebenso die Missale. die Samuel. Babo und
Randulf gehörten. Ebenso zwei Missale von Gelasius. Insgesamt 17.
Bischoff verweist darauf (S.24), daß alle Namen in der Liste des Lorscher Konvents unter
Abt Samuel (837-856) im Reichenauer Verbrüderungsbuch erscheinen.
Bischoff deutet den genannten Babo mit dem in der Konventsliste unter Adalung
(804-837) genannten Pabo. Ein Babo war aber auch von 876-881 Abt von Lorsch. Ein
Theotmar ist auch im Lorscher Codex als Auftraggeber verschiedener Urkunden und im
Rang eines archicapellani zwischen 88Ö und 906 (Urk. 46-50, u.a.) bezeugt. Sollten diese
beiden Babos und Theotmars identisch sein, was -ein hohes Lebensalter vorausgesetzt-
möglich erscheint, ergibt sich für die Datierung auch eine zweite Möglichkeit. (Randulf
ist als Priester (790-817) im Lorscher Codex bezeugt). Das fuerunt legt dann eine Datie-
rung des Kataloges auf die Zeit nach Babos Tod 881, sowie vor der Ernennung Theotmars
74 Eine dieser Ausnahmen ist das sogenannte Seligenstädter Evangeliar, das in Lorsch
geschrieben wurde (Darmstadt Cod. 1957), und in das mehrere Hände Neumen nachgetra-
gen haben