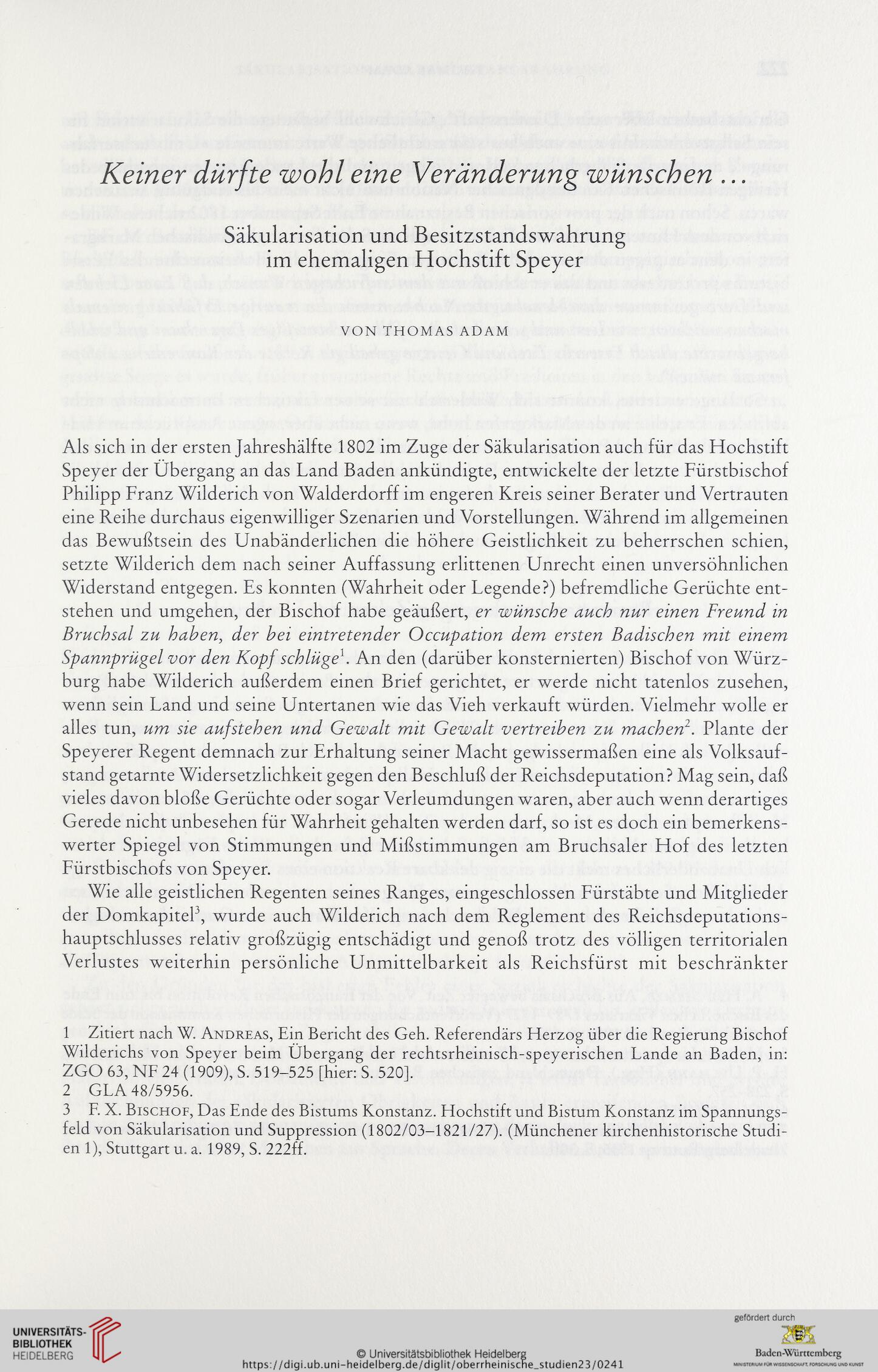Keiner dürfte wohl eine Veränderung wünschen ...
Säkularisation und Besitzstandswahrung
im ehemaligen Hochstift Speyer
VON THOMAS ADAM
Als sich in der ersten Jahreshälfte 1802 im Zuge der Säkularisation auch für das Hochstift
Speyer der Übergang an das Land Baden ankündigte, entwickelte der letzte Fürstbischof
Philipp Franz Wilderich von Walderdorff im engeren Kreis seiner Berater und Vertrauten
eine Reihe durchaus eigenwilliger Szenarien und Vorstellungen. Während im allgemeinen
das Bewußtsein des Unabänderlichen die höhere Geistlichkeit zu beherrschen schien,
setzte Wilderich dem nach seiner Auffassung erlittenen Unrecht einen unversöhnlichen
Widerstand entgegen. Es konnten (Wahrheit oder Legende?) befremdliche Gerüchte ent-
stehen und umgehen, der Bischof habe geäußert, er wünsche auch nur einen Freund in
Bruchsal zu haben, der bei eintretender Occupation dem ersten Badischen mit einem
Spannprügel vor den Kopf schlüge'. An den (darüber konsternierten) Bischof von Würz-
burg habe Wilderich außerdem einen Brief gerichtet, er werde nicht tatenlos zusehen,
wenn sein Land und seine Untertanen wie das Vieh verkauft würden. Vielmehr wolle er
alles tun, um sie aufstehen und Gewalt mit Gewalt vertreiben zu machen1 2. Plante der
Speyerer Regent demnach zur Erhaltung seiner Macht gewissermaßen eine als Volksauf-
stand getarnte Widersetzlichkeit gegen den Beschluß der Reichsdeputation? Mag sein, daß
vieles davon bloße Gerüchte oder sogar Verleumdungen waren, aber auch wenn derartiges
Gerede nicht unbesehen für Wahrheit gehalten werden darf, so ist es doch ein bemerkens-
werter Spiegel von Stimmungen und Mißstimmungen am Bruchsaler Hof des letzten
Fürstbischofs von Speyer.
Wie alle geistlichen Regenten seines Ranges, eingeschlossen Fürstäbte und Mitglieder
der Domkapitel3, wurde auch Wilderich nach dem Reglement des Reichsdeputations-
hauptschlusses relativ großzügig entschädigt und genoß trotz des völligen territorialen
Verlustes weiterhin persönliche Unmittelbarkeit als Reichsfürst mit beschränkter
1 Zitiert nach W. Andreas, Ein Bericht des Geh. Referendars Herzog über die Regierung Bischof
Wilderichs von Speyer beim Übergang der rechtsrheinisch-speyerischen Lande an Baden, in:
ZGO 63, NF 24 (1909), S. 519-525 [hier: S. 520].
2 GLA 48/5956.
3 E X. Bischof, Das Ende des Bistums Konstanz. Hochstift und Bistum Konstanz im Spannungs-
feld von Säkularisation und Suppression (1802/03-1821/27). (Münchener kirchenhistorische Studi-
en 1), Stuttgart u. a. 1989, S. 222ff.
Säkularisation und Besitzstandswahrung
im ehemaligen Hochstift Speyer
VON THOMAS ADAM
Als sich in der ersten Jahreshälfte 1802 im Zuge der Säkularisation auch für das Hochstift
Speyer der Übergang an das Land Baden ankündigte, entwickelte der letzte Fürstbischof
Philipp Franz Wilderich von Walderdorff im engeren Kreis seiner Berater und Vertrauten
eine Reihe durchaus eigenwilliger Szenarien und Vorstellungen. Während im allgemeinen
das Bewußtsein des Unabänderlichen die höhere Geistlichkeit zu beherrschen schien,
setzte Wilderich dem nach seiner Auffassung erlittenen Unrecht einen unversöhnlichen
Widerstand entgegen. Es konnten (Wahrheit oder Legende?) befremdliche Gerüchte ent-
stehen und umgehen, der Bischof habe geäußert, er wünsche auch nur einen Freund in
Bruchsal zu haben, der bei eintretender Occupation dem ersten Badischen mit einem
Spannprügel vor den Kopf schlüge'. An den (darüber konsternierten) Bischof von Würz-
burg habe Wilderich außerdem einen Brief gerichtet, er werde nicht tatenlos zusehen,
wenn sein Land und seine Untertanen wie das Vieh verkauft würden. Vielmehr wolle er
alles tun, um sie aufstehen und Gewalt mit Gewalt vertreiben zu machen1 2. Plante der
Speyerer Regent demnach zur Erhaltung seiner Macht gewissermaßen eine als Volksauf-
stand getarnte Widersetzlichkeit gegen den Beschluß der Reichsdeputation? Mag sein, daß
vieles davon bloße Gerüchte oder sogar Verleumdungen waren, aber auch wenn derartiges
Gerede nicht unbesehen für Wahrheit gehalten werden darf, so ist es doch ein bemerkens-
werter Spiegel von Stimmungen und Mißstimmungen am Bruchsaler Hof des letzten
Fürstbischofs von Speyer.
Wie alle geistlichen Regenten seines Ranges, eingeschlossen Fürstäbte und Mitglieder
der Domkapitel3, wurde auch Wilderich nach dem Reglement des Reichsdeputations-
hauptschlusses relativ großzügig entschädigt und genoß trotz des völligen territorialen
Verlustes weiterhin persönliche Unmittelbarkeit als Reichsfürst mit beschränkter
1 Zitiert nach W. Andreas, Ein Bericht des Geh. Referendars Herzog über die Regierung Bischof
Wilderichs von Speyer beim Übergang der rechtsrheinisch-speyerischen Lande an Baden, in:
ZGO 63, NF 24 (1909), S. 519-525 [hier: S. 520].
2 GLA 48/5956.
3 E X. Bischof, Das Ende des Bistums Konstanz. Hochstift und Bistum Konstanz im Spannungs-
feld von Säkularisation und Suppression (1802/03-1821/27). (Münchener kirchenhistorische Studi-
en 1), Stuttgart u. a. 1989, S. 222ff.