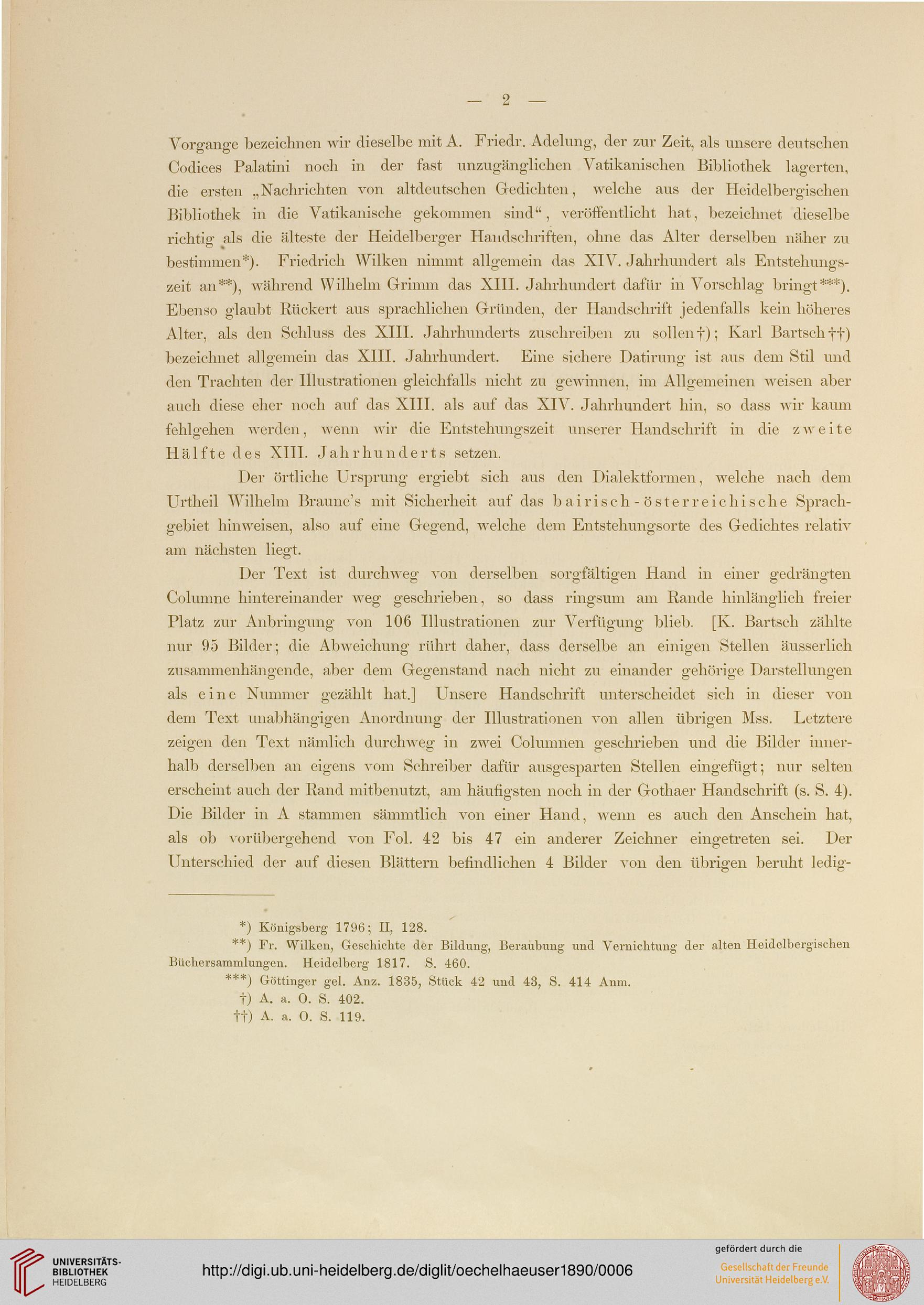Vorgange bezeichnen wir dieselbe mit A. Friedr. Adelung, der zur Zeit, als unsere deutschen
Codices Palatini noch in der fast unzugänglichen Vatikanischen Bibliothek lagerten,
die ersten „Nachrichten von altdeutschen Gedichten, welche aus der Heidelbergischen
Bibliothek in die Vatikanische gekommen sind", veröffentlicht hat, bezeichnet dieselbe
richtig als die älteste der Heidelberger Handschriften, ohne das Alter derselben näher zu
bestimmen*). Friedrich Wilken nimmt allgemein das XIV. Jahrhundert als Entstehungs-
zeit an**), während Wilhelm Grimm das XIII. Jahrhundert dafür in Vorschlag bringt***).
Ebenso glaubt Rückert aus sprachlichen Gründen, der Handschrift jedenfalls kein höheres
Alter, als den Schluss des XIII. Jahrhunderts zuschreiben zu sollen f); Karl Bartsch ff)
bezeichnet allgemein das XIII. Jahrhundert. Eine sichere Datirung ist aus dem Stil und
den Trachten der Illustrationen gleichfalls nicht zu gewinnen, im Allgemeinen weisen aber
auch diese eher noch auf das XIII. als auf das XIV. Jahrhundert hin, so dass wir kaum
fehlgehen werden, wenn wir die Entstehungszeit unserer Handschrift in die zweite
Hälfte des XIII. Jahrhunderts setzen.
Der örtliche Ursprung ergiebt sich aus den Dialektformen, welche nach dem
Urtheil Wilhelm Braune's mit Sicherheit auf das bairisch-österreichische Sprach-
gebiet hinweisen, also auf eine Gegend, welche dem Entstehungsorte des Gedichtes relativ
am nächsten liegt.
Der Text ist durchweg von derselben sorgfältigen Hand in einer gedrängten
Columne hintereinander weg geschrieben, so dass ringsum am Rande hinlänglich freier
Platz zur Anbringung von 106 Illustrationen zur Verfügung blieb. [K. Bartsch zählte
nur 95 Bilder; die Abweichung rührt daher, dass derselbe an einigen Stellen ausser lieh
zusammenhängende, aber dem Gegenstand nach nicht zu einander gehörige Darstellungen
als eine Nummer gezählt hat.] Unsere Handschrift unterscheidet sich in dieser von
dem Text unabhängigen Anordnung der Illustrationen von allen übrigen Mss. Letztere
zeigen den Text nämlich durchweg in zwei Columnen geschrieben und die Bilder inner-
halb derselben an eigens vom Schreiber dafür ausgesparten Stellen eingefügt; nur selten
erscheint auch der Rand mitbenutzt, am häufigsten noch in der Gothaer Handschrift (s. S. 4).
Die Bilder in A stammen sämmtlich von einer Hand, wenn es auch den Anschein hat,
als ob vorübergehend von Fol. 42 bis 47 ein anderer Zeichner eingetreten sei. Der
Unterschied der auf diesen Blättern befindlichen 4 Bilder von den übrigen beruht ledig-
*) Königsberg 1796; II, 128.
**) Fr. Wilken, Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heidelbergischen
Büchersammlungen. Heidelberg 1817. S. 460.
***) Göttinger gel. Anz. 1835, Stück 42 und 43, S. 414 Anm.
t) A. a. 0. S. 402.
tt) A. a. 0. S. 119.
Codices Palatini noch in der fast unzugänglichen Vatikanischen Bibliothek lagerten,
die ersten „Nachrichten von altdeutschen Gedichten, welche aus der Heidelbergischen
Bibliothek in die Vatikanische gekommen sind", veröffentlicht hat, bezeichnet dieselbe
richtig als die älteste der Heidelberger Handschriften, ohne das Alter derselben näher zu
bestimmen*). Friedrich Wilken nimmt allgemein das XIV. Jahrhundert als Entstehungs-
zeit an**), während Wilhelm Grimm das XIII. Jahrhundert dafür in Vorschlag bringt***).
Ebenso glaubt Rückert aus sprachlichen Gründen, der Handschrift jedenfalls kein höheres
Alter, als den Schluss des XIII. Jahrhunderts zuschreiben zu sollen f); Karl Bartsch ff)
bezeichnet allgemein das XIII. Jahrhundert. Eine sichere Datirung ist aus dem Stil und
den Trachten der Illustrationen gleichfalls nicht zu gewinnen, im Allgemeinen weisen aber
auch diese eher noch auf das XIII. als auf das XIV. Jahrhundert hin, so dass wir kaum
fehlgehen werden, wenn wir die Entstehungszeit unserer Handschrift in die zweite
Hälfte des XIII. Jahrhunderts setzen.
Der örtliche Ursprung ergiebt sich aus den Dialektformen, welche nach dem
Urtheil Wilhelm Braune's mit Sicherheit auf das bairisch-österreichische Sprach-
gebiet hinweisen, also auf eine Gegend, welche dem Entstehungsorte des Gedichtes relativ
am nächsten liegt.
Der Text ist durchweg von derselben sorgfältigen Hand in einer gedrängten
Columne hintereinander weg geschrieben, so dass ringsum am Rande hinlänglich freier
Platz zur Anbringung von 106 Illustrationen zur Verfügung blieb. [K. Bartsch zählte
nur 95 Bilder; die Abweichung rührt daher, dass derselbe an einigen Stellen ausser lieh
zusammenhängende, aber dem Gegenstand nach nicht zu einander gehörige Darstellungen
als eine Nummer gezählt hat.] Unsere Handschrift unterscheidet sich in dieser von
dem Text unabhängigen Anordnung der Illustrationen von allen übrigen Mss. Letztere
zeigen den Text nämlich durchweg in zwei Columnen geschrieben und die Bilder inner-
halb derselben an eigens vom Schreiber dafür ausgesparten Stellen eingefügt; nur selten
erscheint auch der Rand mitbenutzt, am häufigsten noch in der Gothaer Handschrift (s. S. 4).
Die Bilder in A stammen sämmtlich von einer Hand, wenn es auch den Anschein hat,
als ob vorübergehend von Fol. 42 bis 47 ein anderer Zeichner eingetreten sei. Der
Unterschied der auf diesen Blättern befindlichen 4 Bilder von den übrigen beruht ledig-
*) Königsberg 1796; II, 128.
**) Fr. Wilken, Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heidelbergischen
Büchersammlungen. Heidelberg 1817. S. 460.
***) Göttinger gel. Anz. 1835, Stück 42 und 43, S. 414 Anm.
t) A. a. 0. S. 402.
tt) A. a. 0. S. 119.