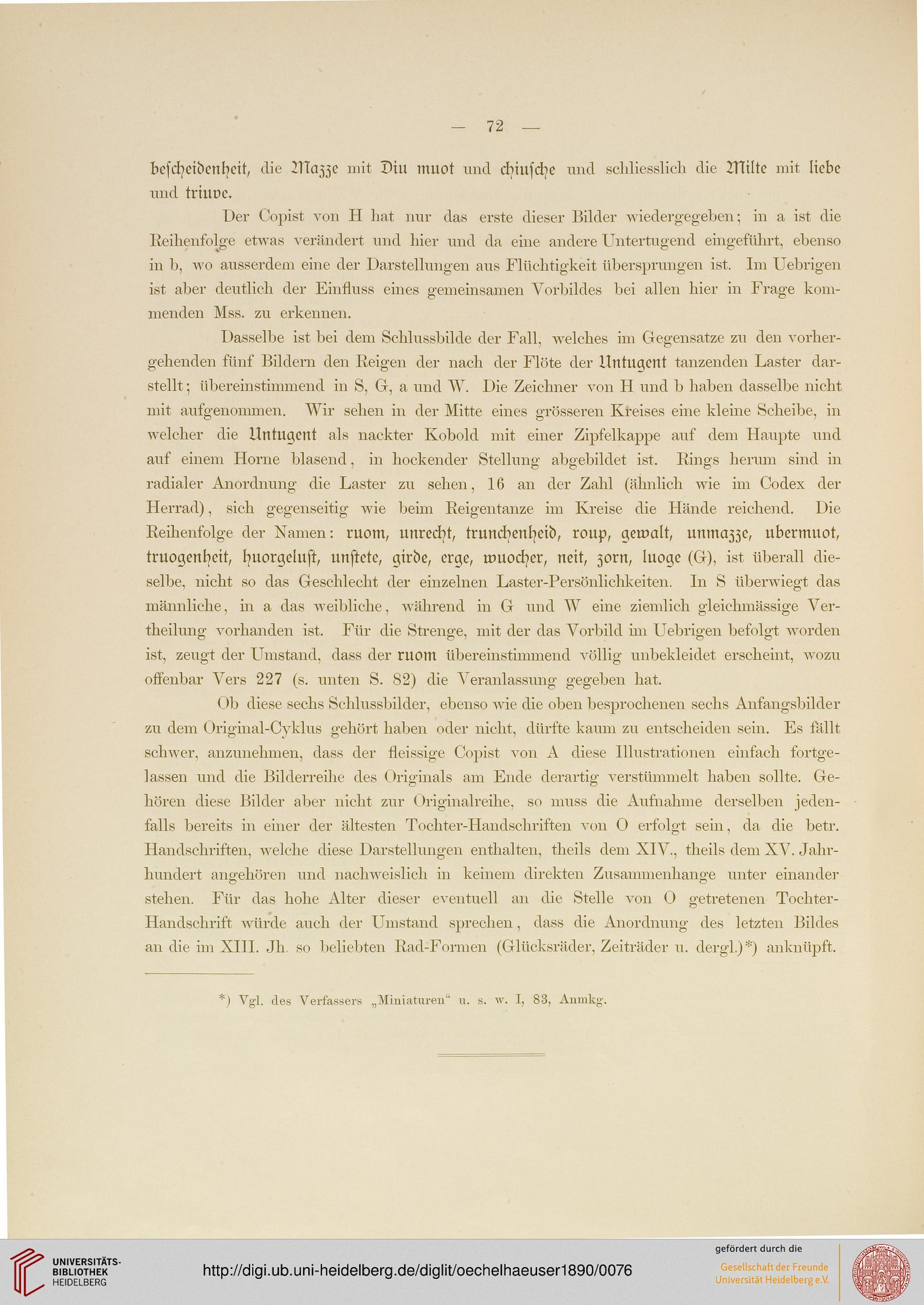- 72 —
bcfcbeiöcnbeit, die ITTajje mit Diu muot und cbiufcbe und schliesslich die Ztlüte mit liebe
und trtUüc.
Der Copist von H hat nur das erste dieser Bilder wiedergegeben; in a ist die
Reihenfolge etwas verändert und hier und da eine andere Untertugend eingeführt, ebenso
in b, wo ausserdem eine der Darstellungen aus Flüchtigkeit übersprungen ist. Im Uebrigen
ist aber deutlich der Einfluss eines gemeinsamen Vorbildes bei allen hier in Frage kom-
menden Mss. zu erkennen.
Dasselbe ist bei dem Schlussbilde der Fall, welches im Gegensatze zu den vorher-
gehenden fünf Bildern den Reigen der nach der Flöte der llntugent tanzenden Laster dar-
stellt ; übereinstimmend in S, G, a und W. Die Zeichner von H und b haben dasselbe nicht
mit aufgenommen. Wir sehen in der Mitte eines grösseren Kreises eine kleine Scheibe, in
welcher die llntugent als nackter Kobold mit einer Zipfelkappe auf dem Haupte und
auf einem Hörne blasend, in hockender Stellung abgebildet ist. Rings herum sind in
radialer Anordnung die Laster zu sehen, 16 an der Zahl (ähnlich wie im Codex der
Herrad), sich gegenseitig wie beim Reigentanze im Kreise die Hände reichend. Die
Reihenfolge der Namen: ruom, unrecht, trunchenrjeti), roup, geroalt, unme^je, ubermuot,
truogenfycit, buorgeluft, unftete, girbe, erge, nmoeber, neit, 30m, luoge (Gr), ist überall die-
selbe, nicht so das Geschlecht der einzelnen Laster-Persönlichkeiten. In S überwiegt das
männliche, in a das weibliche, während in G und W eine ziemlich gleichmässige Ver-
theilung vorhanden ist. Für die Strenge, mit der das Vorbild im Uebrigen befolgt wrorden
ist, zeugt der Umstand, dass der ruom übereinstimmend völlig unbekleidet erscheint, wozu
offenbar Vers 227 (s. unten S. 82) die Veranlassung gegeben hat.
Ob diese sechs Schlussbilder, ebenso wie die oben besprochenen sechs Anfangsbilder
zu dem Original-Cyklus gehört haben oder nicht, dürfte kaum zu entscheiden sein. Es fällt
schwer, anzunehmen, dass der fleissige Copist von A diese Illustrationen einfach fortge-
lassen und die Bilderreihe des Originals am Ende derartig verstümmelt haben sollte. Ge-
hören diese Bilder aber nicht zur Originalreihe, so muss die Aufnahme derselben jeden-
falls bereits in einer der ältesten Tochter-Handschriften von 0 erfolgt sein, da die betr.
Handschriften, welche diese Darstellungen enthalten, theils dem XIV., theils dem XV. Jahr-
hundert angehören und nachweislich in keinem direkten Zusammenhange unter einander
stehen. Für das hohe Alter dieser eventuell an die Stelle von O getretenen Tochter-
Handschrift würde auch der Umstand sprechen, dass die Anordnung des letzten Bildes
an die im XIII. Jh. so beliebten Rad-Formen (Glücksräder, Zeiträder u. dergl.)*) anknüpft.
*) Vgl. des Verfassers „Miniaturen" u. s. w. I, 83, Anmkg.
bcfcbeiöcnbeit, die ITTajje mit Diu muot und cbiufcbe und schliesslich die Ztlüte mit liebe
und trtUüc.
Der Copist von H hat nur das erste dieser Bilder wiedergegeben; in a ist die
Reihenfolge etwas verändert und hier und da eine andere Untertugend eingeführt, ebenso
in b, wo ausserdem eine der Darstellungen aus Flüchtigkeit übersprungen ist. Im Uebrigen
ist aber deutlich der Einfluss eines gemeinsamen Vorbildes bei allen hier in Frage kom-
menden Mss. zu erkennen.
Dasselbe ist bei dem Schlussbilde der Fall, welches im Gegensatze zu den vorher-
gehenden fünf Bildern den Reigen der nach der Flöte der llntugent tanzenden Laster dar-
stellt ; übereinstimmend in S, G, a und W. Die Zeichner von H und b haben dasselbe nicht
mit aufgenommen. Wir sehen in der Mitte eines grösseren Kreises eine kleine Scheibe, in
welcher die llntugent als nackter Kobold mit einer Zipfelkappe auf dem Haupte und
auf einem Hörne blasend, in hockender Stellung abgebildet ist. Rings herum sind in
radialer Anordnung die Laster zu sehen, 16 an der Zahl (ähnlich wie im Codex der
Herrad), sich gegenseitig wie beim Reigentanze im Kreise die Hände reichend. Die
Reihenfolge der Namen: ruom, unrecht, trunchenrjeti), roup, geroalt, unme^je, ubermuot,
truogenfycit, buorgeluft, unftete, girbe, erge, nmoeber, neit, 30m, luoge (Gr), ist überall die-
selbe, nicht so das Geschlecht der einzelnen Laster-Persönlichkeiten. In S überwiegt das
männliche, in a das weibliche, während in G und W eine ziemlich gleichmässige Ver-
theilung vorhanden ist. Für die Strenge, mit der das Vorbild im Uebrigen befolgt wrorden
ist, zeugt der Umstand, dass der ruom übereinstimmend völlig unbekleidet erscheint, wozu
offenbar Vers 227 (s. unten S. 82) die Veranlassung gegeben hat.
Ob diese sechs Schlussbilder, ebenso wie die oben besprochenen sechs Anfangsbilder
zu dem Original-Cyklus gehört haben oder nicht, dürfte kaum zu entscheiden sein. Es fällt
schwer, anzunehmen, dass der fleissige Copist von A diese Illustrationen einfach fortge-
lassen und die Bilderreihe des Originals am Ende derartig verstümmelt haben sollte. Ge-
hören diese Bilder aber nicht zur Originalreihe, so muss die Aufnahme derselben jeden-
falls bereits in einer der ältesten Tochter-Handschriften von 0 erfolgt sein, da die betr.
Handschriften, welche diese Darstellungen enthalten, theils dem XIV., theils dem XV. Jahr-
hundert angehören und nachweislich in keinem direkten Zusammenhange unter einander
stehen. Für das hohe Alter dieser eventuell an die Stelle von O getretenen Tochter-
Handschrift würde auch der Umstand sprechen, dass die Anordnung des letzten Bildes
an die im XIII. Jh. so beliebten Rad-Formen (Glücksräder, Zeiträder u. dergl.)*) anknüpft.
*) Vgl. des Verfassers „Miniaturen" u. s. w. I, 83, Anmkg.