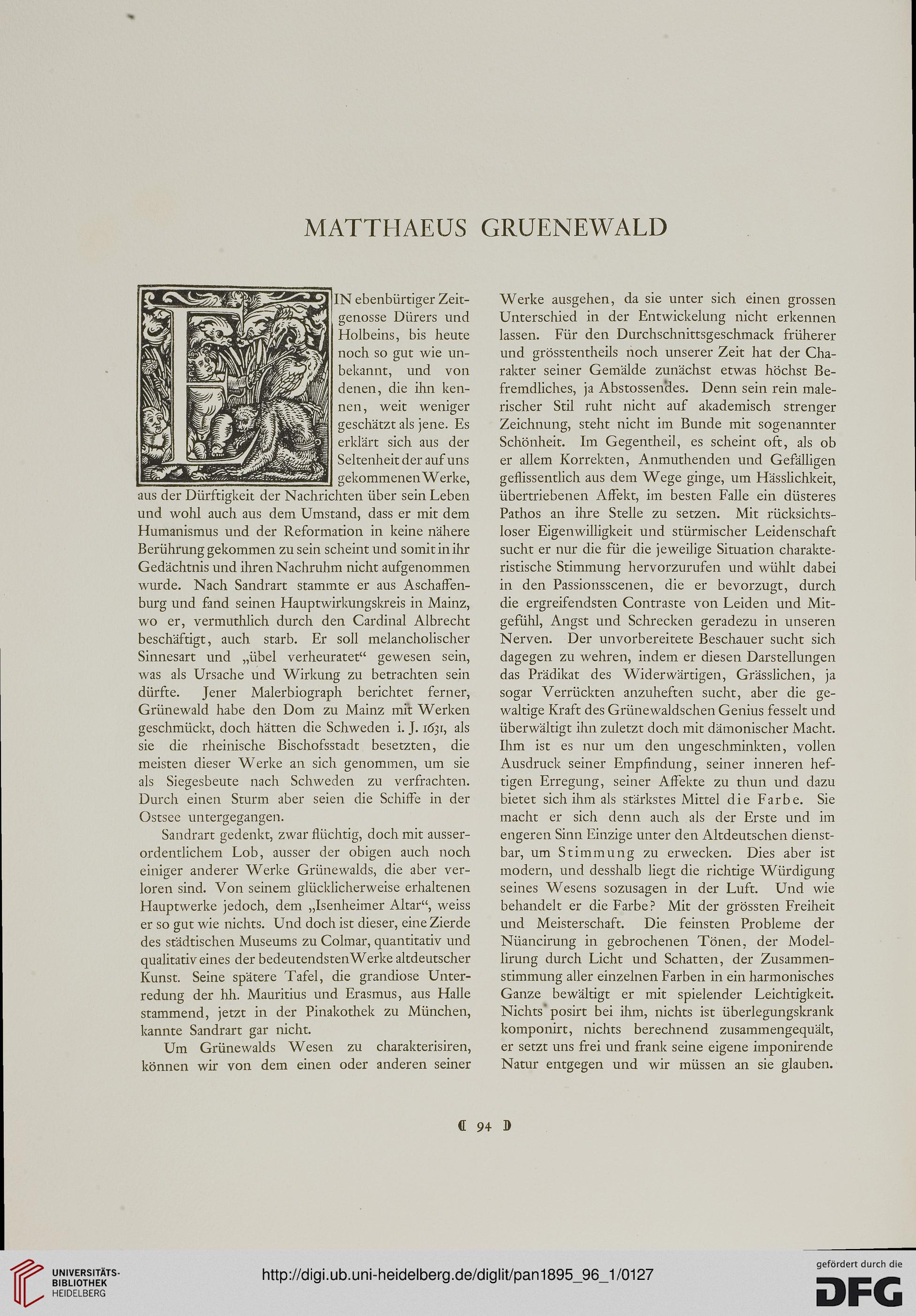MATTHAE US GRUENEWALD
[JN^fg^
;*ü
■röauÄ
jS-^^f jjyjb rfc/n
Ww^Mk
■F 'ffl
m
HI|M*>£^^
Wm%il^Wi
Pf
t^^^P
lÄ^l«^!
IN ebenbürtiger Zeit-
genosse Dürers und
Holbeins, bis heute
noch so gut wie un-
bekannt, und von
denen, die ihn ken-
nen , weit weniger
geschätzt als jene. Es
erklärt sich aus der
Seltenheit der auf uns
gekommenen Werke,
aus der Dürftigkeit der Nachrichten über sein Leben
und wohl auch aus dem Umstand, dass er mit dem
Humanismus und der Reformation in keine nähere
Berührung gekommen zusein scheint und somit in ihr
Gedächtnis und ihren Nachruhm nicht aufgenommen
wurde. Nach Sandrart stammte er aus Aschaffen-
burg und fand seinen Hauptwirkungskreis in Mainz,
wo er, vermuthlich durch den Cardinal Albrecht
beschäftigt, auch starb. Er soll melancholischer
Sinnesart und „übel verheuratet" gewesen sein,
was als Ursache und Wirkung zu betrachten sein
dürfte. Jener Malerbiograph berichtet ferner,
Grünewald habe den Dom zu Mainz mit Werken
geschmückt, doch hätten die Schweden i. J. 1631, als
sie die rheinische Bischofsstadt besetzten, die
meisten dieser Werke an sich genommen, um sie
als Siegesbeute nach Schweden zu verfrachten.
Durch einen Sturm aber seien die Schiffe in der
Ostsee untergegangen.
Sandrart gedenkt, zwar flüchtig, doch mit ausser-
ordentlichem Lob, ausser der obigen auch noch
einiger anderer Werke Grünewalds, die aber ver-
loren sind. Von seinem glücklicherweise erhaltenen
Hauptwerke jedoch, dem „Isenheimer Altar", weiss
er so gut wie nichts. Und doch ist dieser, eine Zierde
des städtischen Museums zu Colmar, quantitativ und
qualitativ eines der bedeutendsten Werke altdeutscher
Kunst. Seine spätere Tafel, die grandiose Unter-
redung der hh. Mauritius und Erasmus, aus Halle
stammend, jetzt in der Pinakothek zu München,
kannte Sandrart gar nicht.
Um Grünewalds Wesen zu charakterisiren,
können wir von dem einen oder anderen seiner
Werke ausgehen, da sie unter sich einen grossen
Unterschied in der Entwicklung nicht erkennen
lassen. Für den Durchschnittsgeschmack früherer
und grösstentheils noch unserer Zeit hat der Cha-
rakter seiner Gemälde zunächst etwas höchst Be-
fremdliches, ja Abstossen'des. Denn sein rein male-
rischer Stil ruht nicht auf akademisch strenger
Zeichnung, steht nicht im Bunde mit sogenannter
Schönheit. Im Gegentheil, es scheint oft, als ob
er allem Korrekten, Anmuthenden und Gefälligen
geflissentlich aus dem Wege ginge, um Hässlichkeit,
übertriebenen Affekt, im besten Falle ein düsteres
Pathos an ihre Stelle zu setzen. Mit rücksichts-
loser Eigenwilligkeit und stürmischer Leidenschaft
sucht er nur die für die jeweilige Situation charakte-
ristische Stimmung hervorzurufen und wühlt dabei
in den Passionsscenen, die er bevorzugt, durch
die ergreifendsten Contraste von Leiden und Mit-
gefühl, Angst und Schrecken geradezu in unseren
Nerven. Der unvorbereitete Beschauer sucht sich
dagegen zu wehren, indem er diesen Darstellungen
das Prädikat des Widerwärtigen, Grässlichen, ja
sogar Verrückten anzuheften sucht, aber die ge-
waltige Kraft des Grünewaldschen Genius fesselt und
überwältigt ihn zuletzt doch mit dämonischer Macht.
Ihm ist es nur um den ungeschminkten, vollen
Ausdruck seiner Empfindung, seiner inneren hef-
tigen Erregung, seiner Affekte zu thun und dazu
bietet sich ihm als stärkstes Mittel die Farbe. Sie
macht er sich denn auch als der Erste und im
engeren Sinn Einzige unter den Altdeutschen dienst-
bar, um Stimmung zu erwecken. Dies aber ist
modern, und desshalb liegt die richtige Würdigung
seines Wesens sozusagen in der Luft. Und wie
behandelt er die Farbe ? Mit der grössten Freiheit
und Meisterschaft. Die feinsten Probleme der
Nüancirung in gebrochenen Tönen, der Model-
lirung durch Licht und Schatten, der Zusammen-
stimmung aller einzelnen Farben in ein harmonisches
Ganze bewältigt er mit spielender Leichtigkeit.
Nichts'posirt bei ihm, nichts ist überlegungskrank
komponirt, nichts berechnend zusammengequält,
er setzt uns frei und frank seine eigene imponirende
Natur entgegen und wir müssen an sie glauben.
<[ 94 »
[JN^fg^
;*ü
■röauÄ
jS-^^f jjyjb rfc/n
Ww^Mk
■F 'ffl
m
HI|M*>£^^
Wm%il^Wi
Pf
t^^^P
lÄ^l«^!
IN ebenbürtiger Zeit-
genosse Dürers und
Holbeins, bis heute
noch so gut wie un-
bekannt, und von
denen, die ihn ken-
nen , weit weniger
geschätzt als jene. Es
erklärt sich aus der
Seltenheit der auf uns
gekommenen Werke,
aus der Dürftigkeit der Nachrichten über sein Leben
und wohl auch aus dem Umstand, dass er mit dem
Humanismus und der Reformation in keine nähere
Berührung gekommen zusein scheint und somit in ihr
Gedächtnis und ihren Nachruhm nicht aufgenommen
wurde. Nach Sandrart stammte er aus Aschaffen-
burg und fand seinen Hauptwirkungskreis in Mainz,
wo er, vermuthlich durch den Cardinal Albrecht
beschäftigt, auch starb. Er soll melancholischer
Sinnesart und „übel verheuratet" gewesen sein,
was als Ursache und Wirkung zu betrachten sein
dürfte. Jener Malerbiograph berichtet ferner,
Grünewald habe den Dom zu Mainz mit Werken
geschmückt, doch hätten die Schweden i. J. 1631, als
sie die rheinische Bischofsstadt besetzten, die
meisten dieser Werke an sich genommen, um sie
als Siegesbeute nach Schweden zu verfrachten.
Durch einen Sturm aber seien die Schiffe in der
Ostsee untergegangen.
Sandrart gedenkt, zwar flüchtig, doch mit ausser-
ordentlichem Lob, ausser der obigen auch noch
einiger anderer Werke Grünewalds, die aber ver-
loren sind. Von seinem glücklicherweise erhaltenen
Hauptwerke jedoch, dem „Isenheimer Altar", weiss
er so gut wie nichts. Und doch ist dieser, eine Zierde
des städtischen Museums zu Colmar, quantitativ und
qualitativ eines der bedeutendsten Werke altdeutscher
Kunst. Seine spätere Tafel, die grandiose Unter-
redung der hh. Mauritius und Erasmus, aus Halle
stammend, jetzt in der Pinakothek zu München,
kannte Sandrart gar nicht.
Um Grünewalds Wesen zu charakterisiren,
können wir von dem einen oder anderen seiner
Werke ausgehen, da sie unter sich einen grossen
Unterschied in der Entwicklung nicht erkennen
lassen. Für den Durchschnittsgeschmack früherer
und grösstentheils noch unserer Zeit hat der Cha-
rakter seiner Gemälde zunächst etwas höchst Be-
fremdliches, ja Abstossen'des. Denn sein rein male-
rischer Stil ruht nicht auf akademisch strenger
Zeichnung, steht nicht im Bunde mit sogenannter
Schönheit. Im Gegentheil, es scheint oft, als ob
er allem Korrekten, Anmuthenden und Gefälligen
geflissentlich aus dem Wege ginge, um Hässlichkeit,
übertriebenen Affekt, im besten Falle ein düsteres
Pathos an ihre Stelle zu setzen. Mit rücksichts-
loser Eigenwilligkeit und stürmischer Leidenschaft
sucht er nur die für die jeweilige Situation charakte-
ristische Stimmung hervorzurufen und wühlt dabei
in den Passionsscenen, die er bevorzugt, durch
die ergreifendsten Contraste von Leiden und Mit-
gefühl, Angst und Schrecken geradezu in unseren
Nerven. Der unvorbereitete Beschauer sucht sich
dagegen zu wehren, indem er diesen Darstellungen
das Prädikat des Widerwärtigen, Grässlichen, ja
sogar Verrückten anzuheften sucht, aber die ge-
waltige Kraft des Grünewaldschen Genius fesselt und
überwältigt ihn zuletzt doch mit dämonischer Macht.
Ihm ist es nur um den ungeschminkten, vollen
Ausdruck seiner Empfindung, seiner inneren hef-
tigen Erregung, seiner Affekte zu thun und dazu
bietet sich ihm als stärkstes Mittel die Farbe. Sie
macht er sich denn auch als der Erste und im
engeren Sinn Einzige unter den Altdeutschen dienst-
bar, um Stimmung zu erwecken. Dies aber ist
modern, und desshalb liegt die richtige Würdigung
seines Wesens sozusagen in der Luft. Und wie
behandelt er die Farbe ? Mit der grössten Freiheit
und Meisterschaft. Die feinsten Probleme der
Nüancirung in gebrochenen Tönen, der Model-
lirung durch Licht und Schatten, der Zusammen-
stimmung aller einzelnen Farben in ein harmonisches
Ganze bewältigt er mit spielender Leichtigkeit.
Nichts'posirt bei ihm, nichts ist überlegungskrank
komponirt, nichts berechnend zusammengequält,
er setzt uns frei und frank seine eigene imponirende
Natur entgegen und wir müssen an sie glauben.
<[ 94 »