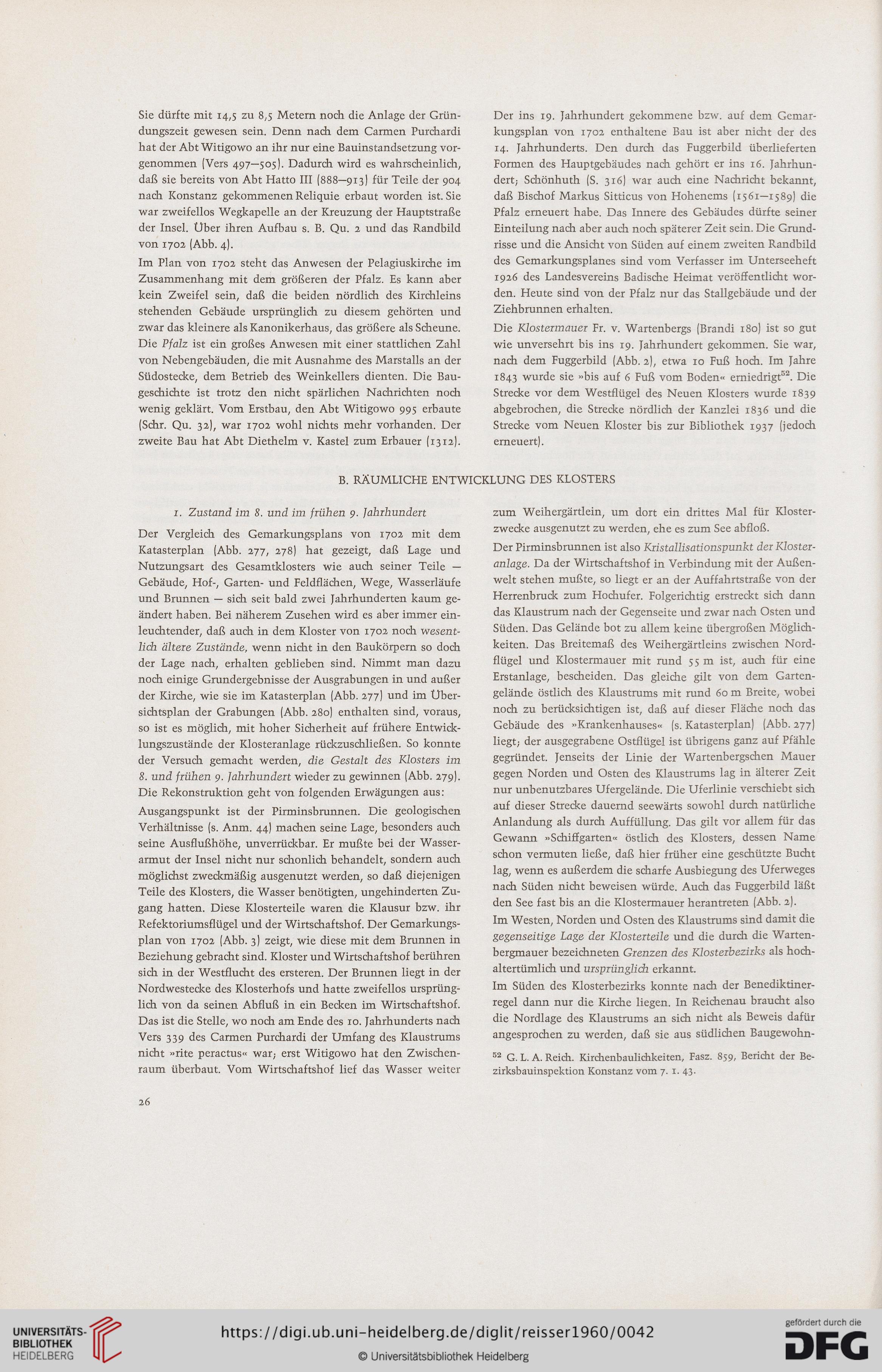Sie dürfte mit 14,5 zu 8,5 Metern noch die Anlage der Grün-
dungszeit gewesen sein. Denn nach dem Carmen Purchardi
hat der Abt Witigowo an ihr nur eine Bauinstandsetzung vor-
genommen (Vers 497—505). Dadurch wird es wahrscheinlich,
daß sie bereits von Abt Hatto III (888—913) für Teile der 904
nach Konstanz gekommenen Reliquie erbaut worden ist. Sie
war zweifellos Wegkapelle an der Kreuzung der Hauptstraße
der Insel. Uber ihren Aufbau s. B. Qu. 2 und das Randbild
von 1702 (Abb. 4).
Im Plan von 1702 steht das Anwesen der Pelagiuskirche im
Zusammenhang mit dem größeren der Pfalz. Es kann aber
kein Zweifel sein, daß die beiden nördlich des Kirchleins
stehenden Gebäude ursprünglich zu diesem gehörten und
zwar das kleinere als Kanonikerhaus, das größere als Scheune.
Die Pfalz ist ein großes Anwesen mit einer stattlichen Zahl
von Nebengebäuden, die mit Ausnahme des Marstalls an der
Südostecke, dem Betrieb des Weinkellers dienten. Die Bau-
geschichte ist trotz den nicht spärlichen Nachrichten noch
wenig geklärt. Vom Erstbau, den Abt Witigowo 995 erbaute
(Sehr. Qu. 32), war 1702 wohl nichts mehr vorhanden. Der
zweite Bau hat Abt Diethelm v. Kastel zum Erbauer (1312).
Der ins 19. Jahrhundert gekommene bzw. auf dem Gemar-
kungsplan von 1702 enthaltene Bau ist aber nicht der des
14. Jahrhunderts. Den durch das Fuggerbild überlieferten
Formen des Hauptgebäudes nach gehört er ins 16. Jahrhun-
dert; Schönhuth (S. 316) war auch eine Nachricht bekannt,
daß Bischof Markus Sitticus von Hohenems (1561—1589) die
Pfalz erneuert habe. Das Innere des Gebäudes dürfte seiner
Einteilung nach aber auch noch späterer Zeit sein. Die Grund-
risse und die Ansicht von Süden auf einem zweiten Randbild
des Gemarkungsplanes sind vom Verfasser im Unterseeheft
1926 des Landesvereins Badische Heimat veröffentlicht wor-
den. Heute sind von der Pfalz nur das Stallgebäude und der
Ziehbrunnen erhalten.
Die Klostermauer Fr. v. Wartenbergs (Brandi 180) ist so gut
wie unversehrt bis ins 19. Jahrhundert gekommen. Sie war,
nach dem Fuggerbild (Abb. 2), etwa 10 Fuß hoch. Im Jahre
1843 wurde sie »bis auf 6 Fuß vom Boden« erniedrigt52. Die
Strecke vor dem Westflügel des Neuen Klosters wurde 1839
abgebrochen, die Strecke nördlich der Kanzlei 1836 und die
Strecke vom Neuen Kloster bis zur Bibliothek 1937 (jedoch
erneuert).
B. RÄUMLICHE ENTWICKLUNG DES KLOSTERS
1. Zustand im 8. und im frühen 9. Jahrhundert
Der Vergleich des Gemarkungsplans von 1702 mit dem
Katasterplan (Abb. 277, 278) hat gezeigt, daß Lage und
Nutzungsart des Gesamtklosters wie auch seiner Teile —
Gebäude, Hof-, Garten- und Feldflächen, Wege, Wasserläufe
und Brunnen — sich seit bald zwei Jahrhunderten kaum ge-
ändert haben. Bei näherem Zusehen wird es aber immer ein-
leuchtender, daß auch in dem Kloster von 1702 noch wesent-
lich ältere Zustände, wenn nicht in den Baukörpem so doch
der Lage nach, erhalten geblieben sind. Nimmt man dazu
noch einige Grundergebnisse der Ausgrabungen in und außer
der Kirche, wie sie im Katasterplan (Abb. 277) und im Uber-
sichtsplan der Grabungen (Abb. 280) enthalten sind, voraus,
so ist es möglich, mit hoher Sicherheit auf frühere Entwick-
lungszustände der Klosteranlage rückzuschließen. So konnte
der Versuch gemacht werden, die Gestalt des Klosters im
8. und frühen 9. Jahrhundert wieder zu gewinnen (Abb. 279).
Die Rekonstruktion geht von folgenden Erwägungen aus:
Ausgangspunkt ist der Pirminsbrunnen. Die geologischen
Verhältnisse (s. Anm. 44) machen seine Lage, besonders auch
seine Ausflußhöhe, unverrückbar. Er mußte bei der Wasser-
armut der Insel nicht nur schonlich behandelt, sondern auch
möglichst zweckmäßig ausgenutzt werden, so daß diejenigen
Teile des Klosters, die Wasser benötigten, ungehinderten Zu-
gang hatten. Diese Klosterteile waren die Klausur bzw. ihr
Refektoriumsflügel und der Wirtschaftshof. Der Gemarkungs-
plan von 1702 (Abb. 3) zeigt, wie diese mit dem Brunnen in
Beziehung gebracht sind. Kloster und Wirtschaftshof berühren
sich in der Westflucht des ersteren. Der Brunnen liegt in der
Nordwestecke des Klosterhofs und hatte zweifellos ursprüng-
lich von da seinen Abfluß in ein Becken im Wirtschaftshof.
Das ist die Stelle, wo noch am Ende des 10. Jahrhunderts nach
Vers 339 des Carmen Purchardi der Umfang des Klaustrums
nicht »rite peractus« war,- erst Witigowo hat den Zwischen-
raum überbaut. Vom Wirtschaftshof lief das Wasser weiter
zum Weihergärtlein, um dort ein drittes Mal für Kloster-
zwecke ausgenutzt zu werden, ehe es zum See abfloß.
Der Pirminsbrunnen ist also Kristallisationspunkt der Kloster-
anlage. Da der Wirtschaftshof in Verbindung mit der Außen-
welt stehen mußte, so liegt er an der Auffahrtstraße von der
Herrenbruck zum Hochufer. Folgerichtig erstreckt sich dann
das Klaustrum nach der Gegenseite und zwar nach Osten und
Süden. Das Gelände bot zu allem keine übergroßen Möglich-
keiten. Das Breitemaß des Weihergärtleins zwischen Nord-
flügel und Klostermauer mit rund 55 m ist, auch für eine
Erstanlage, bescheiden. Das gleiche gilt von dem Garten-
gelände östlich des Klaustrums mit rund 60 m Breite, wobei
noch zu berücksichtigen ist, daß auf dieser Fläche noch das
Gebäude des »Krankenhauses« (s. Katasterplan) (Abb. 277)
liegt; der ausgegrabene Ostflügel ist übrigens ganz auf Pfähle
gegründet. Jenseits der Linie der Wartenbergschen Mauer
gegen Norden und Osten des Klaustrums lag in älterer Zeit
nur unbenutzbares Ufergelände. Die Uferlinie verschiebt sich
auf dieser Strecke dauernd seewärts sowohl durch natürliche
Anlandung als durch Auffüllung. Das gilt vor allem für das
Gewann »Schiffgarten« östlich des Klosters, dessen Name
schon vermuten ließe, daß hier früher eine geschützte Bucht
lag, wenn es außerdem die scharfe Ausbiegung des Uferweges
nach Süden nicht beweisen würde. Auch das Fuggerbild läßt
den See fast bis an die Klostermauer herantreten (Abb. 2).
Im Westen, Norden und Osten des Klaustrums sind damit die
gegenseitige Lage der Klosterteile und die durch die Warten-
bergmauer bezeichneten Grenzen des Klosterbezirks als hoch-
altertümlich und ursprünglich erkannt.
Im Süden des Klosterbezirks konnte nach der Benediktiner-
regel dann nur die Kirche liegen. In Reichenau braucht also
die Nordlage des Klaustrums an sich nicht als Beweis dafür
angesprochen zu werden, daß sie aus südlichen Baugewohn-
52 G. L. A. Reich. Kirchenbaulichkeiten, Fasz. 859, Bericht der Be-
zirksbauinspektion Konstanz vom 7. 1. 43.
26
dungszeit gewesen sein. Denn nach dem Carmen Purchardi
hat der Abt Witigowo an ihr nur eine Bauinstandsetzung vor-
genommen (Vers 497—505). Dadurch wird es wahrscheinlich,
daß sie bereits von Abt Hatto III (888—913) für Teile der 904
nach Konstanz gekommenen Reliquie erbaut worden ist. Sie
war zweifellos Wegkapelle an der Kreuzung der Hauptstraße
der Insel. Uber ihren Aufbau s. B. Qu. 2 und das Randbild
von 1702 (Abb. 4).
Im Plan von 1702 steht das Anwesen der Pelagiuskirche im
Zusammenhang mit dem größeren der Pfalz. Es kann aber
kein Zweifel sein, daß die beiden nördlich des Kirchleins
stehenden Gebäude ursprünglich zu diesem gehörten und
zwar das kleinere als Kanonikerhaus, das größere als Scheune.
Die Pfalz ist ein großes Anwesen mit einer stattlichen Zahl
von Nebengebäuden, die mit Ausnahme des Marstalls an der
Südostecke, dem Betrieb des Weinkellers dienten. Die Bau-
geschichte ist trotz den nicht spärlichen Nachrichten noch
wenig geklärt. Vom Erstbau, den Abt Witigowo 995 erbaute
(Sehr. Qu. 32), war 1702 wohl nichts mehr vorhanden. Der
zweite Bau hat Abt Diethelm v. Kastel zum Erbauer (1312).
Der ins 19. Jahrhundert gekommene bzw. auf dem Gemar-
kungsplan von 1702 enthaltene Bau ist aber nicht der des
14. Jahrhunderts. Den durch das Fuggerbild überlieferten
Formen des Hauptgebäudes nach gehört er ins 16. Jahrhun-
dert; Schönhuth (S. 316) war auch eine Nachricht bekannt,
daß Bischof Markus Sitticus von Hohenems (1561—1589) die
Pfalz erneuert habe. Das Innere des Gebäudes dürfte seiner
Einteilung nach aber auch noch späterer Zeit sein. Die Grund-
risse und die Ansicht von Süden auf einem zweiten Randbild
des Gemarkungsplanes sind vom Verfasser im Unterseeheft
1926 des Landesvereins Badische Heimat veröffentlicht wor-
den. Heute sind von der Pfalz nur das Stallgebäude und der
Ziehbrunnen erhalten.
Die Klostermauer Fr. v. Wartenbergs (Brandi 180) ist so gut
wie unversehrt bis ins 19. Jahrhundert gekommen. Sie war,
nach dem Fuggerbild (Abb. 2), etwa 10 Fuß hoch. Im Jahre
1843 wurde sie »bis auf 6 Fuß vom Boden« erniedrigt52. Die
Strecke vor dem Westflügel des Neuen Klosters wurde 1839
abgebrochen, die Strecke nördlich der Kanzlei 1836 und die
Strecke vom Neuen Kloster bis zur Bibliothek 1937 (jedoch
erneuert).
B. RÄUMLICHE ENTWICKLUNG DES KLOSTERS
1. Zustand im 8. und im frühen 9. Jahrhundert
Der Vergleich des Gemarkungsplans von 1702 mit dem
Katasterplan (Abb. 277, 278) hat gezeigt, daß Lage und
Nutzungsart des Gesamtklosters wie auch seiner Teile —
Gebäude, Hof-, Garten- und Feldflächen, Wege, Wasserläufe
und Brunnen — sich seit bald zwei Jahrhunderten kaum ge-
ändert haben. Bei näherem Zusehen wird es aber immer ein-
leuchtender, daß auch in dem Kloster von 1702 noch wesent-
lich ältere Zustände, wenn nicht in den Baukörpem so doch
der Lage nach, erhalten geblieben sind. Nimmt man dazu
noch einige Grundergebnisse der Ausgrabungen in und außer
der Kirche, wie sie im Katasterplan (Abb. 277) und im Uber-
sichtsplan der Grabungen (Abb. 280) enthalten sind, voraus,
so ist es möglich, mit hoher Sicherheit auf frühere Entwick-
lungszustände der Klosteranlage rückzuschließen. So konnte
der Versuch gemacht werden, die Gestalt des Klosters im
8. und frühen 9. Jahrhundert wieder zu gewinnen (Abb. 279).
Die Rekonstruktion geht von folgenden Erwägungen aus:
Ausgangspunkt ist der Pirminsbrunnen. Die geologischen
Verhältnisse (s. Anm. 44) machen seine Lage, besonders auch
seine Ausflußhöhe, unverrückbar. Er mußte bei der Wasser-
armut der Insel nicht nur schonlich behandelt, sondern auch
möglichst zweckmäßig ausgenutzt werden, so daß diejenigen
Teile des Klosters, die Wasser benötigten, ungehinderten Zu-
gang hatten. Diese Klosterteile waren die Klausur bzw. ihr
Refektoriumsflügel und der Wirtschaftshof. Der Gemarkungs-
plan von 1702 (Abb. 3) zeigt, wie diese mit dem Brunnen in
Beziehung gebracht sind. Kloster und Wirtschaftshof berühren
sich in der Westflucht des ersteren. Der Brunnen liegt in der
Nordwestecke des Klosterhofs und hatte zweifellos ursprüng-
lich von da seinen Abfluß in ein Becken im Wirtschaftshof.
Das ist die Stelle, wo noch am Ende des 10. Jahrhunderts nach
Vers 339 des Carmen Purchardi der Umfang des Klaustrums
nicht »rite peractus« war,- erst Witigowo hat den Zwischen-
raum überbaut. Vom Wirtschaftshof lief das Wasser weiter
zum Weihergärtlein, um dort ein drittes Mal für Kloster-
zwecke ausgenutzt zu werden, ehe es zum See abfloß.
Der Pirminsbrunnen ist also Kristallisationspunkt der Kloster-
anlage. Da der Wirtschaftshof in Verbindung mit der Außen-
welt stehen mußte, so liegt er an der Auffahrtstraße von der
Herrenbruck zum Hochufer. Folgerichtig erstreckt sich dann
das Klaustrum nach der Gegenseite und zwar nach Osten und
Süden. Das Gelände bot zu allem keine übergroßen Möglich-
keiten. Das Breitemaß des Weihergärtleins zwischen Nord-
flügel und Klostermauer mit rund 55 m ist, auch für eine
Erstanlage, bescheiden. Das gleiche gilt von dem Garten-
gelände östlich des Klaustrums mit rund 60 m Breite, wobei
noch zu berücksichtigen ist, daß auf dieser Fläche noch das
Gebäude des »Krankenhauses« (s. Katasterplan) (Abb. 277)
liegt; der ausgegrabene Ostflügel ist übrigens ganz auf Pfähle
gegründet. Jenseits der Linie der Wartenbergschen Mauer
gegen Norden und Osten des Klaustrums lag in älterer Zeit
nur unbenutzbares Ufergelände. Die Uferlinie verschiebt sich
auf dieser Strecke dauernd seewärts sowohl durch natürliche
Anlandung als durch Auffüllung. Das gilt vor allem für das
Gewann »Schiffgarten« östlich des Klosters, dessen Name
schon vermuten ließe, daß hier früher eine geschützte Bucht
lag, wenn es außerdem die scharfe Ausbiegung des Uferweges
nach Süden nicht beweisen würde. Auch das Fuggerbild läßt
den See fast bis an die Klostermauer herantreten (Abb. 2).
Im Westen, Norden und Osten des Klaustrums sind damit die
gegenseitige Lage der Klosterteile und die durch die Warten-
bergmauer bezeichneten Grenzen des Klosterbezirks als hoch-
altertümlich und ursprünglich erkannt.
Im Süden des Klosterbezirks konnte nach der Benediktiner-
regel dann nur die Kirche liegen. In Reichenau braucht also
die Nordlage des Klaustrums an sich nicht als Beweis dafür
angesprochen zu werden, daß sie aus südlichen Baugewohn-
52 G. L. A. Reich. Kirchenbaulichkeiten, Fasz. 859, Bericht der Be-
zirksbauinspektion Konstanz vom 7. 1. 43.
26