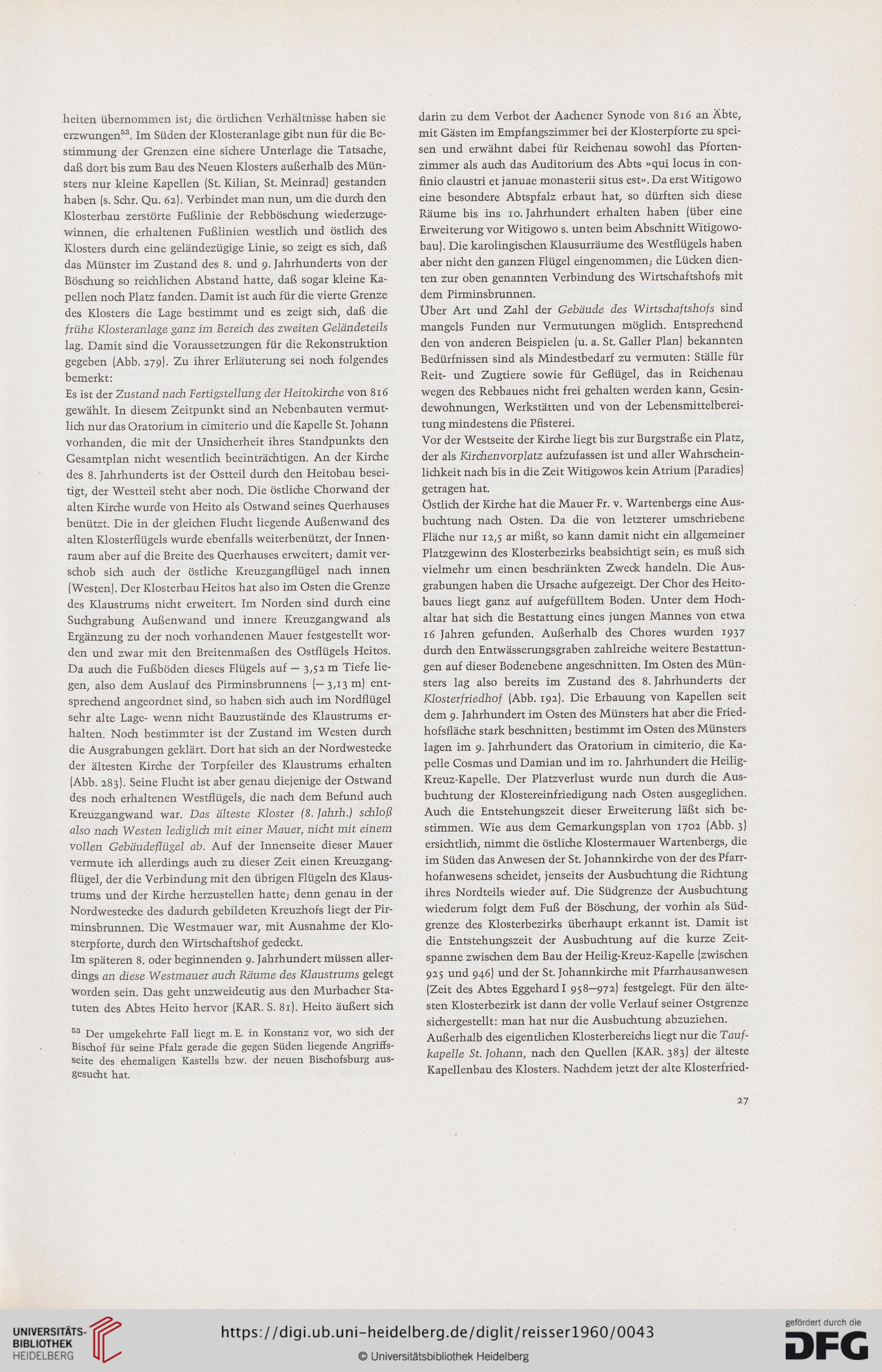beiten übernommen ist; die örtlichen Verhältnisse haben sie
erzwungen58. Im Süden der Klosteranlage gibt nun für die Be-
stimmung der Grenzen eine sichere Unterlage die Tatsache,
daß dort bis zum Bau des Neuen Klosters außerhalb des Mün-
sters nur kleine Kapellen (St. Kilian, St. Meinrad) gestanden
haben (s. Sehr. Qu. 62). Verbindet man nun, um die durch den
Klosterbau zerstörte Fußlinie der Rebböschung wiederzuge-
winnen, die erhaltenen Fußlinien westlich und östlich des
Klosters durch eine geländezügige Linie, so zeigt es sich, daß
das Münster im Zustand des 8. und 9. Jahrhunderts von der
Böschung so reichlichen Abstand hatte, daß sogar kleine Ka-
pellen noch Platz fanden. Damit ist auch für die vierte Grenze
des Klosters die Lage bestimmt und es zeigt sich, daß die
frühe Klosteranlage ganz im Bereich des zweiten Geländeteils
lag. Damit sind die Voraussetzungen für die Rekonstruktion
gegeben (Abb. 279). Zu ihrer Erläuterung sei noch folgendes
bemerkt:
Es ist der Zustand nach Fertigstellung der Heitokirche von 816
gewählt. In diesem Zeitpunkt sind an Nebenbauten vermut-
lich nur das Oratorium in cimiterio und die Kapelle St. Johann
vorhanden, die mit der Unsicherheit ihres Standpunkts den
Gesamtplan nicht wesentlich beeinträchtigen. An der Kirche
des 8. Jahrhunderts ist der Ostteil durch den Heitobau besei-
tigt, der Westteil steht aber noch. Die östliche Chorwand der
alten Kirche wurde von Heito als Ostwand seines Querhauses
benützt. Die in der gleichen Flucht liegende Außenwand des
alten Klosterflügels wurde ebenfalls weiterbenützt, der Innen-
raum aber auf die Breite des Querhauses erweitert; damit ver-
schob sich auch der östliche Kreuzgangflügel nach innen
(Westen). Der Klosterbau Heitos hat also im Osten die Grenze
des Klaustrums nicht erweitert. Im Norden sind durch eine
Suchgrabung Außenwand und innere Kreuzgangwand als
Ergänzung zu der noch vorhandenen Mauer festgestellt wor-
den und zwar mit den Breitenmaßen des Ostflügels Heitos.
Da auch die Fußböden dieses Flügels auf — 3,52 m Tiefe lie-
gen, also dem Auslauf des Pirminsbrunnens (-3,13 m) ent-
sprechend angeordnet sind, so haben sich auch im Nordflügel
sehr alte Lage- wenn nicht Bauzustände des Klaustrums er-
halten. Noch bestimmter ist der Zustand im Westen durch
die Ausgrabungen geklärt. Dort hat sich an der Nordwestecke
der ältesten Kirche der Torpfeiler des Klaustrums erhalten
(Abb. 283). Seine Flucht ist aber genau diejenige der Ostwand
des noch erhaltenen Westflügels, die nach dem Befund auch
Kreuzgangwand war. Das älteste Kloster (8. Jahrh.) schloß
also nach Westen lediglich mit einer Mauer, nicht mit einem
vollen Gebäudeflügel ab. Auf der Innenseite dieser Mauer
vermute ich allerdings auch zu dieser Zeit einen Kreuzgang-
flügel, der die Verbindung mit den übrigen Flügeln des Klaus-
trums und der Kirche herzustellen hatte; denn genau in der
Nordwestecke des dadurch gebildeten Kreuzhofs liegt der Pir-
minsbrunnen. Die Westmauer war, mit Ausnahme der Klo-
sterpforte, durch den Wirtschaftshof gedeckt.
Im späteren 8. oder beginnenden 9. Jahrhundert müssen aller-
dings an diese Westmauer auch Räume des Klaustrums gelegt
worden sein. Das geht unzweideutig aus den Murbacher Sta-
tuten des Abtes Heito hervor (KAR. S. 8r). Heito äußert sich
53 Der umgekehrte Fall liegt m. E. in Konstanz vor, wo sich der
Bischof für seine Pfalz gerade die gegen Süden liegende Angriffs-
seite des ehemaligen Kastells bzw. der neuen Bischofsburg aus-
gesucht hat.
darin zu dem Verbot der Aachener Synode von 816 an Äbte,
mit Gästen im Empfangszimmer bei der Klosterpforte zu spei-
sen und erwähnt dabei für Reichenau sowohl das Pforten-
zimmer als auch das Auditorium des Abts »qui locus in con-
finio claustri et januae monasterii situs est«.Da erstWitigowo
eine besondere Abtspfalz erbaut hat, so dürften sich diese
Räume bis ins ro. Jahrhundert erhalten haben (über eine
Erweiterung vor Witigowo s. unten beim Abschnitt Witigowo-
bau). Die karolingischen Klausurräume des Westflügels haben
aber nicht den ganzen Flügel eingenommen; die Lücken dien-
ten zur oben genannten Verbindung des Wirtschaftshofs mit
dem Pirminsbrunnen.
Uber Art und Zahl der Gebäude des Wirtschaftshofs sind
mangels Funden nur Vermutungen möglich. Entsprechend
den von anderen Beispielen (u. a. St. Galier Plan) bekannten
Bedürfnissen sind als Mindestbedarf zu vermuten: Ställe für
Reit- und Zugtiere sowie für Geflügel, das in Reichenau
wegen des Rebbaues nicht frei gehalten werden kann, Gesin-
dewohnungen, Werkstätten und von der Lebensmittelberei-
tung mindestens die Pfisterei.
Vor der Westseite der Kirche liegt bis zur Burgstraße ein Platz,
der als Kirchenvorplatz aufzufassen ist und aller Wahrschein-
lichkeit nach bis in die Zeit Witigowos kein Atrium (Paradies)
getragen hat.
Östlich der Kirche hat die Mauer Fr. v. Wartenbergs eine Aus-
buchtung nach Osten. Da die von letzterer umschriebene
Fläche nur r2,5 ar mißt, so kann damit nicht ein allgemeiner
Platzgewinn des Klosterbezirks beabsichtigt sein; es muß sich
vielmehr um einen beschränkten Zweck handeln. Die Aus-
grabungen haben die Ursache aufgezeigt. Der Chor des Heito-
baues liegt ganz auf aufgefülltem Boden. Unter dem Hoch-
altar hat sich die Bestattung eines jungen Mannes von etwa
16 Jahren gefunden. Außerhalb des Chores wurden 1937
durch den Entwässerungsgraben zahlreiche weitere Bestattun-
gen auf dieser Bodenebene angeschnitten. Im Osten des Mün-
sters lag also bereits im Zustand des 8. Jahrhunderts der
Klosterfriedhof (Abb. 192). Die Erbauung von Kapellen seit
dem 9. Jahrhundert im Osten des Münsters hat aber die Fried-
hofsfläche stark beschnitten; bestimmt im Osten des Münsters
lagen im 9. Jahrhundert das Oratorium in cimiterio, die Ka-
pelle Cosmas und Damian und im ro. Jahrhundert die Heilig-
Kreuz-Kapelle. Der Platzverlust wurde nun durch die Aus-
buchtung der Klostereinfriedigung nach Osten ausgeglichen.
Auch die Entstehungszeit dieser Erweiterung läßt sich be-
stimmen. Wie aus dem Gemarkungsplan von 1702 (Abb. 3)
ersichtlich, nimmt die östliche Klostermauer Wartenbergs, die
im Süden das Anwesen der St. Johannkirche von der des Pfarr-
hofanwesens scheidet, jenseits der Ausbuchtung die Richtung
ihres Nordteils wieder auf. Die Südgrenze der Ausbuchtung
wiederum folgt dem Fuß der Böschung, der vorhin als Süd-
grenze des Klosterbezirks überhaupt erkannt ist. Damit ist
die Entstehungszeit der Ausbuchtung auf die kurze Zeit-
spanne zwischen dem Bau der Heilig-Kreuz-Kapelle (zwischen
925 und 946) und der St. Johannkirche mit Pfarrhausanwesen
(Zeit des Abtes EggehardI 958—972) festgelegt. Für den älte-
sten Klosterbezirk ist dann der volle Verlauf seiner Ostgrenze
sichergestellt: man hat nur die Ausbuchtung abzuziehen.
Außerhalb des eigentlichen Klosterbereichs liegt nur die Tauf-
kapelle St. Johann, nach den Quellen (KAR. 383) der älteste
Kapellenbau des Klosters. Nachdem jetzt der alte Klosterfried-
27
erzwungen58. Im Süden der Klosteranlage gibt nun für die Be-
stimmung der Grenzen eine sichere Unterlage die Tatsache,
daß dort bis zum Bau des Neuen Klosters außerhalb des Mün-
sters nur kleine Kapellen (St. Kilian, St. Meinrad) gestanden
haben (s. Sehr. Qu. 62). Verbindet man nun, um die durch den
Klosterbau zerstörte Fußlinie der Rebböschung wiederzuge-
winnen, die erhaltenen Fußlinien westlich und östlich des
Klosters durch eine geländezügige Linie, so zeigt es sich, daß
das Münster im Zustand des 8. und 9. Jahrhunderts von der
Böschung so reichlichen Abstand hatte, daß sogar kleine Ka-
pellen noch Platz fanden. Damit ist auch für die vierte Grenze
des Klosters die Lage bestimmt und es zeigt sich, daß die
frühe Klosteranlage ganz im Bereich des zweiten Geländeteils
lag. Damit sind die Voraussetzungen für die Rekonstruktion
gegeben (Abb. 279). Zu ihrer Erläuterung sei noch folgendes
bemerkt:
Es ist der Zustand nach Fertigstellung der Heitokirche von 816
gewählt. In diesem Zeitpunkt sind an Nebenbauten vermut-
lich nur das Oratorium in cimiterio und die Kapelle St. Johann
vorhanden, die mit der Unsicherheit ihres Standpunkts den
Gesamtplan nicht wesentlich beeinträchtigen. An der Kirche
des 8. Jahrhunderts ist der Ostteil durch den Heitobau besei-
tigt, der Westteil steht aber noch. Die östliche Chorwand der
alten Kirche wurde von Heito als Ostwand seines Querhauses
benützt. Die in der gleichen Flucht liegende Außenwand des
alten Klosterflügels wurde ebenfalls weiterbenützt, der Innen-
raum aber auf die Breite des Querhauses erweitert; damit ver-
schob sich auch der östliche Kreuzgangflügel nach innen
(Westen). Der Klosterbau Heitos hat also im Osten die Grenze
des Klaustrums nicht erweitert. Im Norden sind durch eine
Suchgrabung Außenwand und innere Kreuzgangwand als
Ergänzung zu der noch vorhandenen Mauer festgestellt wor-
den und zwar mit den Breitenmaßen des Ostflügels Heitos.
Da auch die Fußböden dieses Flügels auf — 3,52 m Tiefe lie-
gen, also dem Auslauf des Pirminsbrunnens (-3,13 m) ent-
sprechend angeordnet sind, so haben sich auch im Nordflügel
sehr alte Lage- wenn nicht Bauzustände des Klaustrums er-
halten. Noch bestimmter ist der Zustand im Westen durch
die Ausgrabungen geklärt. Dort hat sich an der Nordwestecke
der ältesten Kirche der Torpfeiler des Klaustrums erhalten
(Abb. 283). Seine Flucht ist aber genau diejenige der Ostwand
des noch erhaltenen Westflügels, die nach dem Befund auch
Kreuzgangwand war. Das älteste Kloster (8. Jahrh.) schloß
also nach Westen lediglich mit einer Mauer, nicht mit einem
vollen Gebäudeflügel ab. Auf der Innenseite dieser Mauer
vermute ich allerdings auch zu dieser Zeit einen Kreuzgang-
flügel, der die Verbindung mit den übrigen Flügeln des Klaus-
trums und der Kirche herzustellen hatte; denn genau in der
Nordwestecke des dadurch gebildeten Kreuzhofs liegt der Pir-
minsbrunnen. Die Westmauer war, mit Ausnahme der Klo-
sterpforte, durch den Wirtschaftshof gedeckt.
Im späteren 8. oder beginnenden 9. Jahrhundert müssen aller-
dings an diese Westmauer auch Räume des Klaustrums gelegt
worden sein. Das geht unzweideutig aus den Murbacher Sta-
tuten des Abtes Heito hervor (KAR. S. 8r). Heito äußert sich
53 Der umgekehrte Fall liegt m. E. in Konstanz vor, wo sich der
Bischof für seine Pfalz gerade die gegen Süden liegende Angriffs-
seite des ehemaligen Kastells bzw. der neuen Bischofsburg aus-
gesucht hat.
darin zu dem Verbot der Aachener Synode von 816 an Äbte,
mit Gästen im Empfangszimmer bei der Klosterpforte zu spei-
sen und erwähnt dabei für Reichenau sowohl das Pforten-
zimmer als auch das Auditorium des Abts »qui locus in con-
finio claustri et januae monasterii situs est«.Da erstWitigowo
eine besondere Abtspfalz erbaut hat, so dürften sich diese
Räume bis ins ro. Jahrhundert erhalten haben (über eine
Erweiterung vor Witigowo s. unten beim Abschnitt Witigowo-
bau). Die karolingischen Klausurräume des Westflügels haben
aber nicht den ganzen Flügel eingenommen; die Lücken dien-
ten zur oben genannten Verbindung des Wirtschaftshofs mit
dem Pirminsbrunnen.
Uber Art und Zahl der Gebäude des Wirtschaftshofs sind
mangels Funden nur Vermutungen möglich. Entsprechend
den von anderen Beispielen (u. a. St. Galier Plan) bekannten
Bedürfnissen sind als Mindestbedarf zu vermuten: Ställe für
Reit- und Zugtiere sowie für Geflügel, das in Reichenau
wegen des Rebbaues nicht frei gehalten werden kann, Gesin-
dewohnungen, Werkstätten und von der Lebensmittelberei-
tung mindestens die Pfisterei.
Vor der Westseite der Kirche liegt bis zur Burgstraße ein Platz,
der als Kirchenvorplatz aufzufassen ist und aller Wahrschein-
lichkeit nach bis in die Zeit Witigowos kein Atrium (Paradies)
getragen hat.
Östlich der Kirche hat die Mauer Fr. v. Wartenbergs eine Aus-
buchtung nach Osten. Da die von letzterer umschriebene
Fläche nur r2,5 ar mißt, so kann damit nicht ein allgemeiner
Platzgewinn des Klosterbezirks beabsichtigt sein; es muß sich
vielmehr um einen beschränkten Zweck handeln. Die Aus-
grabungen haben die Ursache aufgezeigt. Der Chor des Heito-
baues liegt ganz auf aufgefülltem Boden. Unter dem Hoch-
altar hat sich die Bestattung eines jungen Mannes von etwa
16 Jahren gefunden. Außerhalb des Chores wurden 1937
durch den Entwässerungsgraben zahlreiche weitere Bestattun-
gen auf dieser Bodenebene angeschnitten. Im Osten des Mün-
sters lag also bereits im Zustand des 8. Jahrhunderts der
Klosterfriedhof (Abb. 192). Die Erbauung von Kapellen seit
dem 9. Jahrhundert im Osten des Münsters hat aber die Fried-
hofsfläche stark beschnitten; bestimmt im Osten des Münsters
lagen im 9. Jahrhundert das Oratorium in cimiterio, die Ka-
pelle Cosmas und Damian und im ro. Jahrhundert die Heilig-
Kreuz-Kapelle. Der Platzverlust wurde nun durch die Aus-
buchtung der Klostereinfriedigung nach Osten ausgeglichen.
Auch die Entstehungszeit dieser Erweiterung läßt sich be-
stimmen. Wie aus dem Gemarkungsplan von 1702 (Abb. 3)
ersichtlich, nimmt die östliche Klostermauer Wartenbergs, die
im Süden das Anwesen der St. Johannkirche von der des Pfarr-
hofanwesens scheidet, jenseits der Ausbuchtung die Richtung
ihres Nordteils wieder auf. Die Südgrenze der Ausbuchtung
wiederum folgt dem Fuß der Böschung, der vorhin als Süd-
grenze des Klosterbezirks überhaupt erkannt ist. Damit ist
die Entstehungszeit der Ausbuchtung auf die kurze Zeit-
spanne zwischen dem Bau der Heilig-Kreuz-Kapelle (zwischen
925 und 946) und der St. Johannkirche mit Pfarrhausanwesen
(Zeit des Abtes EggehardI 958—972) festgelegt. Für den älte-
sten Klosterbezirk ist dann der volle Verlauf seiner Ostgrenze
sichergestellt: man hat nur die Ausbuchtung abzuziehen.
Außerhalb des eigentlichen Klosterbereichs liegt nur die Tauf-
kapelle St. Johann, nach den Quellen (KAR. 383) der älteste
Kapellenbau des Klosters. Nachdem jetzt der alte Klosterfried-
27