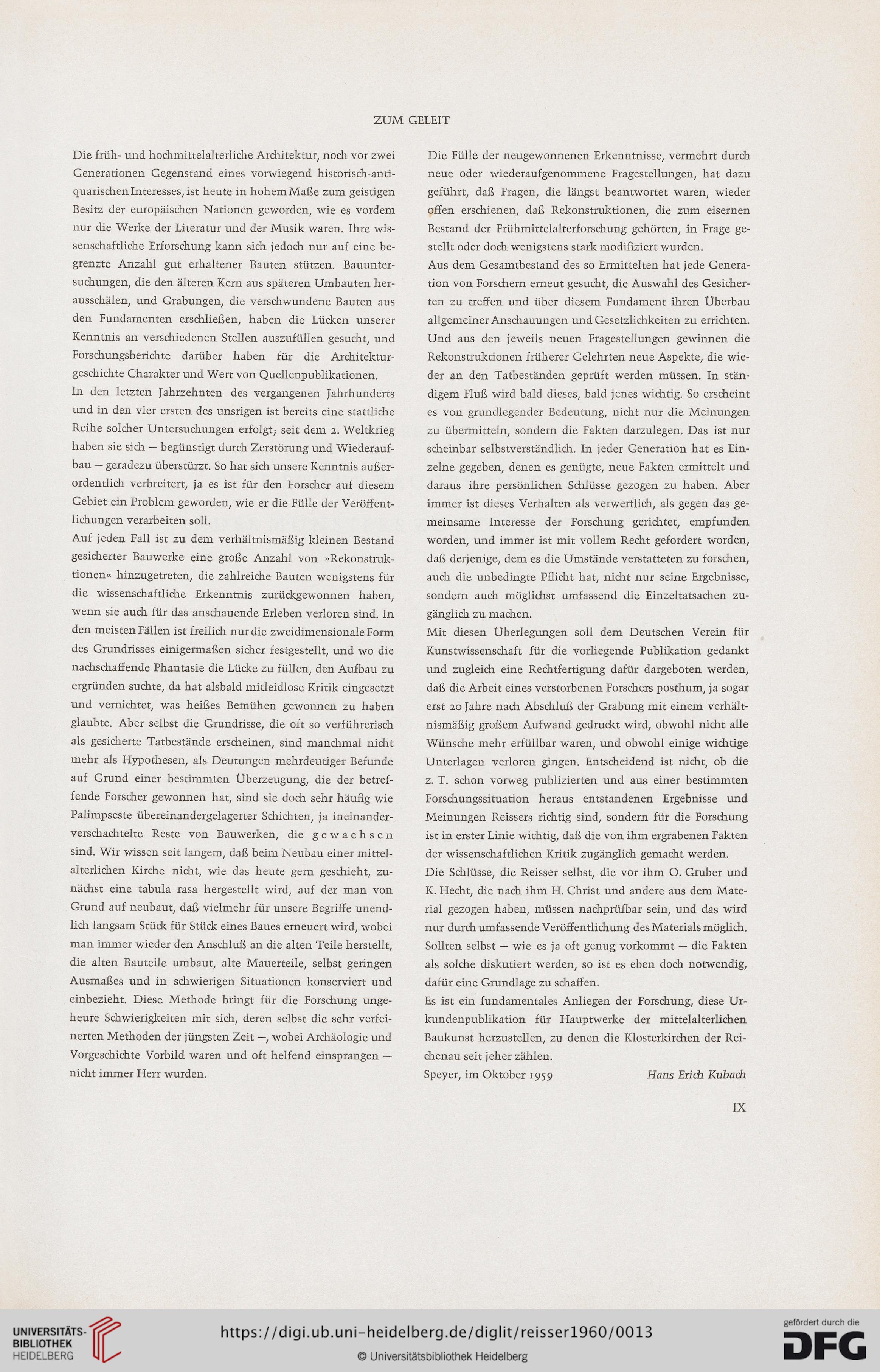ZUM GELEIT
Die früh- und hochmittelalterliche Architektur, noch vor zwei
Generationen Gegenstand eines vorwiegend historisch-anti-
quarischen Interesses, ist heute in hohem Maße zum geistigen
Besitz der europäischen Nationen geworden, wie es vordem
nur die Werke der Literatur und der Musik waren. Ihre wis-
senschaftliche Erforschung kann sich jedoch nur auf eine be-
grenzte Anzahl gut erhaltener Bauten stützen. Bauunter-
suchungen, die den älteren Kern aus späteren Umbauten her-
ausschälen, und Grabungen, die verschwundene Bauten aus
den Fundamenten erschließen, haben die Lücken unserer
Kenntnis an verschiedenen Stellen auszufüllen gesucht, und
Forschungsberichte darüber haben für die Architektur-
geschichte Charakter und Wert von Quellenpublikationen.
In den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts
und in den vier ersten des unsrigen ist bereits eine stattliche
Reihe solcher Untersuchungen erfolgt; seit dem 2. Weltkrieg
haben sie sich — begünstigt durch Zerstörung und Wiederauf-
bau — geradezu überstürzt. So hat sich unsere Kenntnis außer-
ordentlich verbreitert, ja es ist für den Forscher auf diesem
Gebiet ein Problem geworden, wie er die Fülle der Veröffent-
lichungen verarbeiten soll.
Auf jeden Fall ist zu dem verhältnismäßig kleinen Bestand
gesicherter Bauwerke eine große Anzahl von »Rekonstruk-
tionen« hinzugetreten, die zahlreiche Bauten wenigstens für
die wissenschaftliche Erkenntnis zurückgewonnen haben,
wenn sie auch für das anschauende Erleben verloren sind. In
den meisten Fällen ist freilich nur die zweidimensionale Form
des Grundrisses einigermaßen sicher festgestellt, und wo die
nachschaffende Phantasie die Lücke zu füllen, den Aufbau zu
ergründen suchte, da hat alsbald mitleidlose Kritik eingesetzt
und vernichtet, was heißes Bemühen gewonnen zu haben
glaubte. Aber selbst die Grundrisse, die oft so verführerisch
als gesicherte Tatbestände erscheinen, sind manchmal nicht
mehr als Hypothesen, als Deutungen mehrdeutiger Befunde
auf Grund einer bestimmten Überzeugung, die der betref-
fende Forscher gewonnen hat, sind sie doch sehr häufig wie
Palimpseste übereinandergelagerter Schichten, ja ineinander-
verschachtelte Reste von Bauwerken, die gewachsen
sind. Wir wissen seit langem, daß beim Neubau einer mittel-
alterlichen Kirche nicht, wie das heute gern geschieht, zu-
nächst eine tabula rasa hergestellt wird, auf der man von
Grund auf neubaut, daß vielmehr für unsere Begriffe unend-
lich langsam Stück für Stück eines Baues erneuert wird, wobei
man immer wieder den Anschluß an die alten Teile herstellt,
die alten Bauteile umbaut, alte Mauerteile, selbst geringen
Ausmaßes und in schwierigen Situationen konserviert und
einbezieht. Diese Methode bringt für die Forschung unge-
heure Schwierigkeiten mit sich, deren selbst die sehr verfei-
nerten Methoden der jüngsten Zeit —, wobei Archäologie und
Vorgeschichte Vorbild waren und oft helfend einsprangen —
nicht immer Herr wurden.
Die Fülle der neugewonnenen Erkenntnisse, vermehrt durch
neue oder wiederaufgenommene Fragestellungen, hat dazu
geführt, daß Fragen, die längst beantwortet waren, wieder
offen erschienen, daß Rekonstruktionen, die zum eisernen
Bestand der Frühmittelalterforschung gehörten, in Frage ge-
stellt oder doch wenigstens stark modifiziert wurden.
Aus dem Gesamtbestand des so Ermittelten hat jede Genera-
tion von Forschem erneut gesucht, die Auswahl des Gesicher-
ten zu treffen und über diesem Fundament ihren Überbau
allgemeiner Anschauungen und Gesetzlichkeiten zu errichten.
Und aus den jeweils neuen Fragestellungen gewinnen die
Rekonstruktionen früherer Gelehrten neue Aspekte, die wie-
der an den Tatbeständen geprüft werden müssen. In stän-
digem Fluß wird bald dieses, bald jenes wichtig. So erscheint
es von grundlegender Bedeutung, nicht nur die Meinungen
zu übermitteln, sondern die Fakten darzulegen. Das ist nur
scheinbar selbstverständlich. In jeder Generation hat es Ein-
zelne gegeben, denen es genügte, neue Fakten ermittelt und
daraus ihre persönlichen Schlüsse gezogen zu haben. Aber
immer ist dieses Verhalten als verwerflich, als gegen das ge-
meinsame Interesse der Forschung gerichtet, empfunden
worden, und immer ist mit vollem Recht gefordert worden,
daß derjenige, dem es die Umstände verstatteten zu forschen,
auch die unbedingte Pflicht hat, nicht nur seine Ergebnisse,
sondern auch möglichst umfassend die Einzeltatsachen zu-
gänglich zu machen.
Mit diesen Überlegungen soll dem Deutschen Verein für
Kunstwissenschaft für die vorliegende Publikation gedankt
und zugleich eine Rechtfertigung dafür dargeboten werden,
daß die Arbeit eines verstorbenen Forschers posthum, ja sogar
erst 20 Jahre nach Abschluß der Grabung mit einem verhält-
nismäßig großem Aufwand gedruckt wird, obwohl nicht alle
Wünsche mehr erfüllbar waren, und obwohl einige wichtige
Unterlagen verloren gingen. Entscheidend ist nicht, ob die
z. T. schon vorweg publizierten und aus einer bestimmten
Forschungssituation heraus entstandenen Ergebnisse und
Meinungen Reissers richtig sind, sondern für die Forschung
ist in erster Linie wichtig, daß die von ihm ergrabenen Fakten
der wissenschaftlichen Kritik zugänglich gemacht werden.
Die Schlüsse, die Reisser selbst, die vor ihm O. Gruber und
K. Hecht, die nach ihm H. Christ und andere aus dem Mate-
rial gezogen haben, müssen nachprüfbar sein, und das wird
nur durch umfassende Veröffentlichung des Materials möglich.
Sollten selbst — wie es ja oft genug vorkommt — die Fakten
als solche diskutiert werden, so ist es eben doch notwendig,
dafür eine Grundlage zu schaffen.
Es ist ein fundamentales Anliegen der Forschung, diese Ur-
kundenpublikation für Hauptwerke der mittelalterlichen
Baukunst herzustellen, zu denen die Klosterkirchen der Rei-
chenau seit jeher zählen.
Speyer, im Oktober 1959 Hans Erich Kubacb.
IX
Die früh- und hochmittelalterliche Architektur, noch vor zwei
Generationen Gegenstand eines vorwiegend historisch-anti-
quarischen Interesses, ist heute in hohem Maße zum geistigen
Besitz der europäischen Nationen geworden, wie es vordem
nur die Werke der Literatur und der Musik waren. Ihre wis-
senschaftliche Erforschung kann sich jedoch nur auf eine be-
grenzte Anzahl gut erhaltener Bauten stützen. Bauunter-
suchungen, die den älteren Kern aus späteren Umbauten her-
ausschälen, und Grabungen, die verschwundene Bauten aus
den Fundamenten erschließen, haben die Lücken unserer
Kenntnis an verschiedenen Stellen auszufüllen gesucht, und
Forschungsberichte darüber haben für die Architektur-
geschichte Charakter und Wert von Quellenpublikationen.
In den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts
und in den vier ersten des unsrigen ist bereits eine stattliche
Reihe solcher Untersuchungen erfolgt; seit dem 2. Weltkrieg
haben sie sich — begünstigt durch Zerstörung und Wiederauf-
bau — geradezu überstürzt. So hat sich unsere Kenntnis außer-
ordentlich verbreitert, ja es ist für den Forscher auf diesem
Gebiet ein Problem geworden, wie er die Fülle der Veröffent-
lichungen verarbeiten soll.
Auf jeden Fall ist zu dem verhältnismäßig kleinen Bestand
gesicherter Bauwerke eine große Anzahl von »Rekonstruk-
tionen« hinzugetreten, die zahlreiche Bauten wenigstens für
die wissenschaftliche Erkenntnis zurückgewonnen haben,
wenn sie auch für das anschauende Erleben verloren sind. In
den meisten Fällen ist freilich nur die zweidimensionale Form
des Grundrisses einigermaßen sicher festgestellt, und wo die
nachschaffende Phantasie die Lücke zu füllen, den Aufbau zu
ergründen suchte, da hat alsbald mitleidlose Kritik eingesetzt
und vernichtet, was heißes Bemühen gewonnen zu haben
glaubte. Aber selbst die Grundrisse, die oft so verführerisch
als gesicherte Tatbestände erscheinen, sind manchmal nicht
mehr als Hypothesen, als Deutungen mehrdeutiger Befunde
auf Grund einer bestimmten Überzeugung, die der betref-
fende Forscher gewonnen hat, sind sie doch sehr häufig wie
Palimpseste übereinandergelagerter Schichten, ja ineinander-
verschachtelte Reste von Bauwerken, die gewachsen
sind. Wir wissen seit langem, daß beim Neubau einer mittel-
alterlichen Kirche nicht, wie das heute gern geschieht, zu-
nächst eine tabula rasa hergestellt wird, auf der man von
Grund auf neubaut, daß vielmehr für unsere Begriffe unend-
lich langsam Stück für Stück eines Baues erneuert wird, wobei
man immer wieder den Anschluß an die alten Teile herstellt,
die alten Bauteile umbaut, alte Mauerteile, selbst geringen
Ausmaßes und in schwierigen Situationen konserviert und
einbezieht. Diese Methode bringt für die Forschung unge-
heure Schwierigkeiten mit sich, deren selbst die sehr verfei-
nerten Methoden der jüngsten Zeit —, wobei Archäologie und
Vorgeschichte Vorbild waren und oft helfend einsprangen —
nicht immer Herr wurden.
Die Fülle der neugewonnenen Erkenntnisse, vermehrt durch
neue oder wiederaufgenommene Fragestellungen, hat dazu
geführt, daß Fragen, die längst beantwortet waren, wieder
offen erschienen, daß Rekonstruktionen, die zum eisernen
Bestand der Frühmittelalterforschung gehörten, in Frage ge-
stellt oder doch wenigstens stark modifiziert wurden.
Aus dem Gesamtbestand des so Ermittelten hat jede Genera-
tion von Forschem erneut gesucht, die Auswahl des Gesicher-
ten zu treffen und über diesem Fundament ihren Überbau
allgemeiner Anschauungen und Gesetzlichkeiten zu errichten.
Und aus den jeweils neuen Fragestellungen gewinnen die
Rekonstruktionen früherer Gelehrten neue Aspekte, die wie-
der an den Tatbeständen geprüft werden müssen. In stän-
digem Fluß wird bald dieses, bald jenes wichtig. So erscheint
es von grundlegender Bedeutung, nicht nur die Meinungen
zu übermitteln, sondern die Fakten darzulegen. Das ist nur
scheinbar selbstverständlich. In jeder Generation hat es Ein-
zelne gegeben, denen es genügte, neue Fakten ermittelt und
daraus ihre persönlichen Schlüsse gezogen zu haben. Aber
immer ist dieses Verhalten als verwerflich, als gegen das ge-
meinsame Interesse der Forschung gerichtet, empfunden
worden, und immer ist mit vollem Recht gefordert worden,
daß derjenige, dem es die Umstände verstatteten zu forschen,
auch die unbedingte Pflicht hat, nicht nur seine Ergebnisse,
sondern auch möglichst umfassend die Einzeltatsachen zu-
gänglich zu machen.
Mit diesen Überlegungen soll dem Deutschen Verein für
Kunstwissenschaft für die vorliegende Publikation gedankt
und zugleich eine Rechtfertigung dafür dargeboten werden,
daß die Arbeit eines verstorbenen Forschers posthum, ja sogar
erst 20 Jahre nach Abschluß der Grabung mit einem verhält-
nismäßig großem Aufwand gedruckt wird, obwohl nicht alle
Wünsche mehr erfüllbar waren, und obwohl einige wichtige
Unterlagen verloren gingen. Entscheidend ist nicht, ob die
z. T. schon vorweg publizierten und aus einer bestimmten
Forschungssituation heraus entstandenen Ergebnisse und
Meinungen Reissers richtig sind, sondern für die Forschung
ist in erster Linie wichtig, daß die von ihm ergrabenen Fakten
der wissenschaftlichen Kritik zugänglich gemacht werden.
Die Schlüsse, die Reisser selbst, die vor ihm O. Gruber und
K. Hecht, die nach ihm H. Christ und andere aus dem Mate-
rial gezogen haben, müssen nachprüfbar sein, und das wird
nur durch umfassende Veröffentlichung des Materials möglich.
Sollten selbst — wie es ja oft genug vorkommt — die Fakten
als solche diskutiert werden, so ist es eben doch notwendig,
dafür eine Grundlage zu schaffen.
Es ist ein fundamentales Anliegen der Forschung, diese Ur-
kundenpublikation für Hauptwerke der mittelalterlichen
Baukunst herzustellen, zu denen die Klosterkirchen der Rei-
chenau seit jeher zählen.
Speyer, im Oktober 1959 Hans Erich Kubacb.
IX