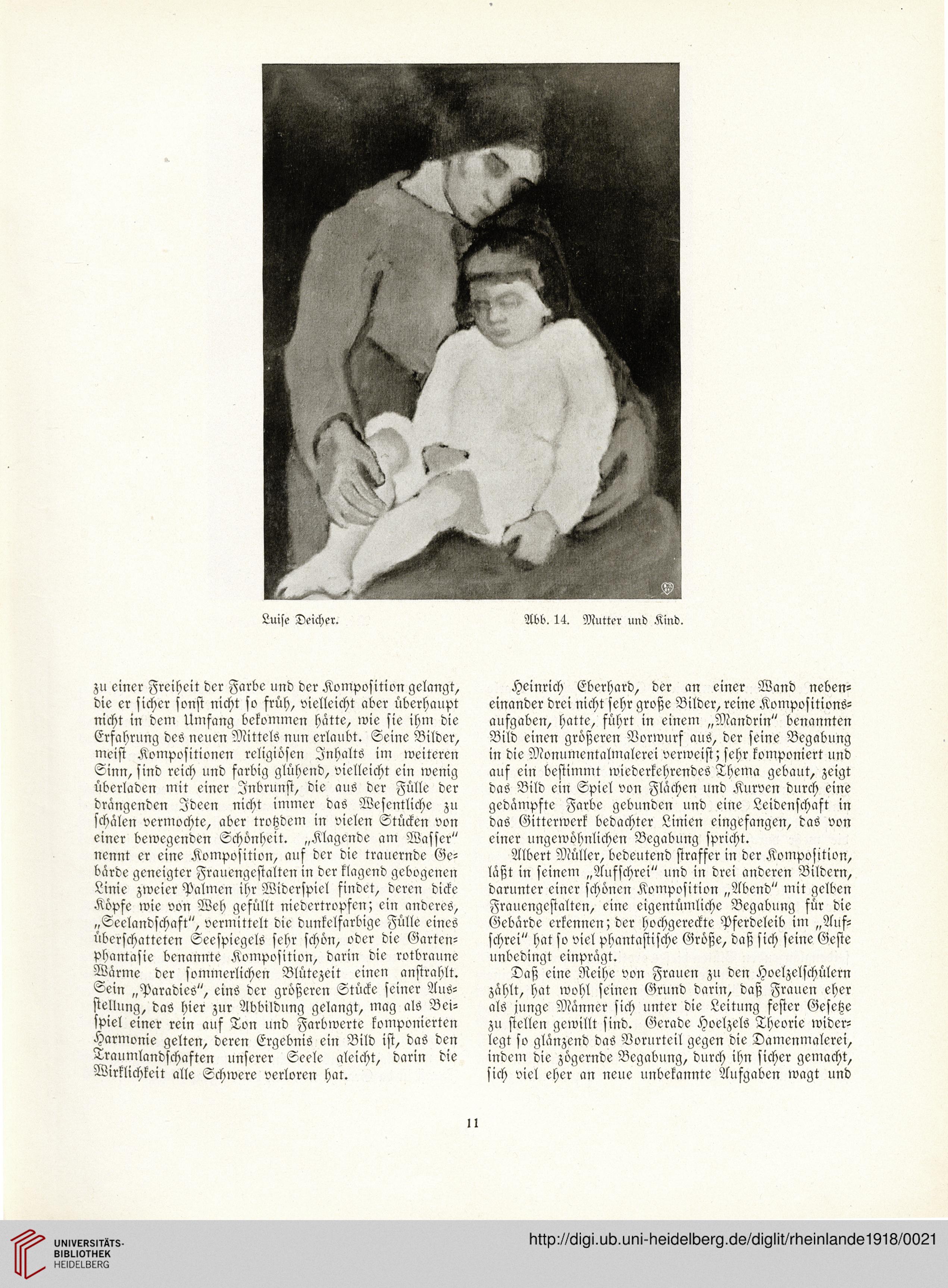Lmse Deicher.
Abb. 14. Mutter und Kind.
zu einer Freiheit der Farbe und der Kompositwn gelangt,
die er sicher sonst nicht so früh, vielleicht aber überhaupt
nicht in dem Umsang bekommen hätte, wie sie ihm die
Erfahrung des neuen Mittels nun erlaubt. Seine Bilder,
meist Kompositionen religiösen Jnhalts im weiteren
Sinn, sind reich und farbig glühend, vielleicht ein wenig
überladen mit einer Jnbrunst, die aus der Fülle der
drangenden Jdeen nicht immer das Wesentliche zu
schälen vermochte, aber trotzdem in vielen Stücken von
einer bewegenden Schönheit. „Klagende am Wasser"
nennt er eine Komposition, auf der die trauernde Ge-
bärde geneigter Frauengestalten in der klagend gebogenen
Linie zweier Palmen ihr Widerspiel findet, deren dicke
Köpfe wie von Weh gefüllt niedertropfen; ein anderes,
„Seelandschaft", vermittelt die dunkelfarbige Fülle eines
überschatteten Seespiegels sehr schön, oder die Garten-
Phantasie benannte Komposition, darin die rotbraune
Wärme der sommerlichen Blütezeit einen anstrahlt.
Sein „Paradies", eins der größeren Stücke seiner Aus-
stellung, das hier zur Abbildung gelangt, mag als Bei-
spiel einer rein auf Ton und Farbwerte komponierten
Harmonie gelten, deren Ergebnis ein Bild ist, das den
Traumlandschaften unserer Seele aleicht, darin die
Wirklichkeit alle Schwere verloren hat.
Heinrich Eberhard, der an einer Wand neben-
einander drei nicht sehr große Bilder, reine Kompositions-
aufgaben, hatte, führt in einem „Mandrin" benannten
Bild einen größeren Vorwurf aus, der seine Begabung
in die Monunientalnmlerei verweist; sehr komponiert und
auf ein bestimmt wiederkehrendes Thema gebaut, zeigt
das Bild ein Spiel von Flächcn und Kurven durch eine
gedämpfte Farbe gebunden und eine Leidenschaft in
das Gitterwerk bedachter Linien eingefangen, das von
einer ungewöhnlichen Begabung spricht.
Albert Müller, bedeutend straffer in der Komposition,
läßt in seinem „Aufschrei" und in drei anderen Bildern,
darunter einer schönen Komposition „Abend" mit gelben
Frauengestaltcn, eine eigentümliche Begabung für die
Gebärde erkennen; der hochgereckte Pferdeleib im „Auf-
schrei" hat so viel phantastische Größe, daß sich seine Geste
unbedingt einprägt.
Daß eine Reihe von Frauen zu den Hoelzelschülern
zählt, hat wohl seinen Grund darin, daß Frauen eher
als junge Männer sich unter die Leitung fester Gesetze
zu stellen gewillt sind. Gerade Hoelzels Theorie wider-
legt so glänzend das Vorurteil gegen die Damenmalerei,
indem die zögernde Begabung, durch ihn sicher gemacht,
sich viel eher an neue unbekannte Aufgaben wagt und
il
Abb. 14. Mutter und Kind.
zu einer Freiheit der Farbe und der Kompositwn gelangt,
die er sicher sonst nicht so früh, vielleicht aber überhaupt
nicht in dem Umsang bekommen hätte, wie sie ihm die
Erfahrung des neuen Mittels nun erlaubt. Seine Bilder,
meist Kompositionen religiösen Jnhalts im weiteren
Sinn, sind reich und farbig glühend, vielleicht ein wenig
überladen mit einer Jnbrunst, die aus der Fülle der
drangenden Jdeen nicht immer das Wesentliche zu
schälen vermochte, aber trotzdem in vielen Stücken von
einer bewegenden Schönheit. „Klagende am Wasser"
nennt er eine Komposition, auf der die trauernde Ge-
bärde geneigter Frauengestalten in der klagend gebogenen
Linie zweier Palmen ihr Widerspiel findet, deren dicke
Köpfe wie von Weh gefüllt niedertropfen; ein anderes,
„Seelandschaft", vermittelt die dunkelfarbige Fülle eines
überschatteten Seespiegels sehr schön, oder die Garten-
Phantasie benannte Komposition, darin die rotbraune
Wärme der sommerlichen Blütezeit einen anstrahlt.
Sein „Paradies", eins der größeren Stücke seiner Aus-
stellung, das hier zur Abbildung gelangt, mag als Bei-
spiel einer rein auf Ton und Farbwerte komponierten
Harmonie gelten, deren Ergebnis ein Bild ist, das den
Traumlandschaften unserer Seele aleicht, darin die
Wirklichkeit alle Schwere verloren hat.
Heinrich Eberhard, der an einer Wand neben-
einander drei nicht sehr große Bilder, reine Kompositions-
aufgaben, hatte, führt in einem „Mandrin" benannten
Bild einen größeren Vorwurf aus, der seine Begabung
in die Monunientalnmlerei verweist; sehr komponiert und
auf ein bestimmt wiederkehrendes Thema gebaut, zeigt
das Bild ein Spiel von Flächcn und Kurven durch eine
gedämpfte Farbe gebunden und eine Leidenschaft in
das Gitterwerk bedachter Linien eingefangen, das von
einer ungewöhnlichen Begabung spricht.
Albert Müller, bedeutend straffer in der Komposition,
läßt in seinem „Aufschrei" und in drei anderen Bildern,
darunter einer schönen Komposition „Abend" mit gelben
Frauengestaltcn, eine eigentümliche Begabung für die
Gebärde erkennen; der hochgereckte Pferdeleib im „Auf-
schrei" hat so viel phantastische Größe, daß sich seine Geste
unbedingt einprägt.
Daß eine Reihe von Frauen zu den Hoelzelschülern
zählt, hat wohl seinen Grund darin, daß Frauen eher
als junge Männer sich unter die Leitung fester Gesetze
zu stellen gewillt sind. Gerade Hoelzels Theorie wider-
legt so glänzend das Vorurteil gegen die Damenmalerei,
indem die zögernde Begabung, durch ihn sicher gemacht,
sich viel eher an neue unbekannte Aufgaben wagt und
il